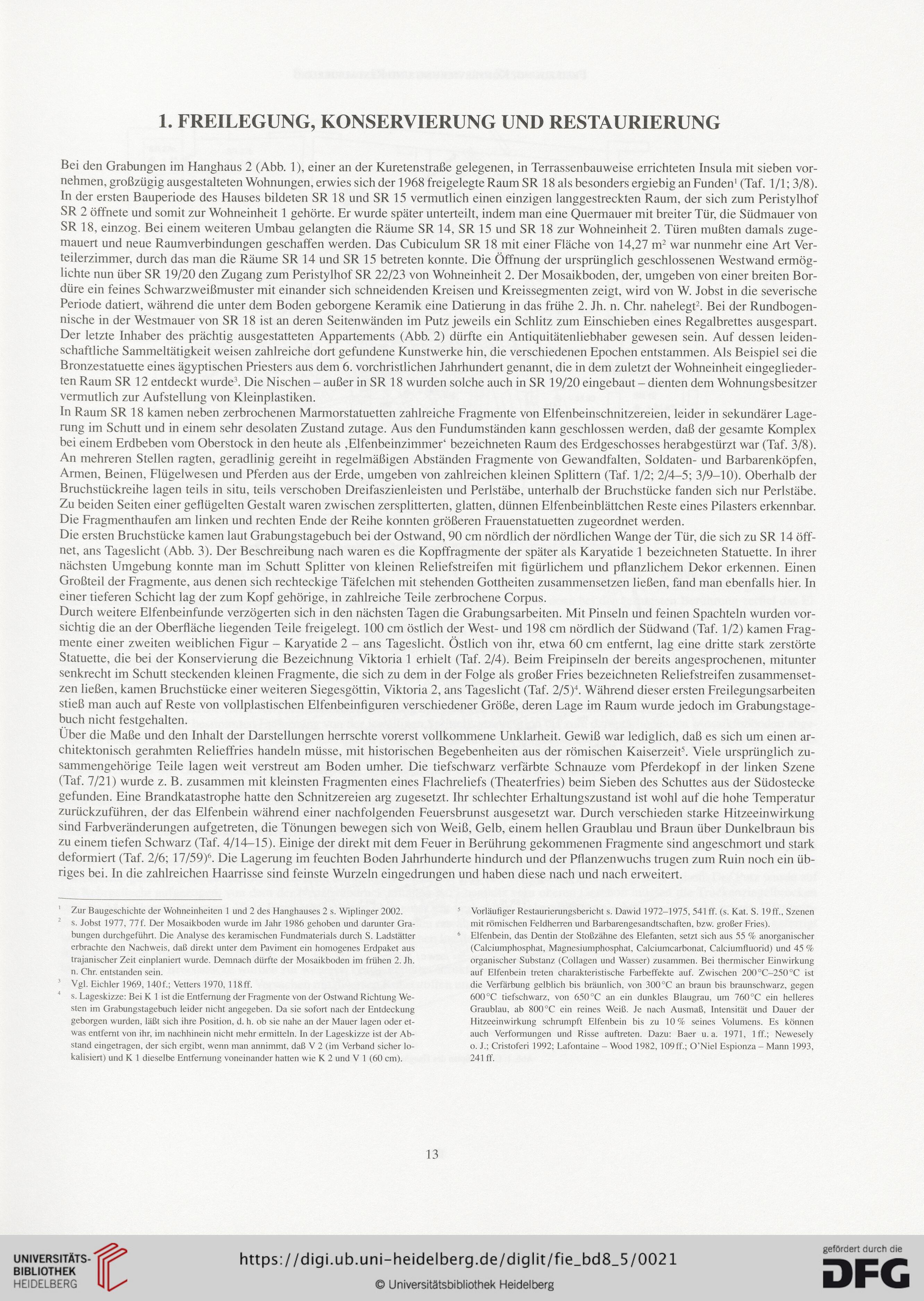1. FREILEGUNG, KONSERVIERUNG UND RESTAURIERUNG
Bei den Grabungen im Hanghaus 2 (Abb. 1), einer an der Kuretenstraße gelegenen, in Terrassenbauweise errichteten Insula mit sieben vor-
nehmen, großzügig ausgestalteten Wohnungen, erwies sich der 1968 freigelegte Raum SR 18 als besonders ergiebig an Funden1 (Taf. 1/1; 3/8).
In der ersten Bauperiode des Hauses bildeten SR 18 und SR 15 vermutlich einen einzigen langgestreckten Raum, der sich zum Peristylhof
SR 2 öffnete und somit zur Wohneinheit 1 gehörte. Er wurde später unterteilt, indem man eine Quermauer mit breiter Tür, die Südmauer von
SR 18, einzog. Bei einem weiteren Umbau gelangten die Räume SR 14, SR 15 und SR 18 zur Wohneinheit 2. Türen mußten damals zuge-
mauert und neue Raumverbindungen geschaffen werden. Das Cubiculum SR 18 mit einer Fläche von 14,27 m2 war nunmehr eine Art Ver-
teilerzimmer, durch das man die Räume SR 14 und SR 15 betreten konnte. Die Öffnung der ursprünglich geschlossenen Westwand ermög-
lichte nun über SR 19/20 den Zugang zum Peristylhof SR 22/23 von Wohneinheit 2. Der Mosaikboden, der, umgeben von einer breiten Bor-
düre ein feines Schwarzweißmuster mit einander sich schneidenden Kreisen und Kreissegmenten zeigt, wird von W. Jobst in die severische
Periode datiert, während die unter dem Boden geborgene Keramik eine Datierung in das frühe 2. Jh. n. Chr. nahelegt2. Bei der Rundbogen-
nische in der Westmauer von SR 18 ist an deren Seitenwänden im Putz jeweils ein Schlitz zum Einschieben eines Regalbrettes ausgespart.
Der letzte Inhaber des prächtig ausgestatteten Appartements (Abb. 2) dürfte ein Antiquitätenliebhaber gewesen sein. Auf dessen leiden-
schaftliche Sammeltätigkeit weisen zahlreiche dort gefundene Kunstwerke hin, die verschiedenen Epochen entstammen. Als Beispiel sei die
Bronzestatuette eines ägyptischen Priesters aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert genannt, die in dem zuletzt der Wohneinheit eingeglieder-
ten Raum SR 12 entdeckt wurde3. Die Nischen - außer in SR 18 wurden solche auch in SR 19/20 eingebaut - dienten dem Wohnungsbesitzer
vermutlich zur Aufstellung von Kleinplastiken.
In Raum SR 18 kamen neben zerbrochenen Marmorstatuetten zahlreiche Fragmente von Elfenbeinschnitzereien, leider in sekundärer Lage-
rung im Schutt und in einem sehr desolaten Zustand zutage. Aus den Fundumständen kann geschlossen werden, daß der gesamte Komplex
bei einem Erdbeben vom Oberstock in den heute als ,Elfenbeinzimmer4 bezeichneten Raum des Erdgeschosses herabgestürzt war (Taf. 3/8).
An mehreren Stellen ragten, geradlinig gereiht in regelmäßigen Abständen Fragmente von Gewandfalten, Soldaten- und Barbarenköpfen,
Armen, Beinen, Flügelwesen und Pferden aus der Erde, umgeben von zahlreichen kleinen Splittern (Taf. 1/2; 2/4-5; 3/9-10). Oberhalb der
Bruchstückreihe lagen teils in situ, teils verschoben Dreifaszienleisten und Perlstäbe, unterhalb der Bruchstücke fanden sich nur Perlstäbe.
Zu beiden Seiten einer geflügelten Gestalt waren zwischen zersplitterten, glatten, dünnen Elfenbeinblättchen Reste eines Pilasters erkennbar.
Die Fragmenthaufen am linken und rechten Ende der Reihe konnten größeren Frauenstatuetten zugeordnet werden.
Die ersten Bruchstücke kamen laut Grabungstagebuch bei der Ostwand, 90 cm nördlich der nördlichen Wange der Tür, die sich zu SR 14 öff-
net, ans Tageslicht (Abb. 3). Der Beschreibung nach waren es die Kopffragmente der später als Karyatide 1 bezeichneten Statuette. In ihrer
nächsten Umgebung konnte man im Schutt Splitter von kleinen Reliefstreifen mit figürlichem und pflanzlichem Dekor erkennen. Einen
Großteil der Fragmente, aus denen sich rechteckige Täfelchen mit stehenden Gottheiten zusammensetzen ließen, fand man ebenfalls hier. In
einer tieferen Schicht lag der zum Kopf gehörige, in zahlreiche Teile zerbrochene Corpus.
Durch weitere Elfenbeinfunde verzögerten sich in den nächsten Tagen die Grabungsarbeiten. Mit Pinseln und feinen Spachteln wurden vor-
sichtig die an der Oberfläche liegenden Teile freigelegt. 100 cm östlich der West- und 198 cm nördlich der Südwand (Taf. 1/2) kamen Frag-
mente einer zweiten weiblichen Figur - Karyatide 2 - ans Tageslicht. Östlich von ihr, etwa 60 cm entfernt, lag eine dritte stark zerstörte
Statuette, die bei der Konservierung die Bezeichnung Viktoria 1 erhielt (Taf. 2/4). Beim Freipinseln der bereits angesprochenen, mitunter
senkrecht im Schutt steckenden kleinen Fragmente, die sich zu dem in der Folge als großer Fries bezeichneten Reliefstreifen zusammenset-
zen ließen, kamen Bruchstücke einer weiteren Siegesgöttin, Viktoria 2, ans Tageslicht (Taf. 2/5)4. Während dieser ersten Freilegungsarbeiten
stieß man auch auf Reste von vollplastischen Elfenbeinfiguren verschiedener Größe, deren Lage im Raum wurde jedoch im Grabungstage-
buch nicht festgehalten.
Uber die Maße und den Inhalt der Darstellungen herrschte vorerst vollkommene Unklarheit. Gewiß war lediglich, daß es sich um einen ar-
chitektonisch gerahmten Relieffries handeln müsse, mit historischen Begebenheiten aus der römischen Kaiserzeit5. Viele ursprünglich zu-
sammengehörige Teile lagen weit verstreut am Boden umher. Die tiefschwarz verfärbte Schnauze vom Pferdekopf in der linken Szene
(Taf. 7/21) wurde z. B. zusammen mit kleinsten Fragmenten eines Flachreliefs (Theaterfries) beim Sieben des Schuttes aus der Südostecke
gefunden. Eine Brandkatastrophe hatte den Schnitzereien arg zugesetzt. Ihr schlechter Erhaltungszustand ist wohl auf die hohe Temperatur
zurückzuführen, der das Elfenbein während einer nachfolgenden Feuersbrunst ausgesetzt war. Durch verschieden starke Hitzeeinwirkung
sind Farbveränderungen aufgetreten, die Tönungen bewegen sich von Weiß, Gelb, einem hellen Graublau und Braun über Dunkelbraun bis
zu einem tiefen Schwarz (Taf. 4/14—15). Einige der direkt mit dem Feuer in Berührung gekommenen Fragmente sind angeschmort und stark
deformiert (Taf. 2/6; 17/59)6. Die Lagerung im feuchten Boden Jahrhunderte hindurch und der Pflanzenwuchs trugen zum Ruin noch ein üb-
riges bei. In die zahlreichen Haarrisse sind feinste Wurzeln eingedrungen und haben diese nach und nach erweitert.
1 Zur Baugeschichte der Wohneinheiten 1 und 2 des Hanghauses 2 s. Wiplinger 2002.
2 s. Jobst 1977, 77f. Der Mosaikboden wurde im Jahr 1986 gehoben und darunter Gra-
bungen durchgeführt. Die Analyse des keramischen Fundmaterials durch S. Ladstätter
erbrachte den Nachweis, daß direkt unter dem Paviment ein homogenes Erdpaket aus
trajanischer Zeit einplaniert wurde. Demnach dürfte der Mosaikboden im frühen 2. Jh.
n. Chr. entstanden sein.
’ Vgl. Eichler 1969,140f.; Vetters 1970, 118 ff.
4 s. Lageskizze: Bei K 1 ist die Entfernung der Fragmente von der Ostwand Richtung We-
sten im Grabungstagebuch leider nicht angegeben. Da sie sofort nach der Entdeckung
geborgen wurden, läßt sich ihre Position, d. h. ob sie nahe an der Mauer lagen oder et-
was entfernt von ihr, im nachhinein nicht mehr ermitteln. In der Lageskizze ist der Ab-
stand eingetragen, der sich ergibt, wenn man annimmt, daß V 2 (im Verband sicher lo-
kalisiert) und K 1 dieselbe Entfernung voneinander hatten wie K 2 und V 1 (60 cm).
5 Vorläufiger Restaurierungsbericht s. Dawid 1972-1975, 541ff. (s. Kat. S. 19 ff., Szenen
mit römischen Feldherren und Barbarengesandtschaften, bzw. großer Fries).
6 Elfenbein, das Dentin der Stoßzähne des Elefanten, setzt sich aus 55 % anorganischer
(Calciumphosphat, Magnesiumphosphat, Calciumcarbonat, Calciumfluorid) und 45 %
organischer Substanz (Collagen und Wasser) zusammen. Bei thermischer Einwirkung
auf Elfenbein treten charakteristische Farbeffekte auf. Zwischen 200°C-250°C ist
die Verfärbung gelblich bis bräunlich, von 300 °C an braun bis braunschwarz, gegen
600 °C tiefschwarz, von 650 °C an ein dunkles Blaugrau, um 760 °C ein helleres
Graublau, ab 800 °C ein reines Weiß. Je nach Ausmaß, Intensität und Dauer der
Hitzeeinwirkung schrumpft Elfenbein bis zu 10 % seines Volumens. Es können
auch Verformungen und Risse auftreten. Dazu: Baer u. a. 1971, 1 ff.; Newesely
o. L: Cristoferi 1992; Lafontaine - Wood 1982, 109ff.; O’Niel Espionza - Mann 1993,
241 ff.
13
Bei den Grabungen im Hanghaus 2 (Abb. 1), einer an der Kuretenstraße gelegenen, in Terrassenbauweise errichteten Insula mit sieben vor-
nehmen, großzügig ausgestalteten Wohnungen, erwies sich der 1968 freigelegte Raum SR 18 als besonders ergiebig an Funden1 (Taf. 1/1; 3/8).
In der ersten Bauperiode des Hauses bildeten SR 18 und SR 15 vermutlich einen einzigen langgestreckten Raum, der sich zum Peristylhof
SR 2 öffnete und somit zur Wohneinheit 1 gehörte. Er wurde später unterteilt, indem man eine Quermauer mit breiter Tür, die Südmauer von
SR 18, einzog. Bei einem weiteren Umbau gelangten die Räume SR 14, SR 15 und SR 18 zur Wohneinheit 2. Türen mußten damals zuge-
mauert und neue Raumverbindungen geschaffen werden. Das Cubiculum SR 18 mit einer Fläche von 14,27 m2 war nunmehr eine Art Ver-
teilerzimmer, durch das man die Räume SR 14 und SR 15 betreten konnte. Die Öffnung der ursprünglich geschlossenen Westwand ermög-
lichte nun über SR 19/20 den Zugang zum Peristylhof SR 22/23 von Wohneinheit 2. Der Mosaikboden, der, umgeben von einer breiten Bor-
düre ein feines Schwarzweißmuster mit einander sich schneidenden Kreisen und Kreissegmenten zeigt, wird von W. Jobst in die severische
Periode datiert, während die unter dem Boden geborgene Keramik eine Datierung in das frühe 2. Jh. n. Chr. nahelegt2. Bei der Rundbogen-
nische in der Westmauer von SR 18 ist an deren Seitenwänden im Putz jeweils ein Schlitz zum Einschieben eines Regalbrettes ausgespart.
Der letzte Inhaber des prächtig ausgestatteten Appartements (Abb. 2) dürfte ein Antiquitätenliebhaber gewesen sein. Auf dessen leiden-
schaftliche Sammeltätigkeit weisen zahlreiche dort gefundene Kunstwerke hin, die verschiedenen Epochen entstammen. Als Beispiel sei die
Bronzestatuette eines ägyptischen Priesters aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert genannt, die in dem zuletzt der Wohneinheit eingeglieder-
ten Raum SR 12 entdeckt wurde3. Die Nischen - außer in SR 18 wurden solche auch in SR 19/20 eingebaut - dienten dem Wohnungsbesitzer
vermutlich zur Aufstellung von Kleinplastiken.
In Raum SR 18 kamen neben zerbrochenen Marmorstatuetten zahlreiche Fragmente von Elfenbeinschnitzereien, leider in sekundärer Lage-
rung im Schutt und in einem sehr desolaten Zustand zutage. Aus den Fundumständen kann geschlossen werden, daß der gesamte Komplex
bei einem Erdbeben vom Oberstock in den heute als ,Elfenbeinzimmer4 bezeichneten Raum des Erdgeschosses herabgestürzt war (Taf. 3/8).
An mehreren Stellen ragten, geradlinig gereiht in regelmäßigen Abständen Fragmente von Gewandfalten, Soldaten- und Barbarenköpfen,
Armen, Beinen, Flügelwesen und Pferden aus der Erde, umgeben von zahlreichen kleinen Splittern (Taf. 1/2; 2/4-5; 3/9-10). Oberhalb der
Bruchstückreihe lagen teils in situ, teils verschoben Dreifaszienleisten und Perlstäbe, unterhalb der Bruchstücke fanden sich nur Perlstäbe.
Zu beiden Seiten einer geflügelten Gestalt waren zwischen zersplitterten, glatten, dünnen Elfenbeinblättchen Reste eines Pilasters erkennbar.
Die Fragmenthaufen am linken und rechten Ende der Reihe konnten größeren Frauenstatuetten zugeordnet werden.
Die ersten Bruchstücke kamen laut Grabungstagebuch bei der Ostwand, 90 cm nördlich der nördlichen Wange der Tür, die sich zu SR 14 öff-
net, ans Tageslicht (Abb. 3). Der Beschreibung nach waren es die Kopffragmente der später als Karyatide 1 bezeichneten Statuette. In ihrer
nächsten Umgebung konnte man im Schutt Splitter von kleinen Reliefstreifen mit figürlichem und pflanzlichem Dekor erkennen. Einen
Großteil der Fragmente, aus denen sich rechteckige Täfelchen mit stehenden Gottheiten zusammensetzen ließen, fand man ebenfalls hier. In
einer tieferen Schicht lag der zum Kopf gehörige, in zahlreiche Teile zerbrochene Corpus.
Durch weitere Elfenbeinfunde verzögerten sich in den nächsten Tagen die Grabungsarbeiten. Mit Pinseln und feinen Spachteln wurden vor-
sichtig die an der Oberfläche liegenden Teile freigelegt. 100 cm östlich der West- und 198 cm nördlich der Südwand (Taf. 1/2) kamen Frag-
mente einer zweiten weiblichen Figur - Karyatide 2 - ans Tageslicht. Östlich von ihr, etwa 60 cm entfernt, lag eine dritte stark zerstörte
Statuette, die bei der Konservierung die Bezeichnung Viktoria 1 erhielt (Taf. 2/4). Beim Freipinseln der bereits angesprochenen, mitunter
senkrecht im Schutt steckenden kleinen Fragmente, die sich zu dem in der Folge als großer Fries bezeichneten Reliefstreifen zusammenset-
zen ließen, kamen Bruchstücke einer weiteren Siegesgöttin, Viktoria 2, ans Tageslicht (Taf. 2/5)4. Während dieser ersten Freilegungsarbeiten
stieß man auch auf Reste von vollplastischen Elfenbeinfiguren verschiedener Größe, deren Lage im Raum wurde jedoch im Grabungstage-
buch nicht festgehalten.
Uber die Maße und den Inhalt der Darstellungen herrschte vorerst vollkommene Unklarheit. Gewiß war lediglich, daß es sich um einen ar-
chitektonisch gerahmten Relieffries handeln müsse, mit historischen Begebenheiten aus der römischen Kaiserzeit5. Viele ursprünglich zu-
sammengehörige Teile lagen weit verstreut am Boden umher. Die tiefschwarz verfärbte Schnauze vom Pferdekopf in der linken Szene
(Taf. 7/21) wurde z. B. zusammen mit kleinsten Fragmenten eines Flachreliefs (Theaterfries) beim Sieben des Schuttes aus der Südostecke
gefunden. Eine Brandkatastrophe hatte den Schnitzereien arg zugesetzt. Ihr schlechter Erhaltungszustand ist wohl auf die hohe Temperatur
zurückzuführen, der das Elfenbein während einer nachfolgenden Feuersbrunst ausgesetzt war. Durch verschieden starke Hitzeeinwirkung
sind Farbveränderungen aufgetreten, die Tönungen bewegen sich von Weiß, Gelb, einem hellen Graublau und Braun über Dunkelbraun bis
zu einem tiefen Schwarz (Taf. 4/14—15). Einige der direkt mit dem Feuer in Berührung gekommenen Fragmente sind angeschmort und stark
deformiert (Taf. 2/6; 17/59)6. Die Lagerung im feuchten Boden Jahrhunderte hindurch und der Pflanzenwuchs trugen zum Ruin noch ein üb-
riges bei. In die zahlreichen Haarrisse sind feinste Wurzeln eingedrungen und haben diese nach und nach erweitert.
1 Zur Baugeschichte der Wohneinheiten 1 und 2 des Hanghauses 2 s. Wiplinger 2002.
2 s. Jobst 1977, 77f. Der Mosaikboden wurde im Jahr 1986 gehoben und darunter Gra-
bungen durchgeführt. Die Analyse des keramischen Fundmaterials durch S. Ladstätter
erbrachte den Nachweis, daß direkt unter dem Paviment ein homogenes Erdpaket aus
trajanischer Zeit einplaniert wurde. Demnach dürfte der Mosaikboden im frühen 2. Jh.
n. Chr. entstanden sein.
’ Vgl. Eichler 1969,140f.; Vetters 1970, 118 ff.
4 s. Lageskizze: Bei K 1 ist die Entfernung der Fragmente von der Ostwand Richtung We-
sten im Grabungstagebuch leider nicht angegeben. Da sie sofort nach der Entdeckung
geborgen wurden, läßt sich ihre Position, d. h. ob sie nahe an der Mauer lagen oder et-
was entfernt von ihr, im nachhinein nicht mehr ermitteln. In der Lageskizze ist der Ab-
stand eingetragen, der sich ergibt, wenn man annimmt, daß V 2 (im Verband sicher lo-
kalisiert) und K 1 dieselbe Entfernung voneinander hatten wie K 2 und V 1 (60 cm).
5 Vorläufiger Restaurierungsbericht s. Dawid 1972-1975, 541ff. (s. Kat. S. 19 ff., Szenen
mit römischen Feldherren und Barbarengesandtschaften, bzw. großer Fries).
6 Elfenbein, das Dentin der Stoßzähne des Elefanten, setzt sich aus 55 % anorganischer
(Calciumphosphat, Magnesiumphosphat, Calciumcarbonat, Calciumfluorid) und 45 %
organischer Substanz (Collagen und Wasser) zusammen. Bei thermischer Einwirkung
auf Elfenbein treten charakteristische Farbeffekte auf. Zwischen 200°C-250°C ist
die Verfärbung gelblich bis bräunlich, von 300 °C an braun bis braunschwarz, gegen
600 °C tiefschwarz, von 650 °C an ein dunkles Blaugrau, um 760 °C ein helleres
Graublau, ab 800 °C ein reines Weiß. Je nach Ausmaß, Intensität und Dauer der
Hitzeeinwirkung schrumpft Elfenbein bis zu 10 % seines Volumens. Es können
auch Verformungen und Risse auftreten. Dazu: Baer u. a. 1971, 1 ff.; Newesely
o. L: Cristoferi 1992; Lafontaine - Wood 1982, 109ff.; O’Niel Espionza - Mann 1993,
241 ff.
13