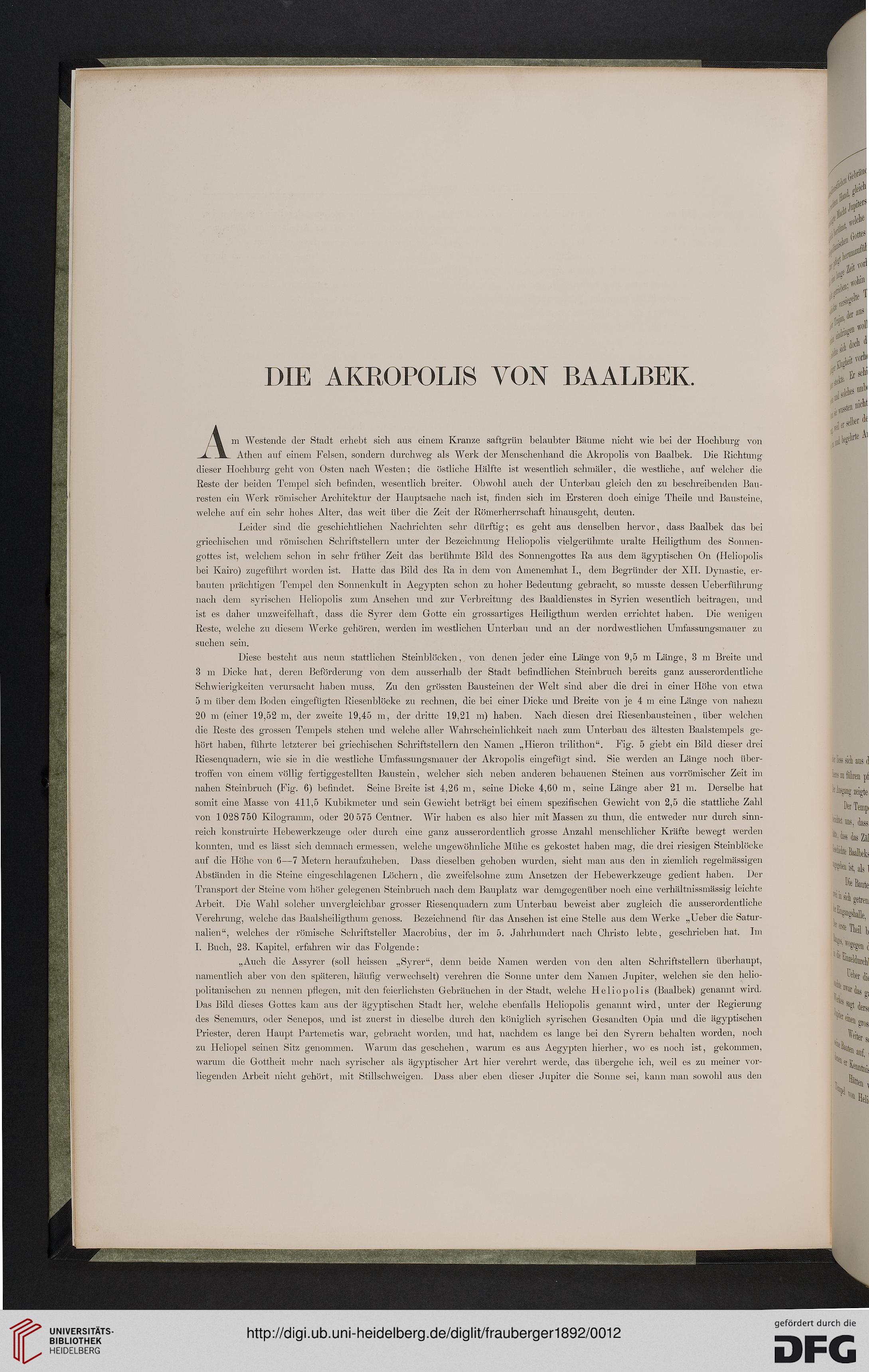DIE AKROPOLIS VON BAALBEK.
Am Westende der Stadt erhebt sich aus einem Kranze saftgrün belaubter Bäume nicht wie bei der Hochburg von
Athen auf einem Felsen, sondern durchweg als Werk der Menschenhand die Akropolis von Baalbek. Die Richtung
dieser Hochburg geht von Osten nach Westen; die östliche Hälfte ist wesentlich schmäler, die westliche, auf welcher die
Beste der beiden Tempel sich befinden, wesentlich breiter. Obwohl auch der Unterbau gleich den zu beschreibenden Bau-
resten ein Werk römischer Architektur der Hauptsache nach ist, finden sich im Ersteren doch einige Theile und Bausteine,
welche auf ein sehr hohes Alter, das weit über die Zeit der Römerherrschaft hinausgeht, deuten.
Leider sind die geschichtlichen Nachrichten sehr dürftig; es geht aus denselben hervor, dass Baalbek das bei
griechischen und römischen Schriftstellern unter der Bezeichnung Heliopolis vielgerühmte uralte Heiligthum des Sonnen-
gottes ist, welchem schon in sehr früher Zeit das berühmte Bild des Sonnengottes Ra aus dem ägyptischen On (Heliopolis
bei Kairo) zugeführt worden ist. Hatte das Bild des Ra in dem von Amenemhat I., dem Begründer der XII. Dynastie, er-
bauten prächtigen Tempel den Sonnenkult in Aegypten schon zu hoher Bedeutung gebracht, so musste dessen Ueberführung
nach dem syrischen Heliopolis zum Ansehen und zur Verbreitung des Baaldienstes in Syrien wesentlich beitragen, und
ist es daher unzweifelhaft, dass die Syrer dem Gotte ein grossartiges Heiligthum werden errichtet haben. Die wenigen
Reste, welche zu diesem Werke gehören, werden im westlichen Unterbau und an der nordwestlichen Umfassungsmauer zu
suchen sein.
Diese besteht aus neun stattlichen Steinblöcken, von denen jeder eine Länge von 9,5 m Länge, 3 m Breite und
3 m Dicke hat, deren Beförderung von dem ausserhalb der Stadt befindlichen Steinbruch bereits ganz ausserordentliche
Schwierigkeiten verursacht haben muss. Zu den grössten Bausteinen der Welt sind aber die drei in einer Höhe von etwa
5 in über dem Boden eingefügten Riesenblöcke zu rechnen, die bei einer Dicke und Breite von je 4 m eine Länge von nahezu
20 m (einer 19,52 m, der zweite 19,45 m, der dritte 19,21 m) haben. Nach diesen drei Riesenbausteinen, über welchen
die Reste des grossen Tempels stehen und welche aller Wahrscheinlichkeit nach zum Unterbau des ältesten Baalstempels ge-
hört haben, führte letzterer bei griechischen Schriftstellern den Namen „Hieron trilithon". Fig. 5 giebt ein Bild dieser drei
Riesenquadern, wie sie in die westliche Umfassungsmauer der Akropolis eingefügt sind. Sie werden an Länge noch über-
treffen von einem völlig fertiggestellten Baustein, welcher sich neben anderen behauenen Steinen aus vorrömischer Zeit im
nahen Steinbruch (Fig. 6) befindet. Seine Breite ist 4,2G m, seine Dicke 4,60 m, seine Länge aber 21 m. Derselbe hat
somit eine Masse von 411,5 Kubikmeter und sein Gewicht beträgt bei einem spezifischen Gewicht von 2,5 die stattliche Zahl
von 1028 750 Kilogramm, oder 20 575 Centner. Wir haben es also hier mit Massen zu thun, die entweder nur durch sinn-
reich konstruirte Hebewerkzeuge oder durch eine ganz ausserordentlich grosse Anzahl menschlicher Kräfte bewegt werden
konnten, und es lässt sich demnach ermessen, welche ungewöhnliche Mühe es gekostet haben mag, die drei riesigen Steinblöcke
auf die Höhe von 6—7 Metern heraufzuheben. Dass dieselben gehoben wurden, sieht man aus den in ziemlich regelmässigen
Abständen in die Steine eingeschlagenen Löchern, die zweifelsohne zum Ansetzen der Hebewerkzeuge gedient haben. Der
Transport der Steine vom höher gelegenen Steinbruch nach dem Bauplatz war demgegenüber noch eine verhältnissmässig' leichte
Arbeit. Die Wahl solcher unvergleichbar grosser Riesempiadern zum Unterbau beweist aber zugleich die ausserordentliche
Verehrung, welche das Baalsheiligthum genoss. Bezeichnend für das Ansehen ist eine Stelle aus dem Werke „Ueber die Satur-
nalien", welches der römische Schriftsteller Macrobius, der im 5. Jahrhundert nach Christo lebte, geschrieben hat. Im
I. Buch, 23. Kapitel, erfahren wir das Folgende:
„Auch die Assyrer (soll heissen „Syrer", denn beide Namen werden von den alten Schriftstellern überhaupt,
namentlich aber von den späteren, häufig verwechselt) verehren die Sonne unter dem Namen Jupiter, welchen sie den helio-
politanisehen zu nennen pflegen, mit den feierlichsten Gebräuchen in der Stadt, welche Heliopolis (Baalbek) genannt wird.
Das Bild dieses Gottes kam aus der ägyptischen Stadt her, welche ebenfalls Heliopolis genannt wird, unter der Regierung
des Senemurs, oder Senepos, und ist zuerst in dieselbe durch den königlich syrischen Gesandten Opia und die ägyptischen
Priester, deren Haupt Partemetis war, gebracht worden, und hat, nachdem es lange bei den Syrern behalten worden, noch
zu Heliopel seinen Sitz genommen. Warum das geschehen, warum es aus Aegypten hierher, wo es noch ist, gekommen,
warum die Gottheit mehr nach syrischer als ägyptischer Art hier verehrt werde, das übergehe ich, weil es zu meiner vor-
liegenden Arbeit nicht gehört, mit Stillschweigen. Dass aber eben dieser Jupiter die Sonne sei, kann man sowohl aus den
Am Westende der Stadt erhebt sich aus einem Kranze saftgrün belaubter Bäume nicht wie bei der Hochburg von
Athen auf einem Felsen, sondern durchweg als Werk der Menschenhand die Akropolis von Baalbek. Die Richtung
dieser Hochburg geht von Osten nach Westen; die östliche Hälfte ist wesentlich schmäler, die westliche, auf welcher die
Beste der beiden Tempel sich befinden, wesentlich breiter. Obwohl auch der Unterbau gleich den zu beschreibenden Bau-
resten ein Werk römischer Architektur der Hauptsache nach ist, finden sich im Ersteren doch einige Theile und Bausteine,
welche auf ein sehr hohes Alter, das weit über die Zeit der Römerherrschaft hinausgeht, deuten.
Leider sind die geschichtlichen Nachrichten sehr dürftig; es geht aus denselben hervor, dass Baalbek das bei
griechischen und römischen Schriftstellern unter der Bezeichnung Heliopolis vielgerühmte uralte Heiligthum des Sonnen-
gottes ist, welchem schon in sehr früher Zeit das berühmte Bild des Sonnengottes Ra aus dem ägyptischen On (Heliopolis
bei Kairo) zugeführt worden ist. Hatte das Bild des Ra in dem von Amenemhat I., dem Begründer der XII. Dynastie, er-
bauten prächtigen Tempel den Sonnenkult in Aegypten schon zu hoher Bedeutung gebracht, so musste dessen Ueberführung
nach dem syrischen Heliopolis zum Ansehen und zur Verbreitung des Baaldienstes in Syrien wesentlich beitragen, und
ist es daher unzweifelhaft, dass die Syrer dem Gotte ein grossartiges Heiligthum werden errichtet haben. Die wenigen
Reste, welche zu diesem Werke gehören, werden im westlichen Unterbau und an der nordwestlichen Umfassungsmauer zu
suchen sein.
Diese besteht aus neun stattlichen Steinblöcken, von denen jeder eine Länge von 9,5 m Länge, 3 m Breite und
3 m Dicke hat, deren Beförderung von dem ausserhalb der Stadt befindlichen Steinbruch bereits ganz ausserordentliche
Schwierigkeiten verursacht haben muss. Zu den grössten Bausteinen der Welt sind aber die drei in einer Höhe von etwa
5 in über dem Boden eingefügten Riesenblöcke zu rechnen, die bei einer Dicke und Breite von je 4 m eine Länge von nahezu
20 m (einer 19,52 m, der zweite 19,45 m, der dritte 19,21 m) haben. Nach diesen drei Riesenbausteinen, über welchen
die Reste des grossen Tempels stehen und welche aller Wahrscheinlichkeit nach zum Unterbau des ältesten Baalstempels ge-
hört haben, führte letzterer bei griechischen Schriftstellern den Namen „Hieron trilithon". Fig. 5 giebt ein Bild dieser drei
Riesenquadern, wie sie in die westliche Umfassungsmauer der Akropolis eingefügt sind. Sie werden an Länge noch über-
treffen von einem völlig fertiggestellten Baustein, welcher sich neben anderen behauenen Steinen aus vorrömischer Zeit im
nahen Steinbruch (Fig. 6) befindet. Seine Breite ist 4,2G m, seine Dicke 4,60 m, seine Länge aber 21 m. Derselbe hat
somit eine Masse von 411,5 Kubikmeter und sein Gewicht beträgt bei einem spezifischen Gewicht von 2,5 die stattliche Zahl
von 1028 750 Kilogramm, oder 20 575 Centner. Wir haben es also hier mit Massen zu thun, die entweder nur durch sinn-
reich konstruirte Hebewerkzeuge oder durch eine ganz ausserordentlich grosse Anzahl menschlicher Kräfte bewegt werden
konnten, und es lässt sich demnach ermessen, welche ungewöhnliche Mühe es gekostet haben mag, die drei riesigen Steinblöcke
auf die Höhe von 6—7 Metern heraufzuheben. Dass dieselben gehoben wurden, sieht man aus den in ziemlich regelmässigen
Abständen in die Steine eingeschlagenen Löchern, die zweifelsohne zum Ansetzen der Hebewerkzeuge gedient haben. Der
Transport der Steine vom höher gelegenen Steinbruch nach dem Bauplatz war demgegenüber noch eine verhältnissmässig' leichte
Arbeit. Die Wahl solcher unvergleichbar grosser Riesempiadern zum Unterbau beweist aber zugleich die ausserordentliche
Verehrung, welche das Baalsheiligthum genoss. Bezeichnend für das Ansehen ist eine Stelle aus dem Werke „Ueber die Satur-
nalien", welches der römische Schriftsteller Macrobius, der im 5. Jahrhundert nach Christo lebte, geschrieben hat. Im
I. Buch, 23. Kapitel, erfahren wir das Folgende:
„Auch die Assyrer (soll heissen „Syrer", denn beide Namen werden von den alten Schriftstellern überhaupt,
namentlich aber von den späteren, häufig verwechselt) verehren die Sonne unter dem Namen Jupiter, welchen sie den helio-
politanisehen zu nennen pflegen, mit den feierlichsten Gebräuchen in der Stadt, welche Heliopolis (Baalbek) genannt wird.
Das Bild dieses Gottes kam aus der ägyptischen Stadt her, welche ebenfalls Heliopolis genannt wird, unter der Regierung
des Senemurs, oder Senepos, und ist zuerst in dieselbe durch den königlich syrischen Gesandten Opia und die ägyptischen
Priester, deren Haupt Partemetis war, gebracht worden, und hat, nachdem es lange bei den Syrern behalten worden, noch
zu Heliopel seinen Sitz genommen. Warum das geschehen, warum es aus Aegypten hierher, wo es noch ist, gekommen,
warum die Gottheit mehr nach syrischer als ägyptischer Art hier verehrt werde, das übergehe ich, weil es zu meiner vor-
liegenden Arbeit nicht gehört, mit Stillschweigen. Dass aber eben dieser Jupiter die Sonne sei, kann man sowohl aus den