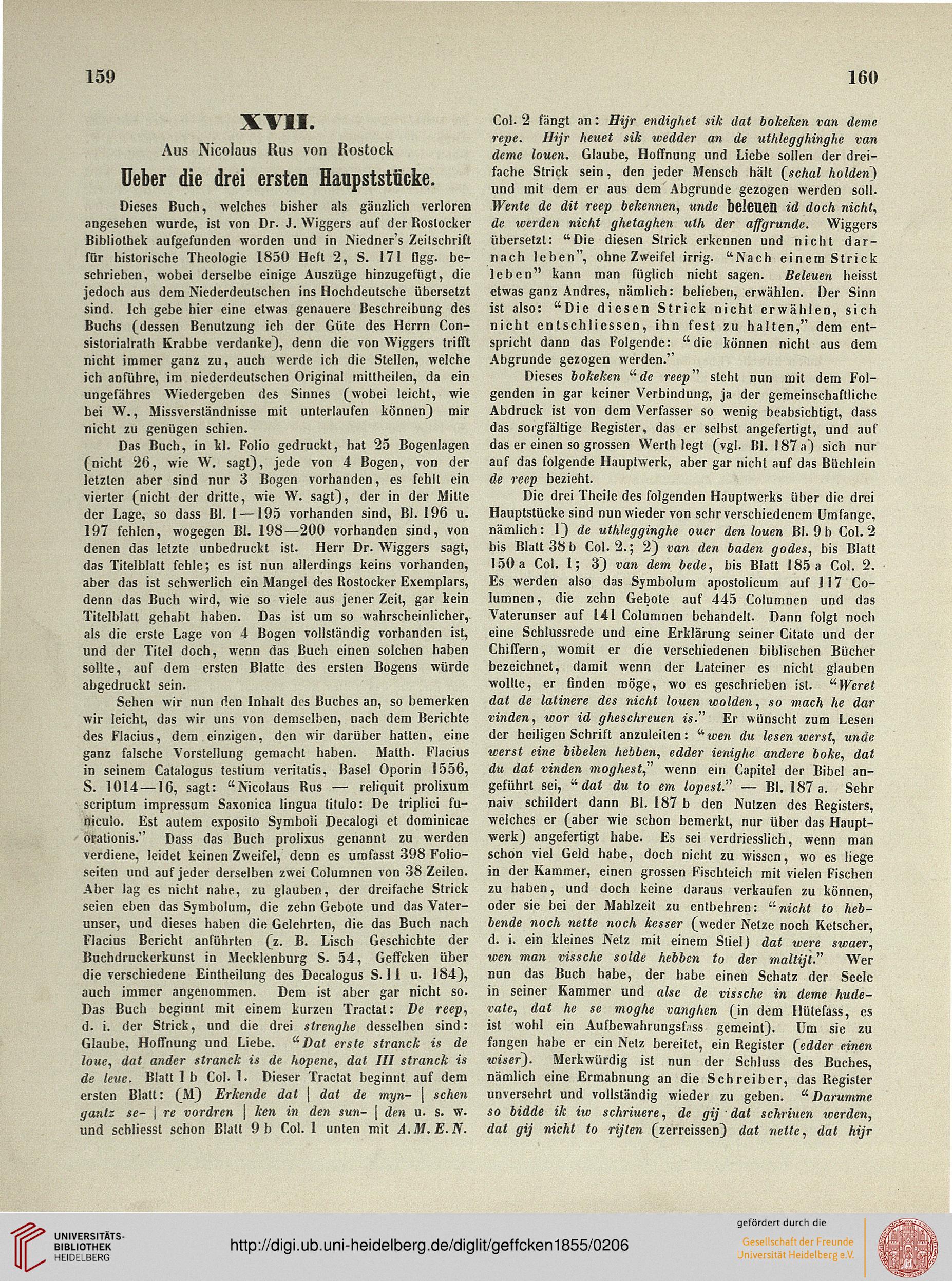159
160
XVII.
Aus Nicolaus Rus von Rostock
Ueber die drei ersten flaupststücke.
Dieses Buch, welches bisher als gänzlich verloren
angesehen wurde, ist von Dr. J. Wiggers auf der Roslocker
Bibliothek aufgefunden worden und in Niedner's Zeilschrift
für historische Theologie 1850 Heft 2, S. 171 flgg. be-
schrieben, wobei derselbe einige Auszüge hinzugefügt, die
jedoch aus dem Niederdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt
sind. Ich gebe hier eine etwas genauere Beschreibung des
Buchs (dessen Benutzung ich der Güte des Herrn Con-
sislorialrath Krabbe verdanke), denn die von Wiggers trifft
nicht immer ganz zu, auch werde ich die Stellen, welche
ich anrühre, im niederdeutschen Original inittheilen, da ein
ungefähres Wiedergeben des Sinnes (wobei leicht, wie
bei W., Missversländnisse mit unterlaufen können) mir
nicht zu genügen schien.
Das Buch, in kl. Folio gedruckt, hat 25 Bogenlagen
(nicht 26, wie W. sagt), jede von 4 Bogen, von der
letzten aber sind nur 3 Bogen vorhanden, es fehlt ein
vierter (nicht der dritte, wie W. sagt), der in der Mitte
der Lage, so dass Bl. I —195 vorhanden sind, Bl. 196 u.
197 fehlen, wogegen Bl. 198—200 vorhanden sind, von
denen das letzte unbedruckt ist. Herr Dr. Wiggers sagt,
das Titelblatt fehle; es ist nun allerdings keins vorhanden,
aber das ist schwerlich ein Mangel des Rostocker Exemplars,
denn das Buch wird, wie so viele aus jener Zeit, gar kein
Titelblatt gehabt haben. Das ist um so wahrscheinlicher,,
als die erste Lage von 4 Bogen vollständig vorhanden ist,
und der Titel doch, wenn das Buch einen solchen haben
sollte, auf dem ersten Blatte des ersten Bogens würde
abgedruckt sein.
Sehen wir nun den Inhalt des Buches an, so bemerken
wir leicht, das wir uns von demselben, nach dem Berichte
des Flacius, dem einzigen, den wir darüber hatten, eine
ganz falsche Vorstellung gemacht haben. Matth. Flacius
in seinem Catalogus testium veritatis, Basel Oporin 1556,
S. 1014 —16, sagt: "Nicolaus Rus — reliquit prolixum
scriptum impressum Saxonica lingua titulo: De triplici fu-
niculo. Est aulem exposito Symboli Decalogi et dominicae
örationis." Dass das Buch prolixus genannt zu werden
verdiene, leidet keinen Zweifel, denn es umfasst 398 Folio-
seiten und auf jeder derselben zwei Columnen von 38 Zeilen.
Aber lag es nicht nahe, zu glauben, der dreifache Strick
seien eben das Symbolum, die zehn Gebote und das Vater-
unser, und dieses haben die Gelehrten, die das Buch nach
Flacius Bericht anführten (z. B. Lisch Geschichte der
Bucbdruckerkunst in Mecklenburg S. 54, Geffcken über
die verschiedene Eintheilung des Decalogus S. 11 u. 184),
auch immer angenommen. Dem ist aber gar nicht so.
Das Buch beginnt mit einem kurzen Tractat: De reep,
d. i. der Strick, und die drei strenghe desselben sind:
Glaube, Hoffnung und Liebe. aDat erste stranck is de
loue, dat ander stranck is de hopene, dat III stranck is
de leite. Blatt 1 b Col. 1. Dieser Tractat beginnt auf dem
ersten Blatt: (M) Erkende dat \ dat de myn- \ sehen
gantz se- | re vordren \ ken in den sun- [ den u. s. w.
und schliesst schon Blatt 9 b Col. 1 unten mit A.M.E.N.
Col. 2 fängt an: Hijr endighet sik dat bokeken van deme
repe. Hijr heuet sik wedder an de uthlegghinghe van
deme louen. Glaube, Hoffnung und Liebe sollen der drei-
fache Strick sein, den jeder Mensch hält (schal holden)
und mit dem er aus dem Abgrunde gezogen werden soll.
Wente de dit reep bekamen, unde beleU8H id doch nicht,
de werden nicht ghetaghen uth der affgrunde. Wiggers
übersetzt: "Die diesen Strick erkennen und nicht dar-
nach leben", ohne Zweifel irrig. "Nach einem Strick
leben" kann man füglich nicht sagen. Beleuen heisst
etwas ganz Andres, nämlich: belieben, erwählen. Der Sinn
ist also: "Die diesen Strick nicht erwählen, sich
nicht entschliessen, ihn fest zu halten," dem ent-
spricht dann das Folgende: "die können nicht aus dem
Abgrunde gezogen werden."
Dieses bokeken "de reep" steht nun mit dem Fol-
genden in gar keiner Verbindung, ja der gemeinschaftliche
Abdruck ist von dem Verfasser so wenig beabsichtigt, dass
das sorgfältige Register, das er selbst angefertigt, und auf
das er einen so grossen Werth legt (vgl. Bl. 187 a) sich nur
auf das folgende Hauptwerk, aber gar nicht auf das Büchlein
de reep bezieht.
Die drei Thcile des folgenden Hauptwerks über die drei
Hauptstücke sind nun wieder von sehr verschiedenem Umfange,
nämlich: 1) de uthlegginghe ouer den Ionen Bl. 9 h Col. 2
bis Blatt 38 b Col. 2.; 2) van den baden godes, bis Blatt
150 a Col. 1; 3) van dem bede, bis Blatt 185 a Col. 2.
Es werden also das Symbolum apostolicum auf 117 Co-
lumnen , die zehn Gebote auf 445 Columnen und das
Vaterunser auf 141 Columnen behandelt. Dann folgt noch
eine Schlussrede und eine Erklärung seiner Citate und der
Chiffern, womit er die verschiedenen biblischen Bücher
bezeichnet, damit wenn der Lateiner es nicht glauben
wollte, er finden möge, wo es geschrieben ist. aWeret
dat de latinere des nicht louen wolden, so mach he dar
vinden, war id gheschreuen is." Er wünscht zum Lesen
der heiligen Schrift anzuleiten: " wen du lesen werst, unde
werst eine bibelen hebben, edder ienighe andere boke, dat
du dat vinden moghest," wenn ein Capitel der Bibel an-
geführt sei, "-dat du to em lopest." — Bl. 187a. Sehr
naiv schildert dann Bl. 187 b den Nutzen des Registers,
welches er (aber wie schon bemerkt, nur über das Haupt-
werk) angefertigt habe. Es sei verdriesslich, wenn man
schon viel Geld habe, doch nicht zu wissen, wo es liege
in der Kammer, einen grossen Fischteich mit vielen Fischen
zu haben, und doch keine daraus verkaufen zu können,
oder sie bei der Mahlzeit zu entbehren: "nicht to heb-
bende noch nette noch kesser (weder Netze noch Ketscher,
d. i. ein kleines Netz mit einem Stiel J dat were swaer,
wen man vissche solde hebben to der maltijt." Wer
nun das Buch habe, der habe einen Schatz der Seele
in seiner Kammer und alse de vissche in deme hude-
vate, dat he se moghe vanghen (in dem Hütefass, es
ist wohl ein Aufbewahrungsfass gemeint). Um sie zu
fangen habe er ein Netz bereitet, ein Register (edder einen
wisef). Merkwürdig ist nun der Schluss des Buches,
nämlich eine Ermahnung an die Schreiber, das Register
unversehrt und vollständig wieder zu geben. " Darumme
so bidde ik iw schriuere, de gij ■ dat schriuen werden,
dat gij nicht to rijlen (zerreissen) dat nette, dat hijr
160
XVII.
Aus Nicolaus Rus von Rostock
Ueber die drei ersten flaupststücke.
Dieses Buch, welches bisher als gänzlich verloren
angesehen wurde, ist von Dr. J. Wiggers auf der Roslocker
Bibliothek aufgefunden worden und in Niedner's Zeilschrift
für historische Theologie 1850 Heft 2, S. 171 flgg. be-
schrieben, wobei derselbe einige Auszüge hinzugefügt, die
jedoch aus dem Niederdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt
sind. Ich gebe hier eine etwas genauere Beschreibung des
Buchs (dessen Benutzung ich der Güte des Herrn Con-
sislorialrath Krabbe verdanke), denn die von Wiggers trifft
nicht immer ganz zu, auch werde ich die Stellen, welche
ich anrühre, im niederdeutschen Original inittheilen, da ein
ungefähres Wiedergeben des Sinnes (wobei leicht, wie
bei W., Missversländnisse mit unterlaufen können) mir
nicht zu genügen schien.
Das Buch, in kl. Folio gedruckt, hat 25 Bogenlagen
(nicht 26, wie W. sagt), jede von 4 Bogen, von der
letzten aber sind nur 3 Bogen vorhanden, es fehlt ein
vierter (nicht der dritte, wie W. sagt), der in der Mitte
der Lage, so dass Bl. I —195 vorhanden sind, Bl. 196 u.
197 fehlen, wogegen Bl. 198—200 vorhanden sind, von
denen das letzte unbedruckt ist. Herr Dr. Wiggers sagt,
das Titelblatt fehle; es ist nun allerdings keins vorhanden,
aber das ist schwerlich ein Mangel des Rostocker Exemplars,
denn das Buch wird, wie so viele aus jener Zeit, gar kein
Titelblatt gehabt haben. Das ist um so wahrscheinlicher,,
als die erste Lage von 4 Bogen vollständig vorhanden ist,
und der Titel doch, wenn das Buch einen solchen haben
sollte, auf dem ersten Blatte des ersten Bogens würde
abgedruckt sein.
Sehen wir nun den Inhalt des Buches an, so bemerken
wir leicht, das wir uns von demselben, nach dem Berichte
des Flacius, dem einzigen, den wir darüber hatten, eine
ganz falsche Vorstellung gemacht haben. Matth. Flacius
in seinem Catalogus testium veritatis, Basel Oporin 1556,
S. 1014 —16, sagt: "Nicolaus Rus — reliquit prolixum
scriptum impressum Saxonica lingua titulo: De triplici fu-
niculo. Est aulem exposito Symboli Decalogi et dominicae
örationis." Dass das Buch prolixus genannt zu werden
verdiene, leidet keinen Zweifel, denn es umfasst 398 Folio-
seiten und auf jeder derselben zwei Columnen von 38 Zeilen.
Aber lag es nicht nahe, zu glauben, der dreifache Strick
seien eben das Symbolum, die zehn Gebote und das Vater-
unser, und dieses haben die Gelehrten, die das Buch nach
Flacius Bericht anführten (z. B. Lisch Geschichte der
Bucbdruckerkunst in Mecklenburg S. 54, Geffcken über
die verschiedene Eintheilung des Decalogus S. 11 u. 184),
auch immer angenommen. Dem ist aber gar nicht so.
Das Buch beginnt mit einem kurzen Tractat: De reep,
d. i. der Strick, und die drei strenghe desselben sind:
Glaube, Hoffnung und Liebe. aDat erste stranck is de
loue, dat ander stranck is de hopene, dat III stranck is
de leite. Blatt 1 b Col. 1. Dieser Tractat beginnt auf dem
ersten Blatt: (M) Erkende dat \ dat de myn- \ sehen
gantz se- | re vordren \ ken in den sun- [ den u. s. w.
und schliesst schon Blatt 9 b Col. 1 unten mit A.M.E.N.
Col. 2 fängt an: Hijr endighet sik dat bokeken van deme
repe. Hijr heuet sik wedder an de uthlegghinghe van
deme louen. Glaube, Hoffnung und Liebe sollen der drei-
fache Strick sein, den jeder Mensch hält (schal holden)
und mit dem er aus dem Abgrunde gezogen werden soll.
Wente de dit reep bekamen, unde beleU8H id doch nicht,
de werden nicht ghetaghen uth der affgrunde. Wiggers
übersetzt: "Die diesen Strick erkennen und nicht dar-
nach leben", ohne Zweifel irrig. "Nach einem Strick
leben" kann man füglich nicht sagen. Beleuen heisst
etwas ganz Andres, nämlich: belieben, erwählen. Der Sinn
ist also: "Die diesen Strick nicht erwählen, sich
nicht entschliessen, ihn fest zu halten," dem ent-
spricht dann das Folgende: "die können nicht aus dem
Abgrunde gezogen werden."
Dieses bokeken "de reep" steht nun mit dem Fol-
genden in gar keiner Verbindung, ja der gemeinschaftliche
Abdruck ist von dem Verfasser so wenig beabsichtigt, dass
das sorgfältige Register, das er selbst angefertigt, und auf
das er einen so grossen Werth legt (vgl. Bl. 187 a) sich nur
auf das folgende Hauptwerk, aber gar nicht auf das Büchlein
de reep bezieht.
Die drei Thcile des folgenden Hauptwerks über die drei
Hauptstücke sind nun wieder von sehr verschiedenem Umfange,
nämlich: 1) de uthlegginghe ouer den Ionen Bl. 9 h Col. 2
bis Blatt 38 b Col. 2.; 2) van den baden godes, bis Blatt
150 a Col. 1; 3) van dem bede, bis Blatt 185 a Col. 2.
Es werden also das Symbolum apostolicum auf 117 Co-
lumnen , die zehn Gebote auf 445 Columnen und das
Vaterunser auf 141 Columnen behandelt. Dann folgt noch
eine Schlussrede und eine Erklärung seiner Citate und der
Chiffern, womit er die verschiedenen biblischen Bücher
bezeichnet, damit wenn der Lateiner es nicht glauben
wollte, er finden möge, wo es geschrieben ist. aWeret
dat de latinere des nicht louen wolden, so mach he dar
vinden, war id gheschreuen is." Er wünscht zum Lesen
der heiligen Schrift anzuleiten: " wen du lesen werst, unde
werst eine bibelen hebben, edder ienighe andere boke, dat
du dat vinden moghest," wenn ein Capitel der Bibel an-
geführt sei, "-dat du to em lopest." — Bl. 187a. Sehr
naiv schildert dann Bl. 187 b den Nutzen des Registers,
welches er (aber wie schon bemerkt, nur über das Haupt-
werk) angefertigt habe. Es sei verdriesslich, wenn man
schon viel Geld habe, doch nicht zu wissen, wo es liege
in der Kammer, einen grossen Fischteich mit vielen Fischen
zu haben, und doch keine daraus verkaufen zu können,
oder sie bei der Mahlzeit zu entbehren: "nicht to heb-
bende noch nette noch kesser (weder Netze noch Ketscher,
d. i. ein kleines Netz mit einem Stiel J dat were swaer,
wen man vissche solde hebben to der maltijt." Wer
nun das Buch habe, der habe einen Schatz der Seele
in seiner Kammer und alse de vissche in deme hude-
vate, dat he se moghe vanghen (in dem Hütefass, es
ist wohl ein Aufbewahrungsfass gemeint). Um sie zu
fangen habe er ein Netz bereitet, ein Register (edder einen
wisef). Merkwürdig ist nun der Schluss des Buches,
nämlich eine Ermahnung an die Schreiber, das Register
unversehrt und vollständig wieder zu geben. " Darumme
so bidde ik iw schriuere, de gij ■ dat schriuen werden,
dat gij nicht to rijlen (zerreissen) dat nette, dat hijr