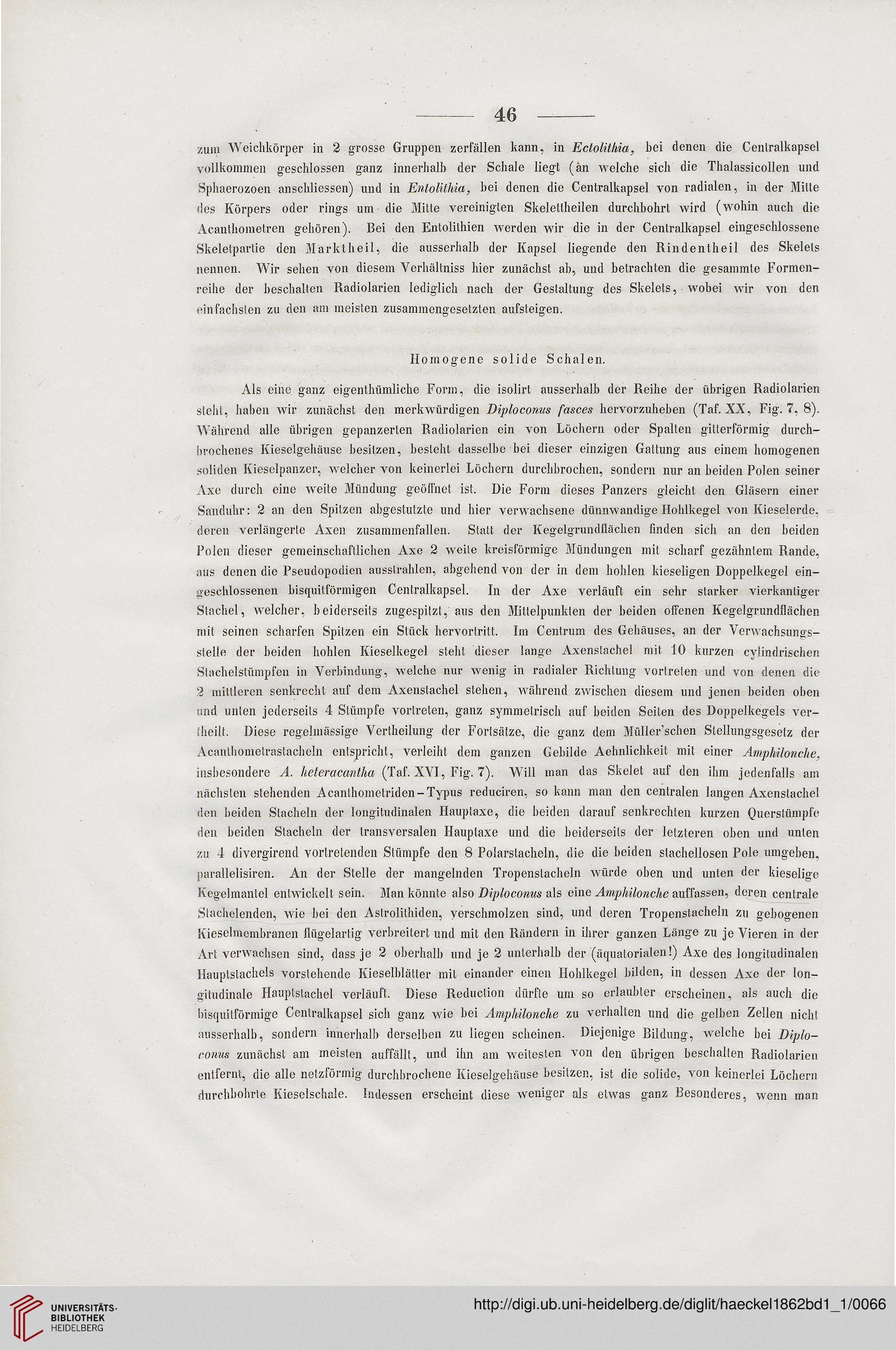46
zum Weichkörper in 2 grosse Gruppen zerfallen kann, in Ectolithia, bei denen die Cenlralkapsel
vollkommen geschlossen ganz innerhalb der Schale liegt (an welche sich die Thalassicollen und
Sphaerozoen anschliessen) und in Entolithia, bei denen die Centralkapsel von radialen, in der Mitte
des Körpers oder rings um die Mitte vereinigten Skelettheilen durchbohrt wird (wohin auch die
Acanthometren gehören). Bei den Entolithien werden wir die in der Centralkapsel eingeschlossene
Skeletpartie den Marktheil, die ausserhalb der Kapsel liegende den Rindentheil des Skelets
nennen. Wir sehen von diesem Verhältniss hier zunächst ab, und betrachten die gesammte Formen-
reihe der beschälten Radiolarien lediglich nach der Gestaltung des Skelets, wobei wir von den
einfachsten zu den am meisten zusammengesetzten aufsteigen.
Homogene solide Schalen.
Als eine ganz eigentlnimliche Form, die isolirt ausserhalb der Reihe der übrigen Radiolarien
steht, haben wir zunächst den merkwürdigen Diploconus fasces hervorzulieben (Taf. XX, Fig. 7, 8).
Während alle übrigen gepanzerten Radiolarien ein von Löchern oder Spalten gitterförmig durch-
brochenes Kieselgehäuse besitzen, besteht dasselbe bei dieser einzigen Gattung aus einem homogenen
soliden Kieselpanzer, welcher von keinerlei Löchern durchbrochen, sondern nur an beiden Polen seiner
Axe durch eine weite Mündung geöffnet ist. Die Form dieses Panzers gleicht den Gläsern einer
Sanduhr: 2 an den Spitzen abgestutzte und hier verwachsene dünnwandige Hohlkegel von Kieselerde,
deren verlängerte Axen zusammenfallen. Statt der Kegelgrundflächen finden sich an den beiden
Polen dieser gemeinschaftlichen Axe 2 weile kreisförmige Mündungen mit scharf gezähntem Rande,
aus denen die Pseudopodien ausstrahlen, abgehend von der in dem hohlen kieseligen Doppelkegel ein-
geschlossenen bisquitförmigen Cenlralkapsel. In der Axe verläuft ein sehr starker vierkantiger
Stachel, welcher, beiderseits zugespitzt, aus den Mittelpunkten der beiden offenen Kegelgrundflächen
mit seinen scharfen Spitzen ein Stück hervortritt. Im Centrum des Gehäuses, an der Verwachsungs-
stelle der beiden hohlen Kieselkegel steht dieser lange Axenstachel mit 10 kurzen cylindrischen
Stachelstümpfen in Verbindung, welche nur wenig in radialer Richtung vortreten und von denen die
2 mittleren senkrecht auf dem Axenstachel stehen, während zwischen diesem und jenen beiden oben
und unten jederseits 4 Stümpfe vortreten, ganz symmetrisch auf beiden Seiten des Doppelkegels ver-
theilt. Diese regelmässige Vertheilung der Fortsätze, die ganz dem Müller’schen Stellungsgesetz der
Acanthometrastacheln entspricht, verleiht dem ganzen Gebilde Aehnlichkeit mit einer Amphilonche,
insbesondere A. heteracantha (Taf. XVI, Fig. 7). Will man das Skelet auf den ihm jedenfalls am
nächsten stehenden Acanlhometriden-Typus reduciren, so kann man den centralen langen Axenstachel
den beiden Stacheln der longitudinalen Hauptaxe, die beiden darauf senkrechten kurzen Querstümpfe
den beiden Stacheln der transversalen Hauptaxe und die beiderseits der letzteren oben und unten
zu 4 divergirend vortretenden Stümpfe den 8 Polarstacheln, die die beiden stachellosen Pole umgeben,
parallelisiren. An der Stelle der mangelnden Tropenslacheln würde oben und unten der kieselige
Kegelmantel entwickelt sein. Man könnte also Diploconus als eine Amphilonche auffassen, deren centrale
Stachelenden, wie bei den Astrolithiden, verschmolzen sind, und deren Tropenstacheln zu gebogenen
Kieselmembranen flügelartig verbreitert und mit den Rändern in ihrer ganzen Länge zu je Vieren in der
Art verwachsen sind, dass je 2 oberhalb und je 2 unterhalb der (äquatorialen!) Axe des longitudinalen
Hauptstachels vorstehende Kieselblätter mit einander einen Hohlkegel bilden, in dessen Axe der lon-
gitudinale Hauptstachel verläuft. Diese Reduction dürfte um so erlaubter erscheinen, als auch die
bisquitförmige Centralkapsel sich ganz wie bei Amphilonche zu verhalten und die gelben Zellen nicht
ausserhalb, sondern innerhalb derselben zu liegen scheinen. Diejenige Bildung, welche bei Diplo-
conus zunächst am meisten auffällt, und ihn am weitesten von den übrigen beschälten Radiolarien
entfernt, die alle netzförmig durchbrochene Kieselgehäuse besitzen, ist die solide, von keinerlei Löchern
durchbohrte Kieselschale. Indessen erscheint diese weniger als etwas ganz Besonderes, wenn man
zum Weichkörper in 2 grosse Gruppen zerfallen kann, in Ectolithia, bei denen die Cenlralkapsel
vollkommen geschlossen ganz innerhalb der Schale liegt (an welche sich die Thalassicollen und
Sphaerozoen anschliessen) und in Entolithia, bei denen die Centralkapsel von radialen, in der Mitte
des Körpers oder rings um die Mitte vereinigten Skelettheilen durchbohrt wird (wohin auch die
Acanthometren gehören). Bei den Entolithien werden wir die in der Centralkapsel eingeschlossene
Skeletpartie den Marktheil, die ausserhalb der Kapsel liegende den Rindentheil des Skelets
nennen. Wir sehen von diesem Verhältniss hier zunächst ab, und betrachten die gesammte Formen-
reihe der beschälten Radiolarien lediglich nach der Gestaltung des Skelets, wobei wir von den
einfachsten zu den am meisten zusammengesetzten aufsteigen.
Homogene solide Schalen.
Als eine ganz eigentlnimliche Form, die isolirt ausserhalb der Reihe der übrigen Radiolarien
steht, haben wir zunächst den merkwürdigen Diploconus fasces hervorzulieben (Taf. XX, Fig. 7, 8).
Während alle übrigen gepanzerten Radiolarien ein von Löchern oder Spalten gitterförmig durch-
brochenes Kieselgehäuse besitzen, besteht dasselbe bei dieser einzigen Gattung aus einem homogenen
soliden Kieselpanzer, welcher von keinerlei Löchern durchbrochen, sondern nur an beiden Polen seiner
Axe durch eine weite Mündung geöffnet ist. Die Form dieses Panzers gleicht den Gläsern einer
Sanduhr: 2 an den Spitzen abgestutzte und hier verwachsene dünnwandige Hohlkegel von Kieselerde,
deren verlängerte Axen zusammenfallen. Statt der Kegelgrundflächen finden sich an den beiden
Polen dieser gemeinschaftlichen Axe 2 weile kreisförmige Mündungen mit scharf gezähntem Rande,
aus denen die Pseudopodien ausstrahlen, abgehend von der in dem hohlen kieseligen Doppelkegel ein-
geschlossenen bisquitförmigen Cenlralkapsel. In der Axe verläuft ein sehr starker vierkantiger
Stachel, welcher, beiderseits zugespitzt, aus den Mittelpunkten der beiden offenen Kegelgrundflächen
mit seinen scharfen Spitzen ein Stück hervortritt. Im Centrum des Gehäuses, an der Verwachsungs-
stelle der beiden hohlen Kieselkegel steht dieser lange Axenstachel mit 10 kurzen cylindrischen
Stachelstümpfen in Verbindung, welche nur wenig in radialer Richtung vortreten und von denen die
2 mittleren senkrecht auf dem Axenstachel stehen, während zwischen diesem und jenen beiden oben
und unten jederseits 4 Stümpfe vortreten, ganz symmetrisch auf beiden Seiten des Doppelkegels ver-
theilt. Diese regelmässige Vertheilung der Fortsätze, die ganz dem Müller’schen Stellungsgesetz der
Acanthometrastacheln entspricht, verleiht dem ganzen Gebilde Aehnlichkeit mit einer Amphilonche,
insbesondere A. heteracantha (Taf. XVI, Fig. 7). Will man das Skelet auf den ihm jedenfalls am
nächsten stehenden Acanlhometriden-Typus reduciren, so kann man den centralen langen Axenstachel
den beiden Stacheln der longitudinalen Hauptaxe, die beiden darauf senkrechten kurzen Querstümpfe
den beiden Stacheln der transversalen Hauptaxe und die beiderseits der letzteren oben und unten
zu 4 divergirend vortretenden Stümpfe den 8 Polarstacheln, die die beiden stachellosen Pole umgeben,
parallelisiren. An der Stelle der mangelnden Tropenslacheln würde oben und unten der kieselige
Kegelmantel entwickelt sein. Man könnte also Diploconus als eine Amphilonche auffassen, deren centrale
Stachelenden, wie bei den Astrolithiden, verschmolzen sind, und deren Tropenstacheln zu gebogenen
Kieselmembranen flügelartig verbreitert und mit den Rändern in ihrer ganzen Länge zu je Vieren in der
Art verwachsen sind, dass je 2 oberhalb und je 2 unterhalb der (äquatorialen!) Axe des longitudinalen
Hauptstachels vorstehende Kieselblätter mit einander einen Hohlkegel bilden, in dessen Axe der lon-
gitudinale Hauptstachel verläuft. Diese Reduction dürfte um so erlaubter erscheinen, als auch die
bisquitförmige Centralkapsel sich ganz wie bei Amphilonche zu verhalten und die gelben Zellen nicht
ausserhalb, sondern innerhalb derselben zu liegen scheinen. Diejenige Bildung, welche bei Diplo-
conus zunächst am meisten auffällt, und ihn am weitesten von den übrigen beschälten Radiolarien
entfernt, die alle netzförmig durchbrochene Kieselgehäuse besitzen, ist die solide, von keinerlei Löchern
durchbohrte Kieselschale. Indessen erscheint diese weniger als etwas ganz Besonderes, wenn man