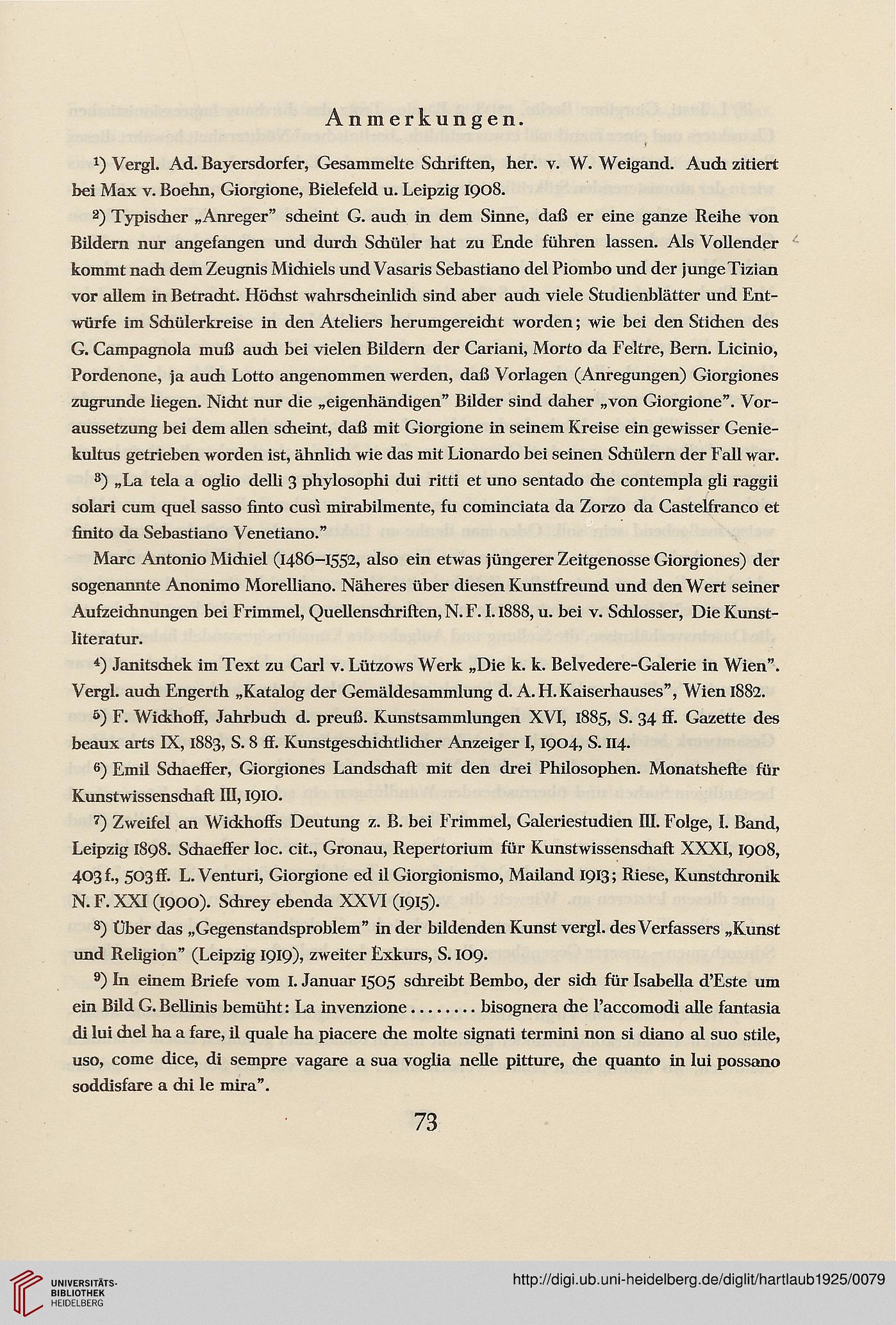Anmerkungen.
J) Vergl. Ad. Bayersdorfer, Gesammelte Schriften, her. v. W. Weigand. Auch zitiert
bei Max v. Boehn, Giorgione, Bielefeld u. Leipzig 1908.
2) Typischer „Anreger" scheint G. auch in dem Sinne, daß er eine ganze Reihe von
Bildern nur angefangen und durch Schüler hat zu Ende führen lassen. Als Vollender
kommt nach dem Zeugnis Middels und Vasaris Sebastiano del Piombo und der junge Tizian
vor allem in Betracht. Höchst wahrscheinlich sind aber auch viele Studienblätter und Ent-
würfe im Schülerkreise in den Ateliers herumgereicht worden; wie bei den Stichen des
G. Campagnola muß auch bei vielen Bildern der Cariani, Morto da Feltre, Bern. Licinio,
Pordenone, ja auch Lotto angenommen werden, daß Vorlagen (Anregungen) Giorgiones
zugrunde liegen. Nicht nur die „eigenhändigen" Bilder sind daher „von Giorgione". Vor-
aussetzung bei dem allen scheint, daß mit Giorgione in seinem Kreise ein gewisser Genie-
kultus getrieben worden ist, ähnlich wie das mit Lionardo bei seinen Schülern der Fall war.
8) „La tela a oglio delli 3 phylosophi dui ritti et uno sentado che contempla gli raggii
solari cum quel sasso finto cusi mirabilmente, fu cominciata da Zorzo da Castelfranco et
finito da Sebastiano Venetiano."
Marc Antonio Michiel (1486-1552, also ein etwas jüngerer Zeitgenosse Giorgiones) der
sogenannte Anonimo Morelliano. Näheres über diesen Kunstfreund und den Wert seiner
Aufzeichnungen bei Frimmel, Quellenschriften, N. F. 1.1888, u. bei v. Schlosser, Die Kunst-
literatur.
4) Janitschek im Text zu Carl v. Lützows Werk „Die k. k. Belvedere-Galerie in Wien".
Vergl. auch Engerth „Katalog der Gemäldesammlung d. A.H.Kaiserhauses", Wien I882.
5) F. Wickhoff, Jahrbuch d. preuß. Kunstsammlungen XVI, 1885, S. 34 ff. Gazette des
beaux arts IX, 1883, S. 8 ff. Kunstgeschichtlicher Anzeiger I, 1904, S. 114.
6) Emil Schaeffer, Giorgiones Landschaft mit den drei Philosophen. Monatshefte für
Kunstwissenschaft III, 1910.
7) Zweifel an Wickhoffs Deutung z. B. bei Frimmel, Galeriestudien III. Folge, I. Band,
Leipzig 1898. Schaeffer loc. cit., Gronau, Repertorium für Kunstwissenschaft XXXI, 1908,
403 f., 503 ff. L.Venturi, Giorgione ed il Giorgionismo, Mailand 1913; Riese, Kunstchronik
N. F. XXI (1900). Schrey ebenda XXVI (1915).
8) Über das „Gegenstandsproblem" in der bildenden Kunst vergl. des Verfassers „Kunst
und Religion" (Leipzig 1919), zweiter Exkurs, S. 109.
9) In einem Briefe vom I. Januar 1505 schreibt Bembo, der sich für Isabella d'Este um
ein Bild G. Bellinis bemüht: La invenzione........bisognera che l'accomodi alle fantasia
di lui diel ha a fare, il quäle ha piacere che molte signati termini non si diano al suo stile,
uso, come dice, di sempre vagare a sua voglia nelle pitture, che quanto in lui possano
soddisfare a chi le mira".
73
J) Vergl. Ad. Bayersdorfer, Gesammelte Schriften, her. v. W. Weigand. Auch zitiert
bei Max v. Boehn, Giorgione, Bielefeld u. Leipzig 1908.
2) Typischer „Anreger" scheint G. auch in dem Sinne, daß er eine ganze Reihe von
Bildern nur angefangen und durch Schüler hat zu Ende führen lassen. Als Vollender
kommt nach dem Zeugnis Middels und Vasaris Sebastiano del Piombo und der junge Tizian
vor allem in Betracht. Höchst wahrscheinlich sind aber auch viele Studienblätter und Ent-
würfe im Schülerkreise in den Ateliers herumgereicht worden; wie bei den Stichen des
G. Campagnola muß auch bei vielen Bildern der Cariani, Morto da Feltre, Bern. Licinio,
Pordenone, ja auch Lotto angenommen werden, daß Vorlagen (Anregungen) Giorgiones
zugrunde liegen. Nicht nur die „eigenhändigen" Bilder sind daher „von Giorgione". Vor-
aussetzung bei dem allen scheint, daß mit Giorgione in seinem Kreise ein gewisser Genie-
kultus getrieben worden ist, ähnlich wie das mit Lionardo bei seinen Schülern der Fall war.
8) „La tela a oglio delli 3 phylosophi dui ritti et uno sentado che contempla gli raggii
solari cum quel sasso finto cusi mirabilmente, fu cominciata da Zorzo da Castelfranco et
finito da Sebastiano Venetiano."
Marc Antonio Michiel (1486-1552, also ein etwas jüngerer Zeitgenosse Giorgiones) der
sogenannte Anonimo Morelliano. Näheres über diesen Kunstfreund und den Wert seiner
Aufzeichnungen bei Frimmel, Quellenschriften, N. F. 1.1888, u. bei v. Schlosser, Die Kunst-
literatur.
4) Janitschek im Text zu Carl v. Lützows Werk „Die k. k. Belvedere-Galerie in Wien".
Vergl. auch Engerth „Katalog der Gemäldesammlung d. A.H.Kaiserhauses", Wien I882.
5) F. Wickhoff, Jahrbuch d. preuß. Kunstsammlungen XVI, 1885, S. 34 ff. Gazette des
beaux arts IX, 1883, S. 8 ff. Kunstgeschichtlicher Anzeiger I, 1904, S. 114.
6) Emil Schaeffer, Giorgiones Landschaft mit den drei Philosophen. Monatshefte für
Kunstwissenschaft III, 1910.
7) Zweifel an Wickhoffs Deutung z. B. bei Frimmel, Galeriestudien III. Folge, I. Band,
Leipzig 1898. Schaeffer loc. cit., Gronau, Repertorium für Kunstwissenschaft XXXI, 1908,
403 f., 503 ff. L.Venturi, Giorgione ed il Giorgionismo, Mailand 1913; Riese, Kunstchronik
N. F. XXI (1900). Schrey ebenda XXVI (1915).
8) Über das „Gegenstandsproblem" in der bildenden Kunst vergl. des Verfassers „Kunst
und Religion" (Leipzig 1919), zweiter Exkurs, S. 109.
9) In einem Briefe vom I. Januar 1505 schreibt Bembo, der sich für Isabella d'Este um
ein Bild G. Bellinis bemüht: La invenzione........bisognera che l'accomodi alle fantasia
di lui diel ha a fare, il quäle ha piacere che molte signati termini non si diano al suo stile,
uso, come dice, di sempre vagare a sua voglia nelle pitture, che quanto in lui possano
soddisfare a chi le mira".
73