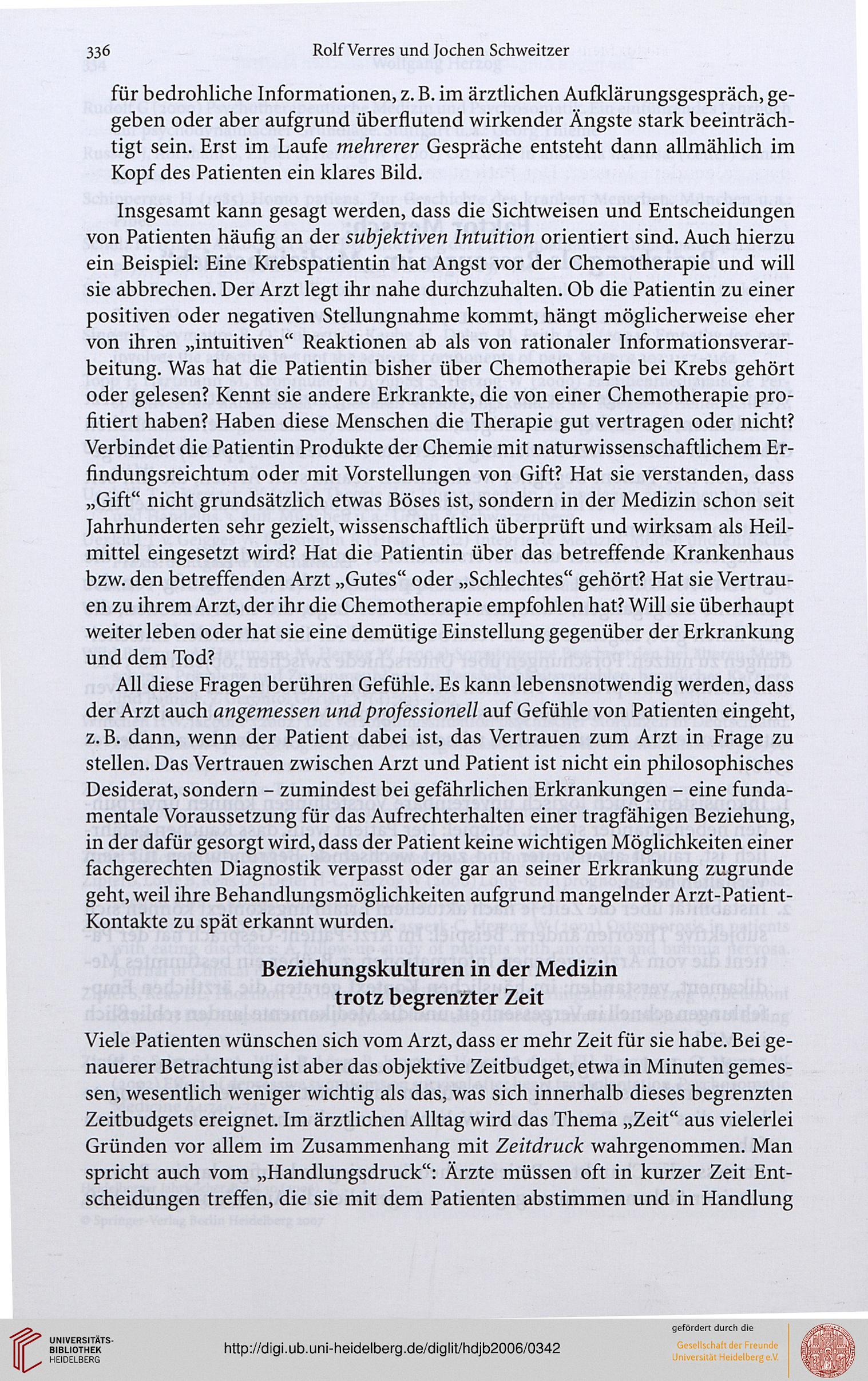336 Rolf Verres und Jochen Schweitzer
für bedrohliche Informationen, z. B. im ärztlichen Aufklärungsgespräch, ge-
geben oder aber aufgrund überflutend wirkender Ängste stark beeinträch-
tigt sein. Erst im Laufe mehrerer Gespräche entsteht dann allmählich im
Kopf des Patienten ein klares Bild.
Insgesamt kann gesagt werden, dass die Sichtweisen und Entscheidungen
von Patienten häufig an der subjektiven Intuition orientiert sind. Auch hierzu
ein Beispiel: Eine Krebspatientin hat Angst vor der Chemotherapie und will
sie abbrechen. Der Arzt legt ihr nahe durchzuhalten. Ob die Patientin zu einer
positiven oder negativen Stellungnahme kommt, hängt möglicherweise eher
von ihren „intuitiven" Reaktionen ab als von rationaler Informationsverar-
beitung. Was hat die Patientin bisher über Chemotherapie bei Krebs gehört
oder gelesen? Kennt sie andere Erkrankte, die von einer Chemotherapie pro-
fitiert haben? Haben diese Menschen die Therapie gut vertragen oder nicht?
Verbindet die Patientin Produkte der Chemie mit naturwissenschaftlichem Er-
findungsreichtum oder mit Vorstellungen von Gift? Hat sie verstanden, dass
„Gift" nicht grundsätzlich etwas Böses ist, sondern in der Medizin schon seit
Jahrhunderten sehr gezielt, wissenschaftlich überprüft und wirksam als Heil-
mittel eingesetzt wird? Hat die Patientin über das betreffende Krankenhaus
bzw. den betreffenden Arzt „Gutes" oder „Schlechtes" gehört? Hat sie Vertrau-
en zu ihrem Arzt, der ihr die Chemotherapie empfohlen hat? Will sie überhaupt
weiter leben oder hat sie eine demütige Einstellung gegenüber der Erkrankung
und dem Tod?
All diese Fragen berühren Gefühle. Es kann lebensnotwendig werden, dass
der Arzt auch angemessen und professionell auf Gefühle von Patienten eingeht,
z. B. dann, wenn der Patient dabei ist, das Vertrauen zum Arzt in Frage zu
stellen. Das Vertrauen zwischen Arzt und Patient ist nicht ein philosophisches
Desiderat, sondern - zumindest bei gefährlichen Erkrankungen - eine funda-
mentale Voraussetzung für das Aufrechterhalten einer tragfähigen Beziehung,
in der dafür gesorgt wird, dass der Patient keine wichtigen Möglichkeiten einer
fachgerechten Diagnostik verpasst oder gar an seiner Erkrankung zugrunde
geht, weil ihre Behandlungsmöglichkeiten aufgrund mangelnder Arzt-Patient-
Kontakte zu spät erkannt wurden.
Beziehungskulturen in der Medizin
trotz begrenzter Zeit
Viele Patienten wünschen sich vom Arzt, dass er mehr Zeit für sie habe. Bei ge-
nauerer Betrachtung ist aber das objektive Zeitbudget, etwa in Minuten gemes-
sen, wesentlich weniger wichtig als das, was sich innerhalb dieses begrenzten
Zeitbudgets ereignet. Im ärztlichen Alltag wird das Thema „Zeit" aus vielerlei
Gründen vor allem im Zusammenhang mit Zeitdruck wahrgenommen. Man
spricht auch vom „Handlungsdruck": Ärzte müssen oft in kurzer Zeit Ent-
scheidungen treffen, die sie mit dem Patienten abstimmen und in Handlung
für bedrohliche Informationen, z. B. im ärztlichen Aufklärungsgespräch, ge-
geben oder aber aufgrund überflutend wirkender Ängste stark beeinträch-
tigt sein. Erst im Laufe mehrerer Gespräche entsteht dann allmählich im
Kopf des Patienten ein klares Bild.
Insgesamt kann gesagt werden, dass die Sichtweisen und Entscheidungen
von Patienten häufig an der subjektiven Intuition orientiert sind. Auch hierzu
ein Beispiel: Eine Krebspatientin hat Angst vor der Chemotherapie und will
sie abbrechen. Der Arzt legt ihr nahe durchzuhalten. Ob die Patientin zu einer
positiven oder negativen Stellungnahme kommt, hängt möglicherweise eher
von ihren „intuitiven" Reaktionen ab als von rationaler Informationsverar-
beitung. Was hat die Patientin bisher über Chemotherapie bei Krebs gehört
oder gelesen? Kennt sie andere Erkrankte, die von einer Chemotherapie pro-
fitiert haben? Haben diese Menschen die Therapie gut vertragen oder nicht?
Verbindet die Patientin Produkte der Chemie mit naturwissenschaftlichem Er-
findungsreichtum oder mit Vorstellungen von Gift? Hat sie verstanden, dass
„Gift" nicht grundsätzlich etwas Böses ist, sondern in der Medizin schon seit
Jahrhunderten sehr gezielt, wissenschaftlich überprüft und wirksam als Heil-
mittel eingesetzt wird? Hat die Patientin über das betreffende Krankenhaus
bzw. den betreffenden Arzt „Gutes" oder „Schlechtes" gehört? Hat sie Vertrau-
en zu ihrem Arzt, der ihr die Chemotherapie empfohlen hat? Will sie überhaupt
weiter leben oder hat sie eine demütige Einstellung gegenüber der Erkrankung
und dem Tod?
All diese Fragen berühren Gefühle. Es kann lebensnotwendig werden, dass
der Arzt auch angemessen und professionell auf Gefühle von Patienten eingeht,
z. B. dann, wenn der Patient dabei ist, das Vertrauen zum Arzt in Frage zu
stellen. Das Vertrauen zwischen Arzt und Patient ist nicht ein philosophisches
Desiderat, sondern - zumindest bei gefährlichen Erkrankungen - eine funda-
mentale Voraussetzung für das Aufrechterhalten einer tragfähigen Beziehung,
in der dafür gesorgt wird, dass der Patient keine wichtigen Möglichkeiten einer
fachgerechten Diagnostik verpasst oder gar an seiner Erkrankung zugrunde
geht, weil ihre Behandlungsmöglichkeiten aufgrund mangelnder Arzt-Patient-
Kontakte zu spät erkannt wurden.
Beziehungskulturen in der Medizin
trotz begrenzter Zeit
Viele Patienten wünschen sich vom Arzt, dass er mehr Zeit für sie habe. Bei ge-
nauerer Betrachtung ist aber das objektive Zeitbudget, etwa in Minuten gemes-
sen, wesentlich weniger wichtig als das, was sich innerhalb dieses begrenzten
Zeitbudgets ereignet. Im ärztlichen Alltag wird das Thema „Zeit" aus vielerlei
Gründen vor allem im Zusammenhang mit Zeitdruck wahrgenommen. Man
spricht auch vom „Handlungsdruck": Ärzte müssen oft in kurzer Zeit Ent-
scheidungen treffen, die sie mit dem Patienten abstimmen und in Handlung