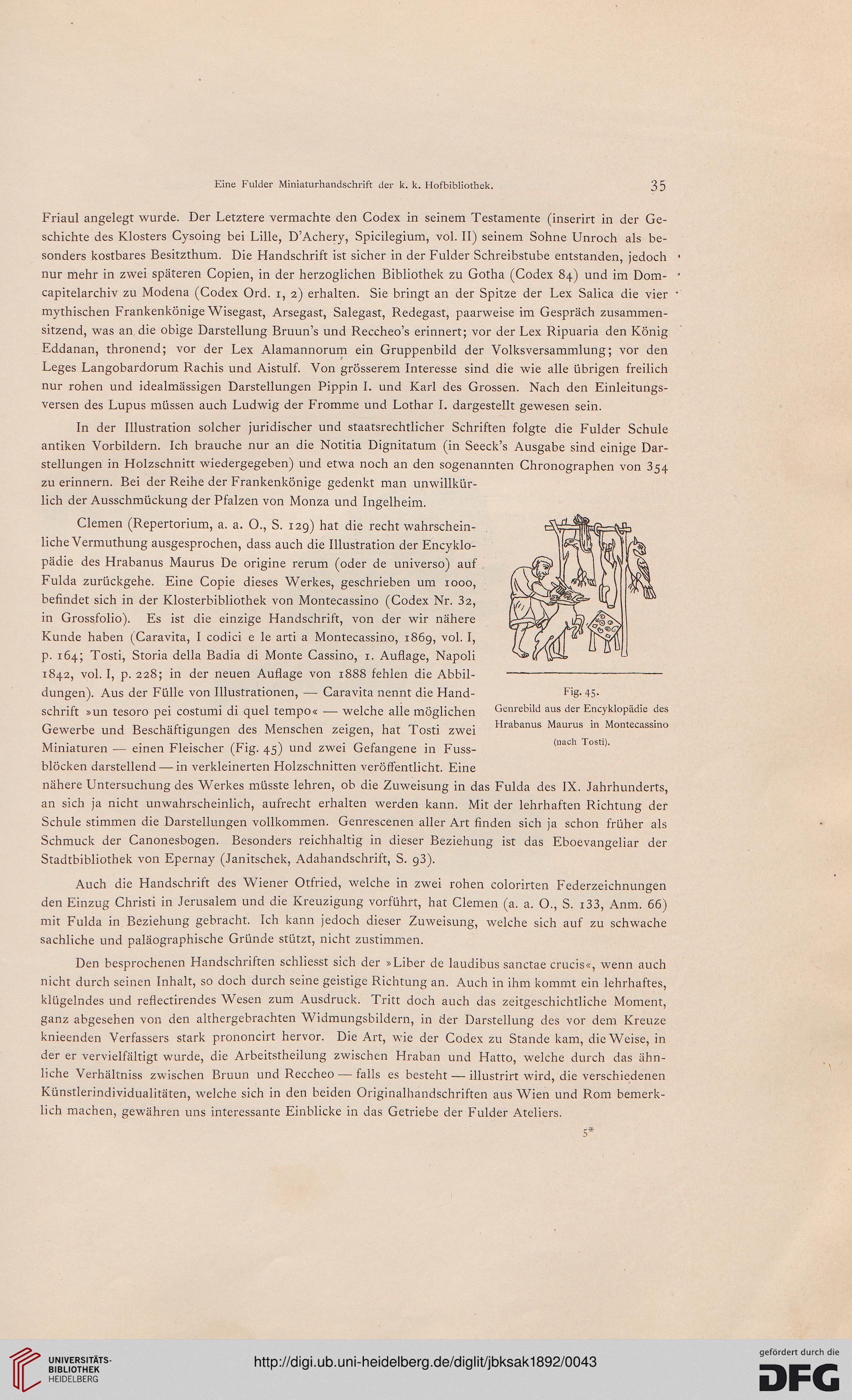Eine Fulder Miniaturhandschrift der k. k. Hofbibliothek.
35
Friaul angelegt wurde. Der Letztere vermachte den Codex in seinem Testamente (inserirt in der Ge-
schichte des Klosters Cysoing bei Lille, D'Achery, Spicilegium, vol. II) seinem Sohne Unroch als be-
sonders kostbares Besitzthum. Die Handschrift ist sicher in der Fulder Schreibstube entstanden, jedoch
nur mehr in zwei späteren Copien, in der herzoglichen Bibliothek zu Gotha (Codex 84) und im Dom-
capitelarchiv zu Modena (Codex Ord. 1, 2) erhalten. Sie bringt an der Spitze der Lex Salica die vier
mythischen Frankenkönige Wisegast, Arsegast, Salegast, Redegast, paarweise im Gespräch zusammen-
sitzend, was an die obige Darstellung Bruun's und Reccheo's erinnert; vor der Lex Ripuaria den König
Eddanan, thronend; vor der Lex Alamannorum ein Gruppenbild der Volksversammlung; vor den
Leges Langobardorum Rachis und Aistulf. Von grösserem Interesse sind die wie alle übrigen freilich
nur rohen und idealmässigen Darstellungen Pippin I. und Karl des Grossen. Nach den Einleitungs-
versen des Lupus müssen auch Ludwig der Fromme und Lothar I. dargestellt gewesen sein.
In der Illustration solcher juridischer und staatsrechtlicher Schriften folgte die Fulder Schule
antiken Vorbildern. Ich brauche nur an die Notitia Dignitatum (in Seeck's Ausgabe sind einige Dar-
stellungen in Holzschnitt wiedergegeben) und etwa noch an den sogenannten Chronographen von 354
zu erinnern. Bei der Reihe der Frankenkönige gedenkt man unwillkür-
lich der Ausschmückung der Pfalzen von Monza und Ingelheim.
Clemen (Repertorium, a. a. 0., S. 12g) hat die recht wahrschein-
liche Vermuthung ausgesprochen, dass auch die Illustration der Encyklo-
pädie des Hrabanus Maurus De origine rerum (oder de universo) auf
Fulda zurückgehe. Eine Copie dieses Werkes, geschrieben um 1000,
befindet sich in der Klosterbibliothek von Montecassino (Codex Nr. 32,
in Grossfolio). Es ist die einzige Handschrift, von der wir nähere
Kunde haben (Caravita, I codici e le arti a Montecassino, 1869, vol. I,
p. 164; Tosti, Storia della Badia di Monte Cassino, 1. Auflage, Napoli
1842, vol. I, p. 228; in der neuen Auflage von 1888 fehlen die Abbil-
dungen). Aus der Fülle von Illustrationen, — Caravita nennt die Hand-
schrift »un tesoro pei costumi di quel tempo« — welche alle möglichen
Gewerbe und Beschäftigungen des Menschen zeigen, hat Tosti zwei
Miniaturen — einen Fleischer (Fig. 45) und zwei Gefangene in Fuss-
blöcken darstellend — in verkleinerten Holzschnitten veröffentlicht. Eine
nähere Untersuchung des Werkes müsste lehren, ob die Zuweisung in das Fulda des IX. Jahrhunderts,
an sich ja nicht unwahrscheinlich, aufrecht erhalten werden kann. Mit der lehrhaften Richtung der
Schule stimmen die Darstellungen vollkommen. Genrescenen aller Art finden sich ja schon früher als
Schmuck der Canonesbogen. Besonders reichhaltig in dieser Beziehung ist das Eboevangeliar der
Stadtbibliothek von Epernay (Janitschek, Adahandschrift, S. g3).
Auch die Handschrift des Wiener Otfried, welche in zwei rohen colorirten Federzeichnungen
den Einzug Christi in Jerusalem und die Kreuzigung vorführt, hat Clemen (a. a. O., S. i33, Anm. 66)
mit Fulda in Beziehung gebracht. Ich kann jedoch dieser Zuweisung, welche sich auf zu schwache
sachliche und paläographische Gründe stützt, nicht zustimmen.
Den besprochenen Handschriften schliesst sich der »Liber de laudibus sanctae crucis«, wenn auch
nicht durch seinen Inhalt, so doch durch seine geistige Richtung an. Auch in ihm kommt ein lehrhaftes,
klügelndes und reflectirendes Wesen zum Ausdruck. Tritt doch auch das zeitgeschichtliche Moment,
ganz abgesehen von den althergebrachten Widmungsbildern, in der Darstellung des vor dem Kreuze
knieenden Verfassers stark prononcirt hervor. Die Art, wie der Codex zu Stande kam, die Weise, in
der er vervielfältigt wurde, die Arbeitstheilung zwischen Hraban und Hatto, welche durch das ähn-
liche Verhältniss zwischen Bruun und Reccheo — falls es besteht — illustrirt wird, die verschiedenen
Künstlerindividualitäten, welche sich in den beiden Originalhandschriften aus Wien und Rom bemerk-
lich machen, gewähren uns interessante Einblicke in das Getriebe der Fulder Ateliers.
F'ig- 45-
Genrebild aus der Encyklopädie des
Hrabanus Maurus in Montecassino
(nach Tosti).
35
Friaul angelegt wurde. Der Letztere vermachte den Codex in seinem Testamente (inserirt in der Ge-
schichte des Klosters Cysoing bei Lille, D'Achery, Spicilegium, vol. II) seinem Sohne Unroch als be-
sonders kostbares Besitzthum. Die Handschrift ist sicher in der Fulder Schreibstube entstanden, jedoch
nur mehr in zwei späteren Copien, in der herzoglichen Bibliothek zu Gotha (Codex 84) und im Dom-
capitelarchiv zu Modena (Codex Ord. 1, 2) erhalten. Sie bringt an der Spitze der Lex Salica die vier
mythischen Frankenkönige Wisegast, Arsegast, Salegast, Redegast, paarweise im Gespräch zusammen-
sitzend, was an die obige Darstellung Bruun's und Reccheo's erinnert; vor der Lex Ripuaria den König
Eddanan, thronend; vor der Lex Alamannorum ein Gruppenbild der Volksversammlung; vor den
Leges Langobardorum Rachis und Aistulf. Von grösserem Interesse sind die wie alle übrigen freilich
nur rohen und idealmässigen Darstellungen Pippin I. und Karl des Grossen. Nach den Einleitungs-
versen des Lupus müssen auch Ludwig der Fromme und Lothar I. dargestellt gewesen sein.
In der Illustration solcher juridischer und staatsrechtlicher Schriften folgte die Fulder Schule
antiken Vorbildern. Ich brauche nur an die Notitia Dignitatum (in Seeck's Ausgabe sind einige Dar-
stellungen in Holzschnitt wiedergegeben) und etwa noch an den sogenannten Chronographen von 354
zu erinnern. Bei der Reihe der Frankenkönige gedenkt man unwillkür-
lich der Ausschmückung der Pfalzen von Monza und Ingelheim.
Clemen (Repertorium, a. a. 0., S. 12g) hat die recht wahrschein-
liche Vermuthung ausgesprochen, dass auch die Illustration der Encyklo-
pädie des Hrabanus Maurus De origine rerum (oder de universo) auf
Fulda zurückgehe. Eine Copie dieses Werkes, geschrieben um 1000,
befindet sich in der Klosterbibliothek von Montecassino (Codex Nr. 32,
in Grossfolio). Es ist die einzige Handschrift, von der wir nähere
Kunde haben (Caravita, I codici e le arti a Montecassino, 1869, vol. I,
p. 164; Tosti, Storia della Badia di Monte Cassino, 1. Auflage, Napoli
1842, vol. I, p. 228; in der neuen Auflage von 1888 fehlen die Abbil-
dungen). Aus der Fülle von Illustrationen, — Caravita nennt die Hand-
schrift »un tesoro pei costumi di quel tempo« — welche alle möglichen
Gewerbe und Beschäftigungen des Menschen zeigen, hat Tosti zwei
Miniaturen — einen Fleischer (Fig. 45) und zwei Gefangene in Fuss-
blöcken darstellend — in verkleinerten Holzschnitten veröffentlicht. Eine
nähere Untersuchung des Werkes müsste lehren, ob die Zuweisung in das Fulda des IX. Jahrhunderts,
an sich ja nicht unwahrscheinlich, aufrecht erhalten werden kann. Mit der lehrhaften Richtung der
Schule stimmen die Darstellungen vollkommen. Genrescenen aller Art finden sich ja schon früher als
Schmuck der Canonesbogen. Besonders reichhaltig in dieser Beziehung ist das Eboevangeliar der
Stadtbibliothek von Epernay (Janitschek, Adahandschrift, S. g3).
Auch die Handschrift des Wiener Otfried, welche in zwei rohen colorirten Federzeichnungen
den Einzug Christi in Jerusalem und die Kreuzigung vorführt, hat Clemen (a. a. O., S. i33, Anm. 66)
mit Fulda in Beziehung gebracht. Ich kann jedoch dieser Zuweisung, welche sich auf zu schwache
sachliche und paläographische Gründe stützt, nicht zustimmen.
Den besprochenen Handschriften schliesst sich der »Liber de laudibus sanctae crucis«, wenn auch
nicht durch seinen Inhalt, so doch durch seine geistige Richtung an. Auch in ihm kommt ein lehrhaftes,
klügelndes und reflectirendes Wesen zum Ausdruck. Tritt doch auch das zeitgeschichtliche Moment,
ganz abgesehen von den althergebrachten Widmungsbildern, in der Darstellung des vor dem Kreuze
knieenden Verfassers stark prononcirt hervor. Die Art, wie der Codex zu Stande kam, die Weise, in
der er vervielfältigt wurde, die Arbeitstheilung zwischen Hraban und Hatto, welche durch das ähn-
liche Verhältniss zwischen Bruun und Reccheo — falls es besteht — illustrirt wird, die verschiedenen
Künstlerindividualitäten, welche sich in den beiden Originalhandschriften aus Wien und Rom bemerk-
lich machen, gewähren uns interessante Einblicke in das Getriebe der Fulder Ateliers.
F'ig- 45-
Genrebild aus der Encyklopädie des
Hrabanus Maurus in Montecassino
(nach Tosti).