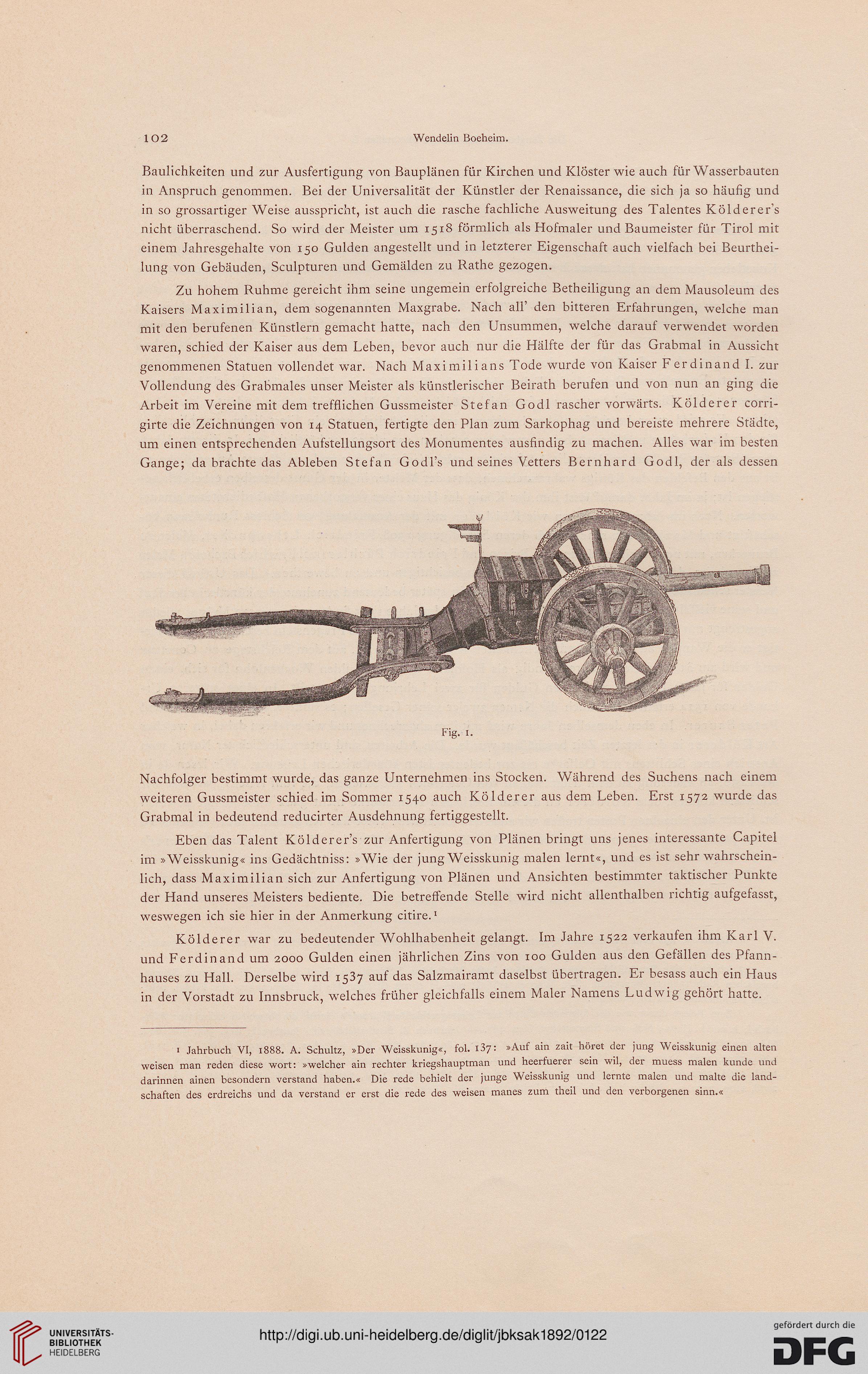102
Wendelin Boeheim.
Baulichkeiten und zur Ausfertigung von Bauplänen für Kirchen und Klöster wie auch für Wasserbauten
in Anspruch genommen. Bei der Universalität der Künstler der Renaissance, die sich ja so häufig und
in so grossartiger Weise ausspricht, ist auch die rasche fachliche Ausweitung des Talentes Kölderer's
nicht überraschend. So wird der Meister um 1518 förmlich als Hofmaler und Baumeister für Tirol mit
einem Jahresgehalte von 150 Gulden angestellt und in letzterer Eigenschaft auch vielfach bei Beurthei-
lung von Gebäuden, Sculpturen und Gemälden zu Rathe gezogen.
Zu hohem Ruhme gereicht ihm seine ungemein erfolgreiche Betheiligung an dem Mausoleum des
Kaisers Maximilian, dem sogenannten Maxgrabe. Nach all' den bitteren Erfahrungen, welche man
mit den berufenen Künstlern gemacht hatte, nach den Unsummen, welche darauf verwendet worden
waren, schied der Kaiser aus dem Leben, bevor auch nur die Hälfte der für das Grabmal in Aussicht
genommenen Statuen vollendet war. Nach Maximilians Tode wurde von Kaiser Ferdinand I. zur
Vollendung des Grabmales unser Meister als künstlerischer Beirath berufen und von nun an ging die
Arbeit im Vereine mit dem trefflichen Gussmeister Stefan Godl rascher vorwärts. Kölderer corri-
girte die Zeichnungen von 14 Statuen, fertigte den Plan zum Sarkophag und bereiste mehrere Städte,
um einen entsprechenden Aufstellungsort des Monumentes ausfindig zu machen. Alles war im besten
Gange; da brachte das Ableben Stefan Godl's und seines Vetters Bernhard Godl, der als dessen
Fig. 1.
Nachfolger bestimmt wurde, das ganze Unternehmen ins Stocken. Während des Suchens nach einem
weiteren Gussmeister schied im Sommer 1540 auch Kölderer aus dem Leben. Erst 1572 wurde das
Grabmal in bedeutend reducirter Ausdehnung fertiggestellt.
Eben das Talent Kölderer's zur Anfertigung von Plänen bringt uns jenes interessante Capitel
im »Weisskunig« ins Gedächtniss: »Wie der jung Weisskunig malen lernt«, und es ist sehr wahrschein-
lich, dass Maximilian sich zur Anfertigung von Plänen und Ansichten bestimmter taktischer Punkte
der Hand unseres Meisters bediente. Die betreffende Stelle wird nicht allenthalben richtig aufgefasst,
weswegen ich sie hier in der Anmerkung citire.1
Kölderer war zu bedeutender Wohlhabenheit gelangt. Im Jahre 1522 verkaufen ihm Karl V.
und Ferdinand um 2000 Gulden einen jährlichen Zins von 100 Gulden aus den Gefällen des Pfann-
hauses zu Hall. Derselbe wird 1537 auf das Salzmairamt daselbst übertragen. Er besass auch ein Haus
in der Vorstadt zu Innsbruck, welches früher gleichfalls einem Maler Namens Ludwig gehört hatte.
1 Jahrbuch VI, 1888. A. Schultz, »Der Weisskunig«, fol. 137: »Auf ain zait höret der jung Weisskunig einen alten
weisen man reden diese wort: »welcher ain rechter kriegshauptman und heerfuerer sein wil, der muess malen künde und
darinnen ainen besondern verstand haben.« Die rede behielt der junge Weisskunig und lernte malen und malte die land-
schaften des erdreichs und da verstand er erst die rede des weisen manes zum theil und den verborgenen sinn.«
Wendelin Boeheim.
Baulichkeiten und zur Ausfertigung von Bauplänen für Kirchen und Klöster wie auch für Wasserbauten
in Anspruch genommen. Bei der Universalität der Künstler der Renaissance, die sich ja so häufig und
in so grossartiger Weise ausspricht, ist auch die rasche fachliche Ausweitung des Talentes Kölderer's
nicht überraschend. So wird der Meister um 1518 förmlich als Hofmaler und Baumeister für Tirol mit
einem Jahresgehalte von 150 Gulden angestellt und in letzterer Eigenschaft auch vielfach bei Beurthei-
lung von Gebäuden, Sculpturen und Gemälden zu Rathe gezogen.
Zu hohem Ruhme gereicht ihm seine ungemein erfolgreiche Betheiligung an dem Mausoleum des
Kaisers Maximilian, dem sogenannten Maxgrabe. Nach all' den bitteren Erfahrungen, welche man
mit den berufenen Künstlern gemacht hatte, nach den Unsummen, welche darauf verwendet worden
waren, schied der Kaiser aus dem Leben, bevor auch nur die Hälfte der für das Grabmal in Aussicht
genommenen Statuen vollendet war. Nach Maximilians Tode wurde von Kaiser Ferdinand I. zur
Vollendung des Grabmales unser Meister als künstlerischer Beirath berufen und von nun an ging die
Arbeit im Vereine mit dem trefflichen Gussmeister Stefan Godl rascher vorwärts. Kölderer corri-
girte die Zeichnungen von 14 Statuen, fertigte den Plan zum Sarkophag und bereiste mehrere Städte,
um einen entsprechenden Aufstellungsort des Monumentes ausfindig zu machen. Alles war im besten
Gange; da brachte das Ableben Stefan Godl's und seines Vetters Bernhard Godl, der als dessen
Fig. 1.
Nachfolger bestimmt wurde, das ganze Unternehmen ins Stocken. Während des Suchens nach einem
weiteren Gussmeister schied im Sommer 1540 auch Kölderer aus dem Leben. Erst 1572 wurde das
Grabmal in bedeutend reducirter Ausdehnung fertiggestellt.
Eben das Talent Kölderer's zur Anfertigung von Plänen bringt uns jenes interessante Capitel
im »Weisskunig« ins Gedächtniss: »Wie der jung Weisskunig malen lernt«, und es ist sehr wahrschein-
lich, dass Maximilian sich zur Anfertigung von Plänen und Ansichten bestimmter taktischer Punkte
der Hand unseres Meisters bediente. Die betreffende Stelle wird nicht allenthalben richtig aufgefasst,
weswegen ich sie hier in der Anmerkung citire.1
Kölderer war zu bedeutender Wohlhabenheit gelangt. Im Jahre 1522 verkaufen ihm Karl V.
und Ferdinand um 2000 Gulden einen jährlichen Zins von 100 Gulden aus den Gefällen des Pfann-
hauses zu Hall. Derselbe wird 1537 auf das Salzmairamt daselbst übertragen. Er besass auch ein Haus
in der Vorstadt zu Innsbruck, welches früher gleichfalls einem Maler Namens Ludwig gehört hatte.
1 Jahrbuch VI, 1888. A. Schultz, »Der Weisskunig«, fol. 137: »Auf ain zait höret der jung Weisskunig einen alten
weisen man reden diese wort: »welcher ain rechter kriegshauptman und heerfuerer sein wil, der muess malen künde und
darinnen ainen besondern verstand haben.« Die rede behielt der junge Weisskunig und lernte malen und malte die land-
schaften des erdreichs und da verstand er erst die rede des weisen manes zum theil und den verborgenen sinn.«