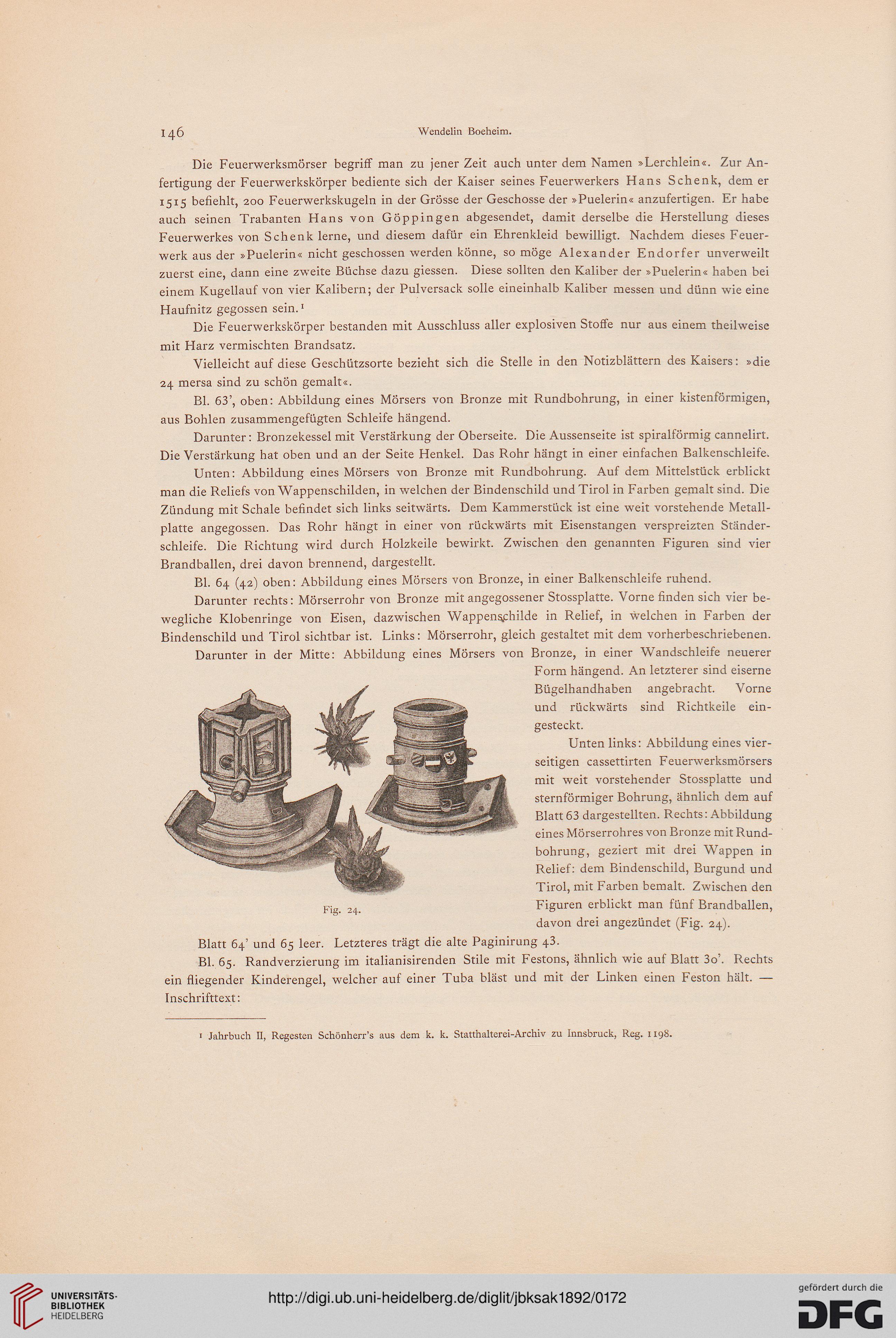146
Wendelin Boeheim.
Die Feuerwerksmörser begriff man zu jener Zeit auch unter dem Namen »Lerchlein«. Zur An-
fertigung der Feuerwerkskörper bediente sich der Kaiser seines Feuerwerkers Hans Schenk, dem er
1515 befiehlt, 200 Feuerwerkskugeln in der Grösse der Geschosse der »Puelerin« anzufertigen. Er habe
auch seinen Trabanten Hans von Göppingen abgesendet, damit derselbe die Herstellung dieses
Feuerwerkes von Schenk lerne, und diesem dafür ein Ehrenkleid bewilligt. Nachdem dieses Feuer-
werk aus der »Puelerin« nicht geschossen werden könne, so möge Alexander Endorfer unverweilt
zuerst eine, dann eine zweite Büchse dazu giessen. Diese sollten den Kaliber der »Puelerin« haben bei
einem Kugellauf von vier Kalibern; der Pul versack solle eineinhalb Kaliber messen und dünn wie eine
Haufnitz gegossen sein.1
Die Feuerwerkskörper bestanden mit Ausschluss aller explosiven Stoffe nur aus einem theilweise
mit Harz vermischten Brandsatz.
Vielleicht auf diese Geschützsorte bezieht sich die Stelle in den Notizblättern des Kaisers: »die
24 mersa sind zu schön gemalt«.
Bl. 63', oben: Abbildung eines Mörsers von Bronze mit Rundbohrung, in einer kistenförmigen,
aus Bohlen zusammengefügten Schleife hängend.
Darunter: Bronzekessel mit Verstärkung der Oberseite. Die Aussenseite ist spiralförmig cannelirt.
Die Verstärkung hat oben und an der Seite Henkel. Das Rohr hängt in einer einfachen Balkenschleife.
Unten: Abbildung eines Mörsers von Bronze mit Rundbohrung. Auf dem Mittelstück erblickt
man die Reliefs von Wappenschilden, in welchen der Bindenschild und Tirol in Farben gemalt sind. Die
Zündung mit Schale befindet sich links seitwärts. Dem Kammerstück ist eine weit vorstehende Metall-
platte angegossen. Das Rohr hängt in einer von rückwärts mit Eisenstangen verspreizten Ständer-
schleife. Die Richtung wird durch Holzkeile bewirkt. Zwischen den genannten Figuren sind vier
Brandballen, drei davon brennend, dargestellt.
Bl. 64 (42) oben: Abbildung eines Mörsers von Bronze, in einer Balkenschleife ruhend.
Darunter rechts: Mörserrohr von Bronze mit angegossener Stossplatte. Vorne finden sich vier be-
wegliche Klobenringe von Eisen, dazwischen Wappens.childe in Relief, in welchen in Farben der
Bindenschild und Tirol sichtbar ist. Links: Mörserrohr, gleich gestaltet mit dem vorherbeschriebenen.
Darunter in der Mitte: Abbildung eines Mörsers von Bronze, in einer Wandschleife neuerer
Form hängend. An letzterer sind eiserne
Bügelhandhaben angebracht. Vorne
und rückwärts sind Richtkeile ein-
gesteckt.
Unten links: Abbildung eines vier-
seitigen cassettirten Feuerwerksmörsers
mit weit vorstehender Stossplatte und
sternförmiger Bohrung, ähnlich dem auf
Blatt 63 dargestellten. Rechts: Abbildung
eines Mörserrohres von Bronze mit Rund-
bohrung, geziert mit drei Wappen in
Relief: dem Bindenschild, Burgund und
Tirol, mit Farben bemalt. Zwischen den
Fig. 24. Figuren erblickt man fünf Brandballen,
davon drei angezündet (Fig. 24).
Blatt 64' und 65 leer. Letzteres trägt die alte Paginirung 43.
Bl. 65. Randverzierung im italianisirenden Stile mit Festons, ähnlich wie auf Blatt 3o'. Rechts
ein fliegender Kinderengel, welcher auf einer Tuba bläst und mit der Linken einen Feston hält. —
Inschrifttext:
1 Jahrbuch II, Regesten Schönherr's aus dem k. k. Statthalterei-Archiv zu Innsbruck, Reg. 1198.
Wendelin Boeheim.
Die Feuerwerksmörser begriff man zu jener Zeit auch unter dem Namen »Lerchlein«. Zur An-
fertigung der Feuerwerkskörper bediente sich der Kaiser seines Feuerwerkers Hans Schenk, dem er
1515 befiehlt, 200 Feuerwerkskugeln in der Grösse der Geschosse der »Puelerin« anzufertigen. Er habe
auch seinen Trabanten Hans von Göppingen abgesendet, damit derselbe die Herstellung dieses
Feuerwerkes von Schenk lerne, und diesem dafür ein Ehrenkleid bewilligt. Nachdem dieses Feuer-
werk aus der »Puelerin« nicht geschossen werden könne, so möge Alexander Endorfer unverweilt
zuerst eine, dann eine zweite Büchse dazu giessen. Diese sollten den Kaliber der »Puelerin« haben bei
einem Kugellauf von vier Kalibern; der Pul versack solle eineinhalb Kaliber messen und dünn wie eine
Haufnitz gegossen sein.1
Die Feuerwerkskörper bestanden mit Ausschluss aller explosiven Stoffe nur aus einem theilweise
mit Harz vermischten Brandsatz.
Vielleicht auf diese Geschützsorte bezieht sich die Stelle in den Notizblättern des Kaisers: »die
24 mersa sind zu schön gemalt«.
Bl. 63', oben: Abbildung eines Mörsers von Bronze mit Rundbohrung, in einer kistenförmigen,
aus Bohlen zusammengefügten Schleife hängend.
Darunter: Bronzekessel mit Verstärkung der Oberseite. Die Aussenseite ist spiralförmig cannelirt.
Die Verstärkung hat oben und an der Seite Henkel. Das Rohr hängt in einer einfachen Balkenschleife.
Unten: Abbildung eines Mörsers von Bronze mit Rundbohrung. Auf dem Mittelstück erblickt
man die Reliefs von Wappenschilden, in welchen der Bindenschild und Tirol in Farben gemalt sind. Die
Zündung mit Schale befindet sich links seitwärts. Dem Kammerstück ist eine weit vorstehende Metall-
platte angegossen. Das Rohr hängt in einer von rückwärts mit Eisenstangen verspreizten Ständer-
schleife. Die Richtung wird durch Holzkeile bewirkt. Zwischen den genannten Figuren sind vier
Brandballen, drei davon brennend, dargestellt.
Bl. 64 (42) oben: Abbildung eines Mörsers von Bronze, in einer Balkenschleife ruhend.
Darunter rechts: Mörserrohr von Bronze mit angegossener Stossplatte. Vorne finden sich vier be-
wegliche Klobenringe von Eisen, dazwischen Wappens.childe in Relief, in welchen in Farben der
Bindenschild und Tirol sichtbar ist. Links: Mörserrohr, gleich gestaltet mit dem vorherbeschriebenen.
Darunter in der Mitte: Abbildung eines Mörsers von Bronze, in einer Wandschleife neuerer
Form hängend. An letzterer sind eiserne
Bügelhandhaben angebracht. Vorne
und rückwärts sind Richtkeile ein-
gesteckt.
Unten links: Abbildung eines vier-
seitigen cassettirten Feuerwerksmörsers
mit weit vorstehender Stossplatte und
sternförmiger Bohrung, ähnlich dem auf
Blatt 63 dargestellten. Rechts: Abbildung
eines Mörserrohres von Bronze mit Rund-
bohrung, geziert mit drei Wappen in
Relief: dem Bindenschild, Burgund und
Tirol, mit Farben bemalt. Zwischen den
Fig. 24. Figuren erblickt man fünf Brandballen,
davon drei angezündet (Fig. 24).
Blatt 64' und 65 leer. Letzteres trägt die alte Paginirung 43.
Bl. 65. Randverzierung im italianisirenden Stile mit Festons, ähnlich wie auf Blatt 3o'. Rechts
ein fliegender Kinderengel, welcher auf einer Tuba bläst und mit der Linken einen Feston hält. —
Inschrifttext:
1 Jahrbuch II, Regesten Schönherr's aus dem k. k. Statthalterei-Archiv zu Innsbruck, Reg. 1198.