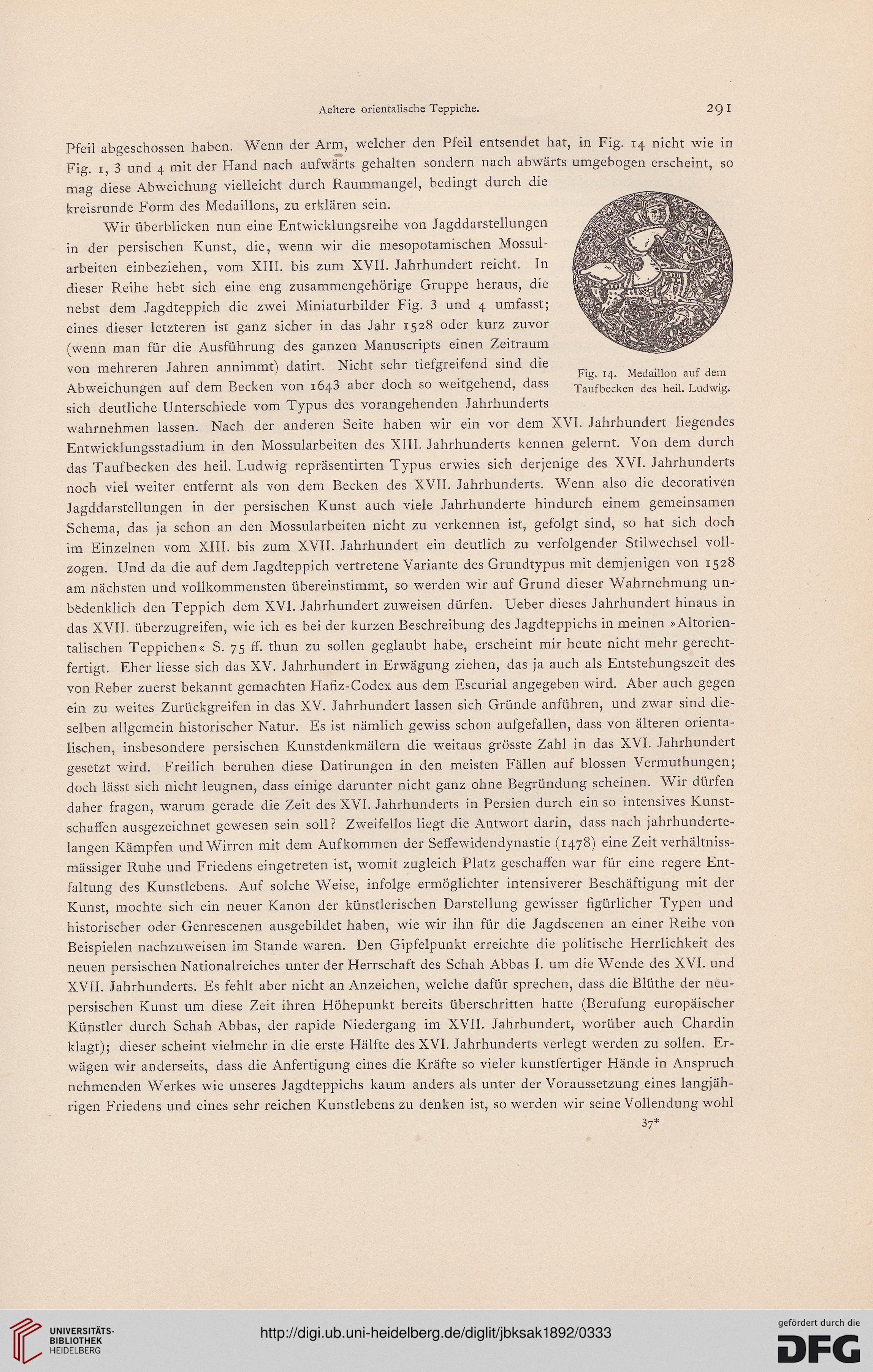Aeltere orientalische Teppiche.
29I
Pfeil abgeschossen haben. Wenn der Arm, welcher den Pfeil entsendet hat, in Fig. 14 nicht wie in
Fig. 1, 3 und 4 mit der Hand nach aufwärts gehalten sondern nach abwärts umgebogen erscheint, so
mag diese Abweichung vielleicht durch Raummangel, bedingt durch die
kreisrunde Form des Medaillons, zu erklären sein.
Wir überblicken nun eine Entwicklungsreihe von Jagddarstellungen
in der persischen Kunst, die, wenn wir die mesopotamischen Mossul-
arbeiten einbeziehen, vom XIII. bis zum XVII. Jahrhundert reicht. In
dieser Reihe hebt sich eine eng zusammengehörige Gruppe heraus, die
nebst dem Jagdteppich die zwei Miniaturbilder Fig. 3 und 4 umfasst;
eines dieser letzteren ist ganz sicher in das Jahr 1528 oder kurz zuvor
(wenn man für die Ausführung des ganzen Manuscripts einen Zeitraum
von mehreren Jahren annimmt) datirt. Nicht sehr tiefgreifend sind die
. Fig. 14. Medaillon auf dem
Abweichungen auf dem Becken von 1643 aber doch so weitgehend, dass Taufbecken des heil. Ludwig,
sich deutliche Unterschiede vom Typus des vorangehenden Jahrhunderts
wahrnehmen lassen. Nach der anderen Seite haben wir ein vor dem XVI. Jahrhundert liegendes
Entwicklungsstadium in den Mossularbeiten des XIII. Jahrhunderts kennen gelernt. Von dem durch
das Taufbecken des heil. Ludwig repräsentirten Typus erwies sich derjenige des XVI. Jahrhunderts
noch viel weiter entfernt als von dem Becken des XVII. Jahrhunderts. Wenn also die decorativen
Jagddarstellungen in der persischen Kunst auch viele Jahrhunderte hindurch einem gemeinsamen
Schema, das ja schon an den Mossularbeiten nicht zu verkennen ist, gefolgt sind, so hat sich doch
im Einzelnen vom XIII. bis zum XVII. Jahrhundert ein deutlich zu verfolgender Stilwechsel voll-
zogen. Und da die auf dem Jagdteppich vertretene Variante des Grundtypus mit demjenigen von 1528
am nächsten und vollkommensten übereinstimmt, so werden wir auf Grund dieser Wahrnehmung un-
bedenklich den Teppich dem XVI. Jahrhundert zuweisen dürfen. Ueber dieses Jahrhundert hinaus in
das XVII. überzugreifen, wie ich es bei der kurzen Beschreibung des Jagdteppichs in meinen »Altorien-
talischen Teppichen« S. 75 ff. thun zu sollen geglaubt habe, erscheint mir heute nicht mehr gerecht-
fertigt. Eher liesse sich das XV. Jahrhundert in Erwägung ziehen, das ja auch als Entstehungszeit des
von Reber zuerst bekannt gemachten Hafiz-Codex aus dem Escurial angegeben wird. Aber auch gegen
ein zu weites Zurückgreifen in das XV. Jahrhundert lassen sich Gründe anführen, und zwar sind die-
selben allgemein historischer Natur. Es ist nämlich gewiss schon aufgefallen, dass von älteren orienta-
lischen, insbesondere persischen Kunstdenkmälern die weitaus grösste Zahl in das XVI. Jahrhundert
gesetzt wird. Freilich beruhen diese Datirungen in den meisten Fällen auf blossen Vermuthungen;
doch lässt sich nicht leugnen, dass einige darunter nicht ganz ohne Begründung scheinen. Wir dürfen
daher fragen, warum gerade die Zeit des XVI. Jahrhunderts in Persien durch ein so intensives Kunst-
schaffen ausgezeichnet gewesen sein soll? Zweifellos liegt die Antwort darin, dass nach jahrhunderte-
langen Kämpfen und Wirren mit dem Aufkommen der Seffewidendynastie (1478) eine Zeit verhältniss-
mässiger Ruhe und Friedens eingetreten ist, womit zugleich Platz geschaffen war für eine regere Ent-
faltung des Kunstlebens. Auf solche Weise, infolge ermöglichter intensiverer Beschäftigung mit der
Kunst, mochte sich ein neuer Kanon der künstlerischen Darstellung gewisser figürlicher Typen und
historischer oder Genrescenen ausgebildet haben, wie wir ihn für die Jagdscenen an einer Reihe von
Beispielen nachzuweisen im Stande waren. Den Gipfelpunkt erreichte die politische Herrlichkeit des
neuen persischen Nationalreiches unter der Herrschaft des Schah Abbas I. um die Wende des XVI. und
XVII. Jahrhunderts. Es fehlt aber nicht an Anzeichen, welche dafür sprechen, dass die Blüthe der neu-
persischen Kunst um diese Zeit ihren Höhepunkt bereits überschritten hatte (Berufung europäischer
Künstler durch Schah Abbas, der rapide Niedergang im XVII. Jahrhundert, worüber auch Chardin
klagt); dieser scheint vielmehr in die erste Hälfte des XVI. Jahrhunderts verlegt werden zu sollen. Er-
wägen wir anderseits, dass die Anfertigung eines die Kräfte so vieler kunstfertiger Hände in Anspruch
nehmenden Werkes wie unseres Jagdteppichs kaum anders als unter der Voraussetzung eines langjäh-
rigen Friedens und eines sehr reichen Kunstlebens zu denken ist, so werden wir seine Vollendung wohl
37*
29I
Pfeil abgeschossen haben. Wenn der Arm, welcher den Pfeil entsendet hat, in Fig. 14 nicht wie in
Fig. 1, 3 und 4 mit der Hand nach aufwärts gehalten sondern nach abwärts umgebogen erscheint, so
mag diese Abweichung vielleicht durch Raummangel, bedingt durch die
kreisrunde Form des Medaillons, zu erklären sein.
Wir überblicken nun eine Entwicklungsreihe von Jagddarstellungen
in der persischen Kunst, die, wenn wir die mesopotamischen Mossul-
arbeiten einbeziehen, vom XIII. bis zum XVII. Jahrhundert reicht. In
dieser Reihe hebt sich eine eng zusammengehörige Gruppe heraus, die
nebst dem Jagdteppich die zwei Miniaturbilder Fig. 3 und 4 umfasst;
eines dieser letzteren ist ganz sicher in das Jahr 1528 oder kurz zuvor
(wenn man für die Ausführung des ganzen Manuscripts einen Zeitraum
von mehreren Jahren annimmt) datirt. Nicht sehr tiefgreifend sind die
. Fig. 14. Medaillon auf dem
Abweichungen auf dem Becken von 1643 aber doch so weitgehend, dass Taufbecken des heil. Ludwig,
sich deutliche Unterschiede vom Typus des vorangehenden Jahrhunderts
wahrnehmen lassen. Nach der anderen Seite haben wir ein vor dem XVI. Jahrhundert liegendes
Entwicklungsstadium in den Mossularbeiten des XIII. Jahrhunderts kennen gelernt. Von dem durch
das Taufbecken des heil. Ludwig repräsentirten Typus erwies sich derjenige des XVI. Jahrhunderts
noch viel weiter entfernt als von dem Becken des XVII. Jahrhunderts. Wenn also die decorativen
Jagddarstellungen in der persischen Kunst auch viele Jahrhunderte hindurch einem gemeinsamen
Schema, das ja schon an den Mossularbeiten nicht zu verkennen ist, gefolgt sind, so hat sich doch
im Einzelnen vom XIII. bis zum XVII. Jahrhundert ein deutlich zu verfolgender Stilwechsel voll-
zogen. Und da die auf dem Jagdteppich vertretene Variante des Grundtypus mit demjenigen von 1528
am nächsten und vollkommensten übereinstimmt, so werden wir auf Grund dieser Wahrnehmung un-
bedenklich den Teppich dem XVI. Jahrhundert zuweisen dürfen. Ueber dieses Jahrhundert hinaus in
das XVII. überzugreifen, wie ich es bei der kurzen Beschreibung des Jagdteppichs in meinen »Altorien-
talischen Teppichen« S. 75 ff. thun zu sollen geglaubt habe, erscheint mir heute nicht mehr gerecht-
fertigt. Eher liesse sich das XV. Jahrhundert in Erwägung ziehen, das ja auch als Entstehungszeit des
von Reber zuerst bekannt gemachten Hafiz-Codex aus dem Escurial angegeben wird. Aber auch gegen
ein zu weites Zurückgreifen in das XV. Jahrhundert lassen sich Gründe anführen, und zwar sind die-
selben allgemein historischer Natur. Es ist nämlich gewiss schon aufgefallen, dass von älteren orienta-
lischen, insbesondere persischen Kunstdenkmälern die weitaus grösste Zahl in das XVI. Jahrhundert
gesetzt wird. Freilich beruhen diese Datirungen in den meisten Fällen auf blossen Vermuthungen;
doch lässt sich nicht leugnen, dass einige darunter nicht ganz ohne Begründung scheinen. Wir dürfen
daher fragen, warum gerade die Zeit des XVI. Jahrhunderts in Persien durch ein so intensives Kunst-
schaffen ausgezeichnet gewesen sein soll? Zweifellos liegt die Antwort darin, dass nach jahrhunderte-
langen Kämpfen und Wirren mit dem Aufkommen der Seffewidendynastie (1478) eine Zeit verhältniss-
mässiger Ruhe und Friedens eingetreten ist, womit zugleich Platz geschaffen war für eine regere Ent-
faltung des Kunstlebens. Auf solche Weise, infolge ermöglichter intensiverer Beschäftigung mit der
Kunst, mochte sich ein neuer Kanon der künstlerischen Darstellung gewisser figürlicher Typen und
historischer oder Genrescenen ausgebildet haben, wie wir ihn für die Jagdscenen an einer Reihe von
Beispielen nachzuweisen im Stande waren. Den Gipfelpunkt erreichte die politische Herrlichkeit des
neuen persischen Nationalreiches unter der Herrschaft des Schah Abbas I. um die Wende des XVI. und
XVII. Jahrhunderts. Es fehlt aber nicht an Anzeichen, welche dafür sprechen, dass die Blüthe der neu-
persischen Kunst um diese Zeit ihren Höhepunkt bereits überschritten hatte (Berufung europäischer
Künstler durch Schah Abbas, der rapide Niedergang im XVII. Jahrhundert, worüber auch Chardin
klagt); dieser scheint vielmehr in die erste Hälfte des XVI. Jahrhunderts verlegt werden zu sollen. Er-
wägen wir anderseits, dass die Anfertigung eines die Kräfte so vieler kunstfertiger Hände in Anspruch
nehmenden Werkes wie unseres Jagdteppichs kaum anders als unter der Voraussetzung eines langjäh-
rigen Friedens und eines sehr reichen Kunstlebens zu denken ist, so werden wir seine Vollendung wohl
37*