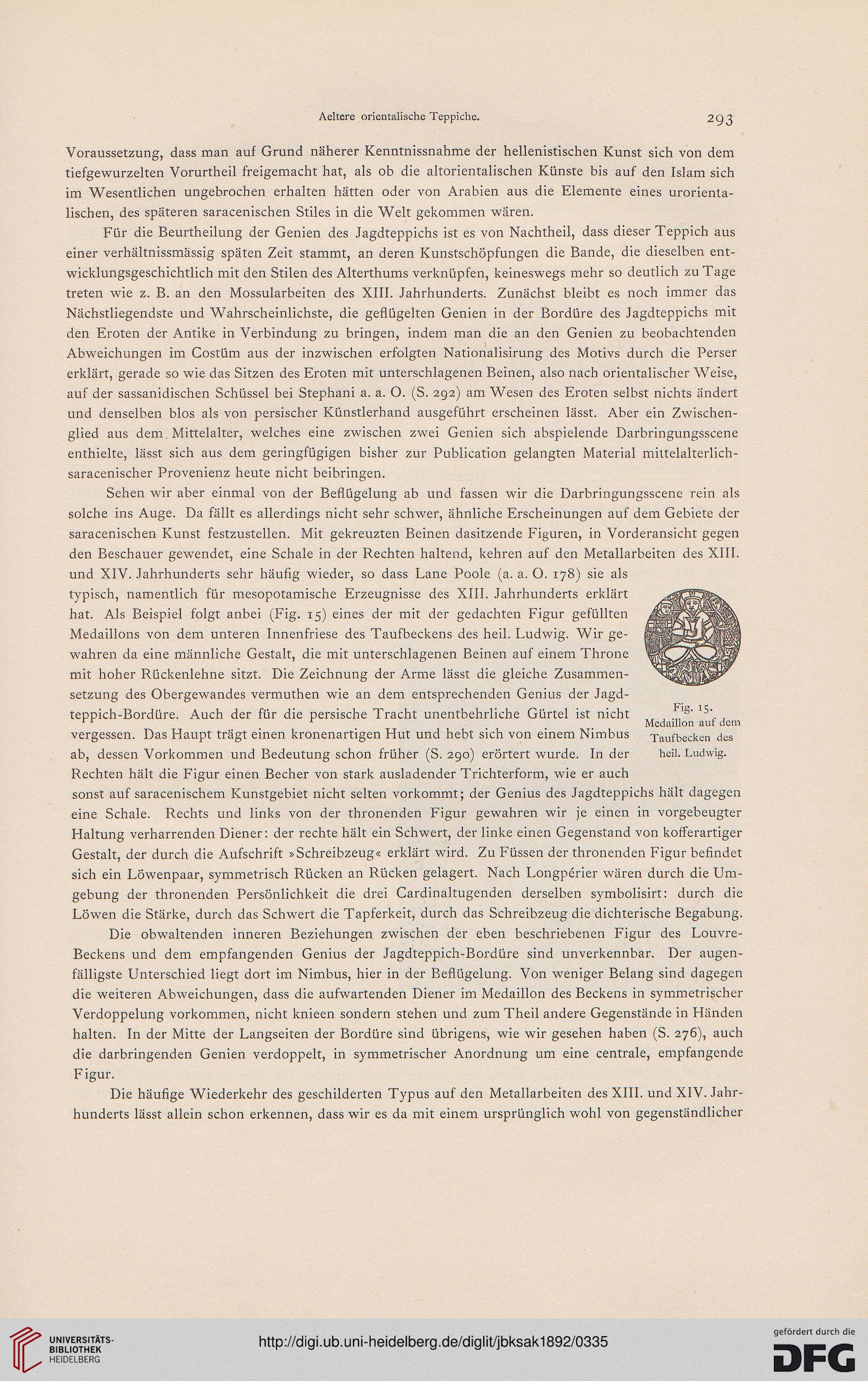Aeltere orientalische Teppiche.
293
Voraussetzung, dass man auf Grund näherer Kenntnissnahme der hellenistischen Kunst sich von dem
tiefgewurzelten Vorurtheil freigemacht hat, als ob die altorientalischen Künste bis auf den Islam sich
im Wesentlichen ungebrochen erhalten hätten oder von Arabien aus die Elemente eines urorienta-
lischen, des späteren saracenischen Stiles in die Welt gekommen wären.
Für die Beurtheilung der Genien des Jagdteppichs ist es von Nachtheil, dass dieser Teppich aus
einer verhältnissmässig späten Zeit stammt, an deren Kunstschöpfungen die Bande, die dieselben ent-
wicklungsgeschichtlich mit den Stilen des Alterthums verknüpfen, keineswegs mehr so deutlich zu Tage
treten wie z. B. an den Mossularbeiten des XIII. Jahrhunderts. Zunächst bleibt es noch immer das
Nächstliegendste und Wahrscheinlichste, die geflügelten Genien in der Bordüre des Jagdteppichs mit
den Eroten der Antike in Verbindung zu bringen, indem man die an den Genien zu beobachtenden
Abweichungen im Costüm aus der inzwischen erfolgten Nationalisirung des Motivs durch die Perser
erklärt, gerade so wie das Sitzen des Eroten mit unterschlagenen Beinen, also nach orientalischer Weise,
auf der sassanidischen Schüssel bei Stephani a. a. O. (S. 292) am Wesen des Eroten selbst nichts ändert
und denselben blos als von persischer Künstlerhand ausgeführt erscheinen lässt. Aber ein Zwischen-
glied aus dem. Mittelalter, welches eine zwischen zwei Genien sich abspielende Darbringungsscene
enthielte, lässt sich aus dem geringfügigen bisher zur Publication gelangten Material mittelalterlich-
saracenischer Provenienz heute nicht beibringen.
Sehen wir aber einmal von der Beflügelung ab und fassen wir die Darbringungsscene rein als
solche ins Auge. Da fällt es allerdings nicht sehr schwer, ähnliche Erscheinungen auf dem Gebiete der
saracenischen Kunst festzustellen. Mit gekreuzten Beinen dasitzende Figuren, in Vorderansicht gegen
den Beschauer gewendet, eine Schale in der Rechten haltend, kehren auf den Metallarbeiten des XIII.
und XIV. Jahrhunderts sehr häufig wieder, so dass Lane Poole (a. a. O. 178) sie als
typisch, namentlich für mesopotamische Erzeugnisse des XIII. Jahrhunderts erklärt
hat. Als Beispiel folgt anbei (Fig. 15) eines der mit der gedachten Figur gefüllten
Medaillons von dem unteren Innenfriese des Taufbeckens des heil. Ludwig. Wir ge-
wahren da eine männliche Gestalt, die mit unterschlagenen Beinen auf einem Throne
mit hoher Rückenlehne sitzt. Die Zeichnung der Arme lässt die gleiche Zusammen-
setzung des Obergewandes vermuthen wie an dem entsprechenden Genius der Jagd-
teppich-Bordüre. Auch der für die persische Tracht unentbehrliche Gürtel ist nicht
rr r Medaillon auf dem
vergessen. Das Haupt trägt einen kronenartigen Hut und hebt sich von einem Nimbus Taufbecken des
ab, dessen Vorkommen und Bedeutung schon früher (S. 290) erörtert wurde. In der heil. Ludwig.
Rechten hält die Figur einen Becher von stark ausladender Trichterform, wie er auch
sonst auf saracenischem Kunstgebiet nicht selten vorkommt; der Genius des Jagdteppichs hält dagegen
eine Schale. Rechts und links von der thronenden Figur gewahren wir je einen in vorgebeugter
Haltung verharrenden Diener: der rechte hält ein Schwert, der linke einen Gegenstand von kofferartiger
Gestalt, der durch die Aufschrift »Schreibzeug« erklärt wird. Zu Füssen der thronenden Figur befindet
sich ein Löwenpaar, symmetrisch Rücken an Rücken gelagert. Nach Longperier wären durch die Um-
gebung der thronenden Persönlichkeit die drei Cardinaltugenden derselben symbolisirt: durch die
Löwen die Stärke, durch das Schwert die Tapferkeit, durch das Schreibzeug die dichterische Begabung.
Die obwaltenden inneren Beziehungen zwischen der eben beschriebenen Figur des Louvre-
Beckens und dem empfangenden Genius der Jagdteppich-Bordüre sind unverkennbar. Der augen-
fälligste Unterschied liegt dort im Nimbus, hier in der Beflügelung. Von weniger Belang sind dagegen
die weiteren Abweichungen, dass die aufwartenden Diener im Medaillon des Beckens in symmetrischer
Verdoppelung vorkommen, nicht knieen sondern stehen und zum Theil andere Gegenstände in Händen
halten. In der Mitte der Langseiten der Bordüre sind übrigens, wie wir gesehen haben (S. 276), auch
die darbringenden Genien verdoppelt, in symmetrischer Anordnung um eine centrale, empfangende
Figur.
Die häufige Wiederkehr des geschilderten Typus auf den Metallarbeiten des XIII. und XIV. Jahr-
hunderts lässt allein schon erkennen, dass wir es da mit einem ursprünglich wohl von gegenständlicher
293
Voraussetzung, dass man auf Grund näherer Kenntnissnahme der hellenistischen Kunst sich von dem
tiefgewurzelten Vorurtheil freigemacht hat, als ob die altorientalischen Künste bis auf den Islam sich
im Wesentlichen ungebrochen erhalten hätten oder von Arabien aus die Elemente eines urorienta-
lischen, des späteren saracenischen Stiles in die Welt gekommen wären.
Für die Beurtheilung der Genien des Jagdteppichs ist es von Nachtheil, dass dieser Teppich aus
einer verhältnissmässig späten Zeit stammt, an deren Kunstschöpfungen die Bande, die dieselben ent-
wicklungsgeschichtlich mit den Stilen des Alterthums verknüpfen, keineswegs mehr so deutlich zu Tage
treten wie z. B. an den Mossularbeiten des XIII. Jahrhunderts. Zunächst bleibt es noch immer das
Nächstliegendste und Wahrscheinlichste, die geflügelten Genien in der Bordüre des Jagdteppichs mit
den Eroten der Antike in Verbindung zu bringen, indem man die an den Genien zu beobachtenden
Abweichungen im Costüm aus der inzwischen erfolgten Nationalisirung des Motivs durch die Perser
erklärt, gerade so wie das Sitzen des Eroten mit unterschlagenen Beinen, also nach orientalischer Weise,
auf der sassanidischen Schüssel bei Stephani a. a. O. (S. 292) am Wesen des Eroten selbst nichts ändert
und denselben blos als von persischer Künstlerhand ausgeführt erscheinen lässt. Aber ein Zwischen-
glied aus dem. Mittelalter, welches eine zwischen zwei Genien sich abspielende Darbringungsscene
enthielte, lässt sich aus dem geringfügigen bisher zur Publication gelangten Material mittelalterlich-
saracenischer Provenienz heute nicht beibringen.
Sehen wir aber einmal von der Beflügelung ab und fassen wir die Darbringungsscene rein als
solche ins Auge. Da fällt es allerdings nicht sehr schwer, ähnliche Erscheinungen auf dem Gebiete der
saracenischen Kunst festzustellen. Mit gekreuzten Beinen dasitzende Figuren, in Vorderansicht gegen
den Beschauer gewendet, eine Schale in der Rechten haltend, kehren auf den Metallarbeiten des XIII.
und XIV. Jahrhunderts sehr häufig wieder, so dass Lane Poole (a. a. O. 178) sie als
typisch, namentlich für mesopotamische Erzeugnisse des XIII. Jahrhunderts erklärt
hat. Als Beispiel folgt anbei (Fig. 15) eines der mit der gedachten Figur gefüllten
Medaillons von dem unteren Innenfriese des Taufbeckens des heil. Ludwig. Wir ge-
wahren da eine männliche Gestalt, die mit unterschlagenen Beinen auf einem Throne
mit hoher Rückenlehne sitzt. Die Zeichnung der Arme lässt die gleiche Zusammen-
setzung des Obergewandes vermuthen wie an dem entsprechenden Genius der Jagd-
teppich-Bordüre. Auch der für die persische Tracht unentbehrliche Gürtel ist nicht
rr r Medaillon auf dem
vergessen. Das Haupt trägt einen kronenartigen Hut und hebt sich von einem Nimbus Taufbecken des
ab, dessen Vorkommen und Bedeutung schon früher (S. 290) erörtert wurde. In der heil. Ludwig.
Rechten hält die Figur einen Becher von stark ausladender Trichterform, wie er auch
sonst auf saracenischem Kunstgebiet nicht selten vorkommt; der Genius des Jagdteppichs hält dagegen
eine Schale. Rechts und links von der thronenden Figur gewahren wir je einen in vorgebeugter
Haltung verharrenden Diener: der rechte hält ein Schwert, der linke einen Gegenstand von kofferartiger
Gestalt, der durch die Aufschrift »Schreibzeug« erklärt wird. Zu Füssen der thronenden Figur befindet
sich ein Löwenpaar, symmetrisch Rücken an Rücken gelagert. Nach Longperier wären durch die Um-
gebung der thronenden Persönlichkeit die drei Cardinaltugenden derselben symbolisirt: durch die
Löwen die Stärke, durch das Schwert die Tapferkeit, durch das Schreibzeug die dichterische Begabung.
Die obwaltenden inneren Beziehungen zwischen der eben beschriebenen Figur des Louvre-
Beckens und dem empfangenden Genius der Jagdteppich-Bordüre sind unverkennbar. Der augen-
fälligste Unterschied liegt dort im Nimbus, hier in der Beflügelung. Von weniger Belang sind dagegen
die weiteren Abweichungen, dass die aufwartenden Diener im Medaillon des Beckens in symmetrischer
Verdoppelung vorkommen, nicht knieen sondern stehen und zum Theil andere Gegenstände in Händen
halten. In der Mitte der Langseiten der Bordüre sind übrigens, wie wir gesehen haben (S. 276), auch
die darbringenden Genien verdoppelt, in symmetrischer Anordnung um eine centrale, empfangende
Figur.
Die häufige Wiederkehr des geschilderten Typus auf den Metallarbeiten des XIII. und XIV. Jahr-
hunderts lässt allein schon erkennen, dass wir es da mit einem ursprünglich wohl von gegenständlicher