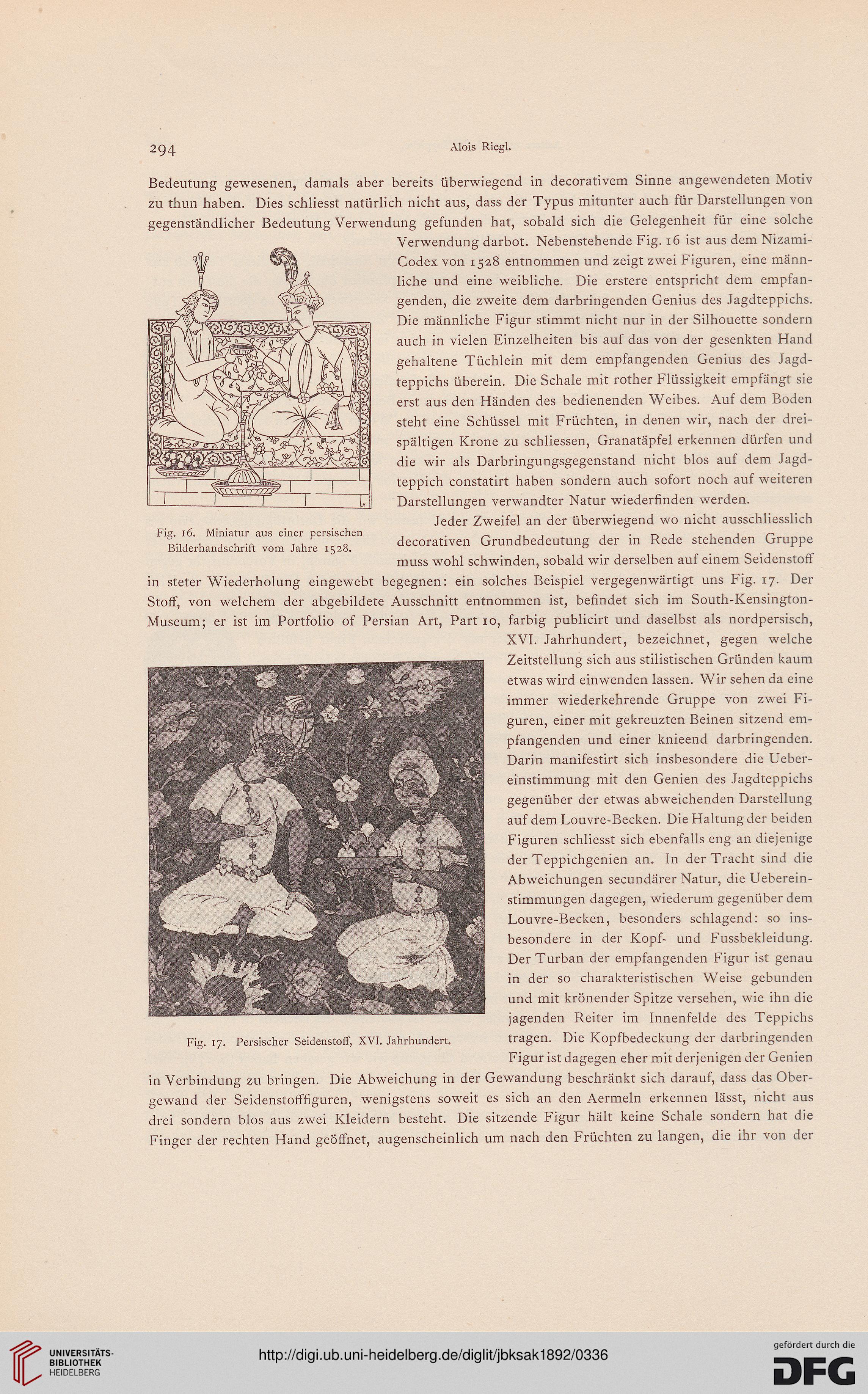294
Alois Riegl.
Fi
16. Miniatur aus einer persischen
Bilderhandschrift vom Jahre 1528.
Bedeutung gewesenen, damals aber bereits überwiegend in decorativem Sinne angewendeten Motiv
zu thun haben. Dies schliesst natürlich nicht aus, dass der Typus mitunter auch für Darstellungen von
gegenständlicher Bedeutung Verwendung gefunden hat, sobald sich die Gelegenheit für eine solche
Verwendung darbot. Nebenstehende Fig. 16 ist aus dem Nizami-
Codex von 1528 entnommen und zeigt zwei Figuren, eine männ-
liche und eine weibliche. Die erstere entspricht dem empfan-
genden, die zweite dem darbringenden Genius des Jagdteppichs.
Die männliche Figur stimmt nicht nur in der Silhouette sondern
auch in vielen Einzelheiten bis auf das von der gesenkten Hand
gehaltene Tüchlein mit dem empfangenden Genius des Jagd-
teppichs überein. Die Schale mit rother Flüssigkeit empfängt sie
erst aus den Händen des bedienenden Weibes. Auf dem Boden
steht eine Schüssel mit Früchten, in denen wir, nach der drei-
spaltigen Krone zu schliessen, Granatäpfel erkennen dürfen und
die wir als Darbringungsgegenstand nicht blos auf dem Jagd-
teppich constatirt haben sondern auch sofort noch auf weiteren
Darstellungen verwandter Natur wiederfinden werden.
Jeder Zweifel an der überwiegend wo nicht ausschliesslich
decorativen Grundbedeutung der in Rede stehenden Gruppe
muss wohl schwinden, sobald wir derselben auf einem Seidenstoff
in steter Wiederholung eingewebt begegnen: ein solches Beispiel vergegenwärtigt uns Fig. 17. Der
Stoff, von welchem der abgebildete Ausschnitt entnommen ist, befindet sich im South-Kensington-
Museum; er ist im Portfolio of Persian Art, Part 10, farbig publicirt und daselbst als nordpersisch,
XVI. Jahrhundert, bezeichnet, gegen welche
Zeitstellung sich aus stilistischen Gründen kaum
etwas wird einwenden lassen. Wir sehen da eine
immer wiederkehrende Gruppe von zwei Fi-
guren, einer mit gekreuzten Beinen sitzend em-
pfangenden und einer knieend darbringenden.
Darin manifestirt sich insbesondere die Ueber-
einstimmung mit den Genien des Jagdteppichs
gegenüber der etwas abweichenden Darstellung
auf dem Louvre-Becken. Die Haltung der beiden
Figuren schliesst sich ebenfalls eng an diejenige
der Teppichgenien an. In der Tracht sind die
Abweichungen secundärer Natur, die Ueberein-
stimmungen dagegen, wiederum gegenüber dem
Louvre-Becken, besonders schlagend: so ins-
besondere in der Kopf- und Fussbekleidung.
Der Turban der empfangenden Figur ist genau
in der so charakteristischen Weise gebunden
und mit krönender Spitze versehen, wie ihn die
jagenden Reiter im Innenfelde des Teppichs
tragen. Die Kopfbedeckung der darbringenden
Figur ist dagegen eher mit derjenigen der Genien
in Verbindung zu bringen. Die Abweichung in der Gewandung beschränkt sich darauf, dass das Ober-
gewand der Seidenstofffiguren, wenigstens soweit es sich an den Aermeln erkennen lässt, nicht aus
drei sondern blos aus zwei Kleidern besteht. Die sitzende Figur hält keine Schale sondern hat die
Finger der rechten Hand geöffnet, augenscheinlich um nach den Früchten zu langen, die ihr von der
Fig. 17. Persischer Seidenstoff, XVI. Jahrhundert.
Alois Riegl.
Fi
16. Miniatur aus einer persischen
Bilderhandschrift vom Jahre 1528.
Bedeutung gewesenen, damals aber bereits überwiegend in decorativem Sinne angewendeten Motiv
zu thun haben. Dies schliesst natürlich nicht aus, dass der Typus mitunter auch für Darstellungen von
gegenständlicher Bedeutung Verwendung gefunden hat, sobald sich die Gelegenheit für eine solche
Verwendung darbot. Nebenstehende Fig. 16 ist aus dem Nizami-
Codex von 1528 entnommen und zeigt zwei Figuren, eine männ-
liche und eine weibliche. Die erstere entspricht dem empfan-
genden, die zweite dem darbringenden Genius des Jagdteppichs.
Die männliche Figur stimmt nicht nur in der Silhouette sondern
auch in vielen Einzelheiten bis auf das von der gesenkten Hand
gehaltene Tüchlein mit dem empfangenden Genius des Jagd-
teppichs überein. Die Schale mit rother Flüssigkeit empfängt sie
erst aus den Händen des bedienenden Weibes. Auf dem Boden
steht eine Schüssel mit Früchten, in denen wir, nach der drei-
spaltigen Krone zu schliessen, Granatäpfel erkennen dürfen und
die wir als Darbringungsgegenstand nicht blos auf dem Jagd-
teppich constatirt haben sondern auch sofort noch auf weiteren
Darstellungen verwandter Natur wiederfinden werden.
Jeder Zweifel an der überwiegend wo nicht ausschliesslich
decorativen Grundbedeutung der in Rede stehenden Gruppe
muss wohl schwinden, sobald wir derselben auf einem Seidenstoff
in steter Wiederholung eingewebt begegnen: ein solches Beispiel vergegenwärtigt uns Fig. 17. Der
Stoff, von welchem der abgebildete Ausschnitt entnommen ist, befindet sich im South-Kensington-
Museum; er ist im Portfolio of Persian Art, Part 10, farbig publicirt und daselbst als nordpersisch,
XVI. Jahrhundert, bezeichnet, gegen welche
Zeitstellung sich aus stilistischen Gründen kaum
etwas wird einwenden lassen. Wir sehen da eine
immer wiederkehrende Gruppe von zwei Fi-
guren, einer mit gekreuzten Beinen sitzend em-
pfangenden und einer knieend darbringenden.
Darin manifestirt sich insbesondere die Ueber-
einstimmung mit den Genien des Jagdteppichs
gegenüber der etwas abweichenden Darstellung
auf dem Louvre-Becken. Die Haltung der beiden
Figuren schliesst sich ebenfalls eng an diejenige
der Teppichgenien an. In der Tracht sind die
Abweichungen secundärer Natur, die Ueberein-
stimmungen dagegen, wiederum gegenüber dem
Louvre-Becken, besonders schlagend: so ins-
besondere in der Kopf- und Fussbekleidung.
Der Turban der empfangenden Figur ist genau
in der so charakteristischen Weise gebunden
und mit krönender Spitze versehen, wie ihn die
jagenden Reiter im Innenfelde des Teppichs
tragen. Die Kopfbedeckung der darbringenden
Figur ist dagegen eher mit derjenigen der Genien
in Verbindung zu bringen. Die Abweichung in der Gewandung beschränkt sich darauf, dass das Ober-
gewand der Seidenstofffiguren, wenigstens soweit es sich an den Aermeln erkennen lässt, nicht aus
drei sondern blos aus zwei Kleidern besteht. Die sitzende Figur hält keine Schale sondern hat die
Finger der rechten Hand geöffnet, augenscheinlich um nach den Früchten zu langen, die ihr von der
Fig. 17. Persischer Seidenstoff, XVI. Jahrhundert.