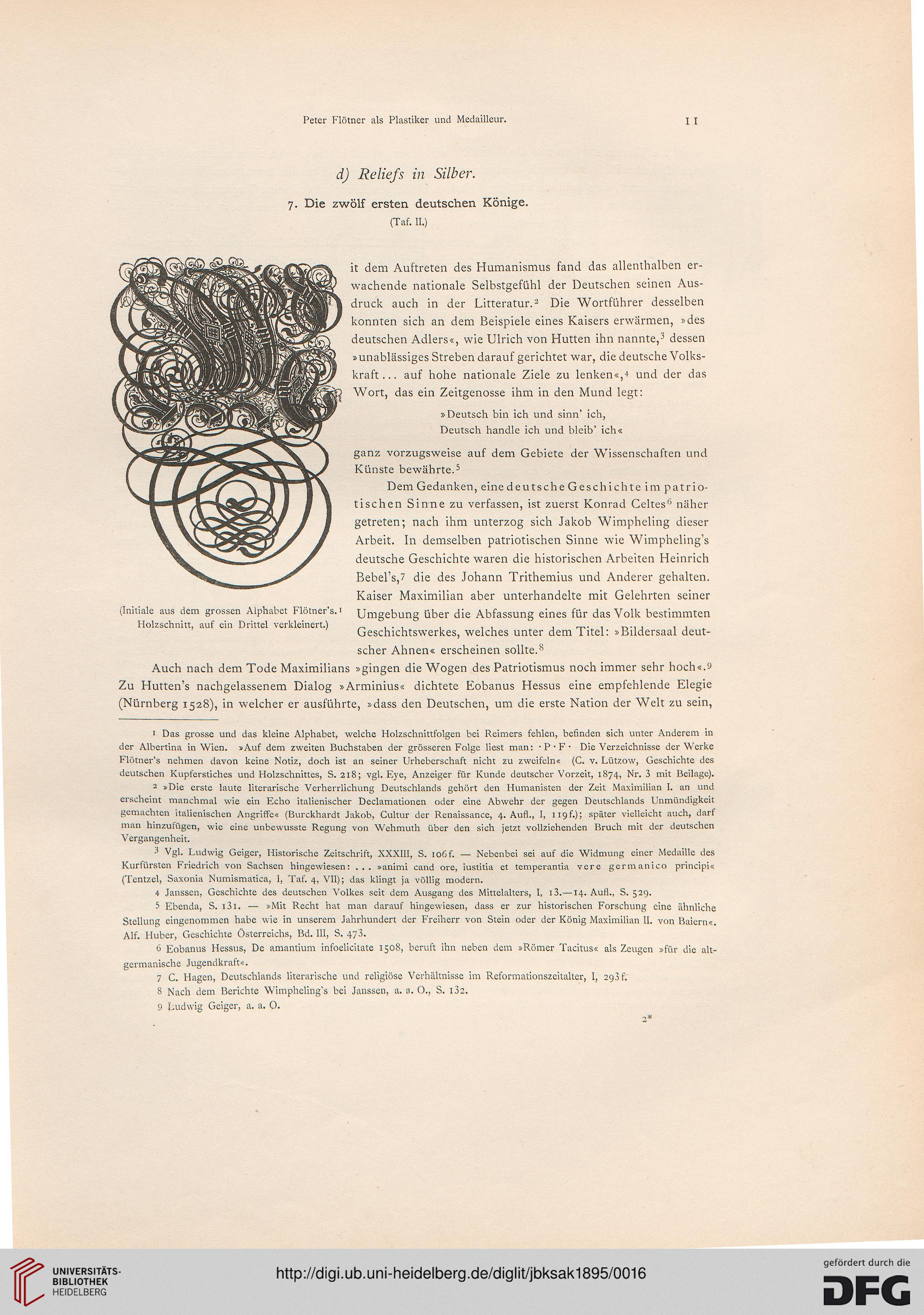Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.
d) Reliefs in Silber.
7. Die zwölf ersten deutschen Könige.
(Taf. II.)
it dem Auftreten des Humanismus fand das allenthalben er-
wachende nationale Selbstgefühl der Deutschen seinen Aus-
druck auch in der Litteratur.2 Die Wortführer desselben
konnten sich an dem Beispiele eines Kaisers erwärmen, »des
deutschen Adlers«, wie Ulrich von Hutten ihn nannte,3 dessen
»unablässiges Streben darauf gerichtet war, die deutsche Volks-
kraft... auf hohe nationale Ziele zu lenken«,•* und der das
Wort, das ein Zeitgenosse ihm in den Mund legt:
»Deutsch bin ich und sinn' ich,
Deutsch handle ich und bleib' ich«
ganz vorzugsweise auf dem Gebiete der Wissenschaften und
Künste bewährte.5
Dem Gedanken, eine deutsche Geschichte im patrio-
tischen Sinne zu verfassen, ist zuerst Konrad Celtes6 näher
getreten; nach ihm unterzog sich Jakob Wimpheling dieser
Arbeit. In demselben patriotischen Sinne wie Wimpheling's
deutsche Geschichte waren die historischen Arbeiten Heinrich
Bebel's,7 die des Johann Trithemius und Anderer gehalten.
Kaiser Maximilian aber unterhandelte mit Gelehrten seiner
Umgebung über die Abfassung eines für das Volk bestimmten
Geschichtswerkes, welches unter dem Titel: »Bildersaal deut-
scher Ahnen« erscheinen sollte.8
Auch nach dem Tode Maximilians »gingen die Wogen des Patriotismus noch immer sehr hoch«.9
Zu Hutten's nachgelassenem Dialog »Arminius« dichtete Eobanus Hessus eine empfehlende Elegie
(Nürnberg 1528), in welcher er ausführte, »dass den Deutschen, um die erste Nation der Welt zu sein,
(Initiale aus dem grossen Alphabet Flötner's. 1
Holzschnitt, auf ein Drittel verkleinert.)
1 Das grosse und das kleine Alphabet, welche Holzschnittfolgen bei Reimers fehlen, befinden sich unter Anderem in
der Albertina in Wien. »Auf dem zweiten Buchstaben der grösseren Folge liest man: - P-F- Die Verzeichnisse der Werke
Flötner's nehmen davon keine Notiz, doch ist an seiner Urheberschaft nicht zu zweifeln« (C. v. Lützow, Geschichte des
deutschen Kupferstiches und Holzschnittes, S. 218; vgl. Eye, Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit, 1874, Nr. 3 mit Beilage).
2 »Die erste laute literarische Verherrlichung Deutschlands gehört den Humanisten der Zeit Maximilian I. an und
erscheint manchmal wie ein Echo italienischer Declamationen oder eine Abwehr der gegen Deutschlands Unmündigkeit
gemachten italienischen Angriffe« (Burckhardt Jakob, Cultur der Renaissance, 4. Aufl., I, 119f.); später vielleicht auch, darf
man hinzufügen, wie eine unbewusste Regung von Wehmuth über den sich jetzt vollziehenden Bruch mit der deutschen
Vergangenheit.
3 Vgl. Ludwig Geiger, Historische Zeitschrift, XXXIII, S. 106 f. — Nebenbei sei auf die Widmung einer Medaille des
Kurfürsten Friedrich von Sachsen hingewiesen: . . . »animi cand ore, iustitia et temperantia vere germanico prineipi«
(Tentzel, Saxonia Numismatica, I, Taf. 4, VII); das klingt ja völlig modern.
4 Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, I, l3.—14. Aufl., S. 529.
5 Ebenda, S. i3i. — »Mit Recht hat man darauf hingewiesen, dass er zur historischen Forschung eine ähnliche
Stellung eingenommen habe wie in unserem Jahrhundert der Freiherr von Stein oder der König Maximilian II. von Baiern«.
Alf. Huber, Geschichte Österreichs, Bd. III, S. 4/3.
6 Eobanus Hessus, De amantium infoelicitate 1508, beruft ihn neben dem »Römer Tacitus« als Zeugen »für die alt-
germanische Jugendkraft«.
7 C. Hagen, Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im Rcformationszcitalter, I, 293 f.
8 Nach dem Berichte Wimpheling's bei Janssen, a. a. ()., S. ij2.
9 Ludwig Geiger, a. a. 0.
2*
d) Reliefs in Silber.
7. Die zwölf ersten deutschen Könige.
(Taf. II.)
it dem Auftreten des Humanismus fand das allenthalben er-
wachende nationale Selbstgefühl der Deutschen seinen Aus-
druck auch in der Litteratur.2 Die Wortführer desselben
konnten sich an dem Beispiele eines Kaisers erwärmen, »des
deutschen Adlers«, wie Ulrich von Hutten ihn nannte,3 dessen
»unablässiges Streben darauf gerichtet war, die deutsche Volks-
kraft... auf hohe nationale Ziele zu lenken«,•* und der das
Wort, das ein Zeitgenosse ihm in den Mund legt:
»Deutsch bin ich und sinn' ich,
Deutsch handle ich und bleib' ich«
ganz vorzugsweise auf dem Gebiete der Wissenschaften und
Künste bewährte.5
Dem Gedanken, eine deutsche Geschichte im patrio-
tischen Sinne zu verfassen, ist zuerst Konrad Celtes6 näher
getreten; nach ihm unterzog sich Jakob Wimpheling dieser
Arbeit. In demselben patriotischen Sinne wie Wimpheling's
deutsche Geschichte waren die historischen Arbeiten Heinrich
Bebel's,7 die des Johann Trithemius und Anderer gehalten.
Kaiser Maximilian aber unterhandelte mit Gelehrten seiner
Umgebung über die Abfassung eines für das Volk bestimmten
Geschichtswerkes, welches unter dem Titel: »Bildersaal deut-
scher Ahnen« erscheinen sollte.8
Auch nach dem Tode Maximilians »gingen die Wogen des Patriotismus noch immer sehr hoch«.9
Zu Hutten's nachgelassenem Dialog »Arminius« dichtete Eobanus Hessus eine empfehlende Elegie
(Nürnberg 1528), in welcher er ausführte, »dass den Deutschen, um die erste Nation der Welt zu sein,
(Initiale aus dem grossen Alphabet Flötner's. 1
Holzschnitt, auf ein Drittel verkleinert.)
1 Das grosse und das kleine Alphabet, welche Holzschnittfolgen bei Reimers fehlen, befinden sich unter Anderem in
der Albertina in Wien. »Auf dem zweiten Buchstaben der grösseren Folge liest man: - P-F- Die Verzeichnisse der Werke
Flötner's nehmen davon keine Notiz, doch ist an seiner Urheberschaft nicht zu zweifeln« (C. v. Lützow, Geschichte des
deutschen Kupferstiches und Holzschnittes, S. 218; vgl. Eye, Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit, 1874, Nr. 3 mit Beilage).
2 »Die erste laute literarische Verherrlichung Deutschlands gehört den Humanisten der Zeit Maximilian I. an und
erscheint manchmal wie ein Echo italienischer Declamationen oder eine Abwehr der gegen Deutschlands Unmündigkeit
gemachten italienischen Angriffe« (Burckhardt Jakob, Cultur der Renaissance, 4. Aufl., I, 119f.); später vielleicht auch, darf
man hinzufügen, wie eine unbewusste Regung von Wehmuth über den sich jetzt vollziehenden Bruch mit der deutschen
Vergangenheit.
3 Vgl. Ludwig Geiger, Historische Zeitschrift, XXXIII, S. 106 f. — Nebenbei sei auf die Widmung einer Medaille des
Kurfürsten Friedrich von Sachsen hingewiesen: . . . »animi cand ore, iustitia et temperantia vere germanico prineipi«
(Tentzel, Saxonia Numismatica, I, Taf. 4, VII); das klingt ja völlig modern.
4 Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, I, l3.—14. Aufl., S. 529.
5 Ebenda, S. i3i. — »Mit Recht hat man darauf hingewiesen, dass er zur historischen Forschung eine ähnliche
Stellung eingenommen habe wie in unserem Jahrhundert der Freiherr von Stein oder der König Maximilian II. von Baiern«.
Alf. Huber, Geschichte Österreichs, Bd. III, S. 4/3.
6 Eobanus Hessus, De amantium infoelicitate 1508, beruft ihn neben dem »Römer Tacitus« als Zeugen »für die alt-
germanische Jugendkraft«.
7 C. Hagen, Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im Rcformationszcitalter, I, 293 f.
8 Nach dem Berichte Wimpheling's bei Janssen, a. a. ()., S. ij2.
9 Ludwig Geiger, a. a. 0.
2*