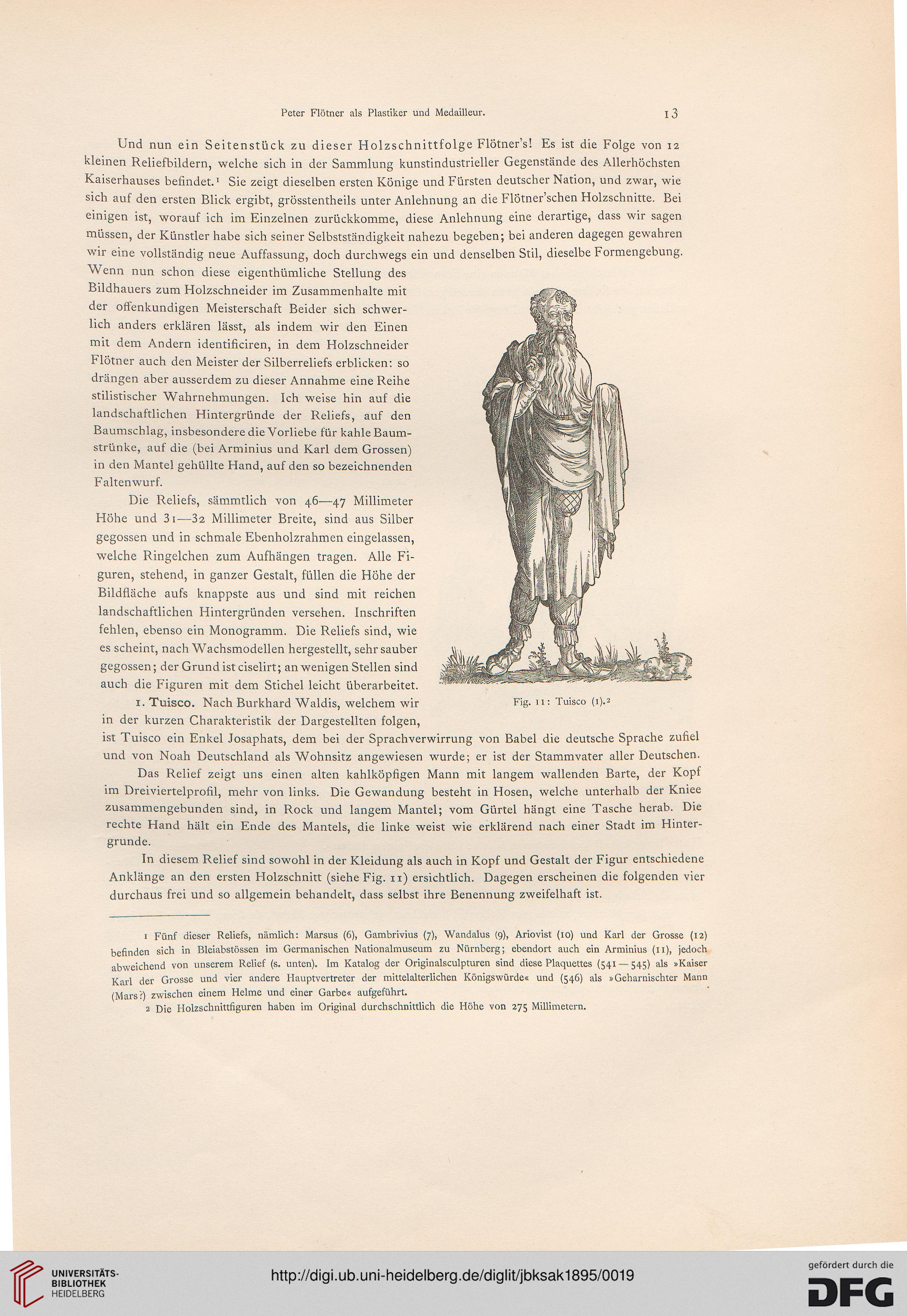Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.
i3
Und nun ein Seitenstück zu dieser Holzschnittfolge Flötner's! Es ist die Folge von 12
kleinen Reliefbildern, welche sich in der Sammlung kunstindustrieller Gegenstände des Allerhöchsten
Kaiserhauses befindet.1 Sie zeigt dieselben ersten Könige und Fürsten deutscher Nation, und zwar, wie
sich auf den ersten Blick ergibt, grösstentheils unter Anlehnung an die Flötner'schen Holzschnitte. Bei
einigen ist, worauf ich im Einzelnen zurückkomme, diese Anlehnung eine derartige, dass wir sagen
müssen, der Künstler habe sich seiner Selbstständigkeit nahezu begeben; bei anderen dagegen gewahren
wir eine vollständig neue Auffassung, doch durchwegs ein und denselben Stil, dieselbe Formengebung.
Wenn nun schon diese eigenthümliche Stellung des
Bildhauers zum Holzschneider im Zusammenhalte mit
der offenkundigen Meisterschaft Beider sich schwer-
lich anders erklären lässt, als indem wir den Einen
mit dem Andern identificiren, in dem Holzschneider
Flötner auch den Meister der Silberreliefs erblicken: so
drängen aber ausserdem zu dieser Annahme eine Reihe
stilistischer Wahrnehmungen. Ich weise hin auf die
landschaftlichen Hintergründe der Reliefs, auf den
Baumschlag, insbesondere die Vorliebe für kahle Baum-
strünke, auf die (bei Arminius und Karl dem Grossen)
in den Mantel gehüllte Hand, auf den so bezeichnenden
Faltenwurf.
Die Reliefs, sämmtlich von 46—47 Millimeter
Höhe und 3i—32 Millimeter Breite, sind aus Silber
gegossen und in schmale Ebenholzrahmen eingelassen,
welche Ringelchen zum Aufhängen tragen. Alle Fi-
guren, stehend, in ganzer Gestalt, füllen die Höhe der
Bildfläche aufs knappste aus und sind mit reichen
landschaftlichen Hintergründen versehen. Inschriften
fehlen, ebenso ein Monogramm. Die Reliefs sind, wie
es scheint, nach Wachsmodellen hergestellt, sehr sauber
gegossen; der Grund ist ciselirt; an wenigen Stellen sind
auch die Figuren mit dem Stichel leicht überarbeitet.
1. Tuisco. Nach Burkhard Waldis, welchem wir Fig. 11: Tuisco
in der kurzen Charakteristik der Dargestellten folgen,
ist Tuisco ein Enkel Josaphats, dem bei der Sprachverwirrung von Babel die deutsche Sprache zufiel
und von Noah Deutschland als "Wohnsitz angewiesen wurde; er ist der Stammvater aller Deutschen.
Das Relief zeigt uns einen alten kahlköpfigen Mann mit langem wallenden Barte, der Kopf
im Dreiviertelprofil, mehr von links. Die Gewandung besteht in Hosen, welche unterhalb der Kniee
zusammengebunden sind, in Rock und langem Mantel; vom Gürtel hängt eine Tasche herab. Die
rechte Hand hält ein Ende des Mantels, die linke weist wie erklärend nach einer Stadt im Hinter-
grunde.
In diesem Relief sind sowohl in der Kleidung als auch in Kopf und Gestalt der Figur entschiedene
Anklänge an den ersten Holzschnitt (siehe Fig. 11) ersichtlich. Dagegen erscheinen die folgenden vier
durchaus frei und so allgemein behandelt, dass selbst ihre Benennung zweifelhaft ist.
1 Fünf dieser Reliefs, nämlich: Marsus (6), Gambrivius (7), Wandalus (9), Ariovist (10) und Karl der Grosse (12)
befinden sich in Bleiabstössen im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg; ebcndort auch ein Arminius (11), jedoch
abweichend von unserem Relief (s. unten). Im Katalog der Originalsculpturen sind diese Plaquettes (541 — 545) als »Kaiser
Karl der Grosse und vier andere Hauptvertreter der mittelalterlichen Königswürde« und (546) als »Geharnischter Mann
(Mars?) zwischen einem Helme und einer Garbe« aufgeführt.
2 Die Holzschnittfiguren haben im Original durchschnittlich die Höhe von 275 Millimetern.
i3
Und nun ein Seitenstück zu dieser Holzschnittfolge Flötner's! Es ist die Folge von 12
kleinen Reliefbildern, welche sich in der Sammlung kunstindustrieller Gegenstände des Allerhöchsten
Kaiserhauses befindet.1 Sie zeigt dieselben ersten Könige und Fürsten deutscher Nation, und zwar, wie
sich auf den ersten Blick ergibt, grösstentheils unter Anlehnung an die Flötner'schen Holzschnitte. Bei
einigen ist, worauf ich im Einzelnen zurückkomme, diese Anlehnung eine derartige, dass wir sagen
müssen, der Künstler habe sich seiner Selbstständigkeit nahezu begeben; bei anderen dagegen gewahren
wir eine vollständig neue Auffassung, doch durchwegs ein und denselben Stil, dieselbe Formengebung.
Wenn nun schon diese eigenthümliche Stellung des
Bildhauers zum Holzschneider im Zusammenhalte mit
der offenkundigen Meisterschaft Beider sich schwer-
lich anders erklären lässt, als indem wir den Einen
mit dem Andern identificiren, in dem Holzschneider
Flötner auch den Meister der Silberreliefs erblicken: so
drängen aber ausserdem zu dieser Annahme eine Reihe
stilistischer Wahrnehmungen. Ich weise hin auf die
landschaftlichen Hintergründe der Reliefs, auf den
Baumschlag, insbesondere die Vorliebe für kahle Baum-
strünke, auf die (bei Arminius und Karl dem Grossen)
in den Mantel gehüllte Hand, auf den so bezeichnenden
Faltenwurf.
Die Reliefs, sämmtlich von 46—47 Millimeter
Höhe und 3i—32 Millimeter Breite, sind aus Silber
gegossen und in schmale Ebenholzrahmen eingelassen,
welche Ringelchen zum Aufhängen tragen. Alle Fi-
guren, stehend, in ganzer Gestalt, füllen die Höhe der
Bildfläche aufs knappste aus und sind mit reichen
landschaftlichen Hintergründen versehen. Inschriften
fehlen, ebenso ein Monogramm. Die Reliefs sind, wie
es scheint, nach Wachsmodellen hergestellt, sehr sauber
gegossen; der Grund ist ciselirt; an wenigen Stellen sind
auch die Figuren mit dem Stichel leicht überarbeitet.
1. Tuisco. Nach Burkhard Waldis, welchem wir Fig. 11: Tuisco
in der kurzen Charakteristik der Dargestellten folgen,
ist Tuisco ein Enkel Josaphats, dem bei der Sprachverwirrung von Babel die deutsche Sprache zufiel
und von Noah Deutschland als "Wohnsitz angewiesen wurde; er ist der Stammvater aller Deutschen.
Das Relief zeigt uns einen alten kahlköpfigen Mann mit langem wallenden Barte, der Kopf
im Dreiviertelprofil, mehr von links. Die Gewandung besteht in Hosen, welche unterhalb der Kniee
zusammengebunden sind, in Rock und langem Mantel; vom Gürtel hängt eine Tasche herab. Die
rechte Hand hält ein Ende des Mantels, die linke weist wie erklärend nach einer Stadt im Hinter-
grunde.
In diesem Relief sind sowohl in der Kleidung als auch in Kopf und Gestalt der Figur entschiedene
Anklänge an den ersten Holzschnitt (siehe Fig. 11) ersichtlich. Dagegen erscheinen die folgenden vier
durchaus frei und so allgemein behandelt, dass selbst ihre Benennung zweifelhaft ist.
1 Fünf dieser Reliefs, nämlich: Marsus (6), Gambrivius (7), Wandalus (9), Ariovist (10) und Karl der Grosse (12)
befinden sich in Bleiabstössen im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg; ebcndort auch ein Arminius (11), jedoch
abweichend von unserem Relief (s. unten). Im Katalog der Originalsculpturen sind diese Plaquettes (541 — 545) als »Kaiser
Karl der Grosse und vier andere Hauptvertreter der mittelalterlichen Königswürde« und (546) als »Geharnischter Mann
(Mars?) zwischen einem Helme und einer Garbe« aufgeführt.
2 Die Holzschnittfiguren haben im Original durchschnittlich die Höhe von 275 Millimetern.