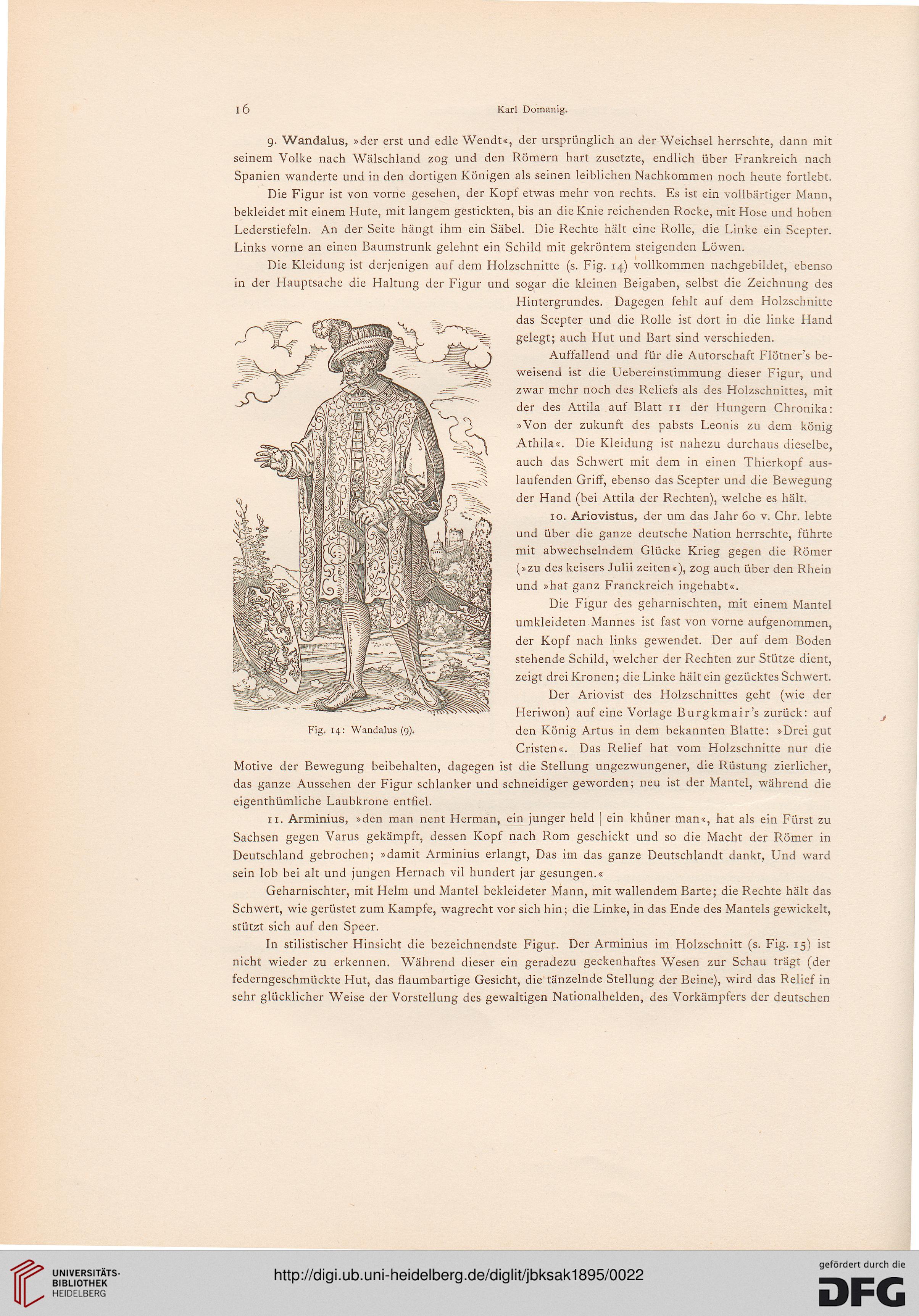i6
Karl Domanig.
9. Wandalus, »der erst und edle Wendt«, der ursprünglich an der Weichsel herrschte, dann mit
seinem Volke nach Wälschland zog und den Römern hart zusetzte, endlich über Frankreich nach
Spanien wanderte und in den dortigen Königen als seinen leiblichen Nachkommen noch heute fortlebt.
Die Figur ist von vorne gesehen, der Kopf etwas mehr von rechts. Es ist ein vollbärtiger Mann,
bekleidet mit einem Hute, mit langem gestickten, bis an die Knie reichenden Rocke, mit Hose und hohen
Lederstiefeln. An der Seite hängt ihm ein Säbel. Die Rechte hält eine Rolle, die Linke ein Scepter.
Links vorne an einen Baumstrunk gelehnt ein Schild mit gekröntem steigenden Löwen.
Die Kleidung ist derjenigen auf dem Holzschnitte (s. Fig. 14) vollkommen nachgebildet, ebenso
in der Hauptsache die Haltung der Figur und sogar die kleinen Beigaben, selbst die Zeichnung des
Hintergrundes. Dagegen fehlt auf dem Holzschnitte
das Scepter und die Rolle ist dort in die linke Hand
gelegt; auch Hut und Bart sind verschieden.
Auffallend und für die Autorschaft Flötner's be-
weisend ist die Uebereinstimmung dieser Figur, und
zwar mehr noch des Reliefs als des Holzschnittes, mit
der des Attila auf Blatt 11 der Hungern Chronika:
»Von der zukunft des pabsts Leonis zu dem könig
Athila«. Die Kleidung ist nahezu durchaus dieselbe,
auch das Schwert mit dem in einen Thierkopf aus-
laufenden Griff, ebenso das Scepter und die Bewegung
der Hand (bei Attila der Rechten), welche es hält.
10. Ariovistus, der um das Jahr 60 v. Chr. lebte
und über die ganze deutsche Nation herrschte, führte
mit abwechselndem Glücke Krieg gegen die Römer
(»zu des keisers Julii zeiten«), zog auch über den Rhein
und »hat ganz Franckreich ingehabt«.
Die Figur des geharnischten, mit einem Mantel
umkleideten Mannes ist fast von vorne aufgenommen,
der Kopf nach links gewendet. Der auf dem Boden
stehende Schild, welcher der Rechten zur Stütze dient,
zeigt drei Kronen; die Linke hält ein gezücktes Schwert.
Der Ariovist des Holzschnittes geht (wie der
Heriwon) auf eine Vorlage Burgkmair's zurück: auf
den König Artus in dem bekannten Blatte: »Drei gut
Cristen«. Das Relief hat vom Holzschnitte nur die
Motive der Bewegung beibehalten, dagegen ist die Stellung ungezwungener, die Rüstung zierlicher,
das ganze Aussehen der Figur schlanker und schneidiger geworden; neu ist der Mantel, während die
eigenthümliche Laubkrone entfiel.
11. Arminius, »den man nent Herman, ein junger held | ein khüner man«, hat als ein Fürst zu
Sachsen gegen Varus gekämpft, dessen Kopf nach Rom geschickt und so die Macht der Römer in
Deutschland gebrochen; »damit Arminius erlangt, Das im das ganze Deutschlandt dankt, Und ward
sein lob bei alt und jungen Hernach vil hundert jar gesungen.«
Geharnischter, mit Helm und Mantel bekleideter Mann, mit wallendem Barte; die Rechte hält das
Schwert, wie gerüstet zum Kampfe, wagrecht vor sich hin; die Linke, in das Ende des Mantels gewickelt,
stützt sich auf den Speer.
In stilistischer Hinsicht die bezeichnendste Figur. Der Arminius im Holzschnitt (s. Fig. 15) ist
nicht wieder zu erkennen. Während dieser ein geradezu geckenhaftes Wesen zur Schau trägt (der
federngeschmückte Hut, das flaumbartige Gesicht, die tänzelnde Stellung der Beine), wird das Relief in
sehr glücklicher Weise der Vorstellung des gewaltigen Nationalhelden, des Vorkämpfers der deutschen
Fig. 14: Wandalus (9).
Karl Domanig.
9. Wandalus, »der erst und edle Wendt«, der ursprünglich an der Weichsel herrschte, dann mit
seinem Volke nach Wälschland zog und den Römern hart zusetzte, endlich über Frankreich nach
Spanien wanderte und in den dortigen Königen als seinen leiblichen Nachkommen noch heute fortlebt.
Die Figur ist von vorne gesehen, der Kopf etwas mehr von rechts. Es ist ein vollbärtiger Mann,
bekleidet mit einem Hute, mit langem gestickten, bis an die Knie reichenden Rocke, mit Hose und hohen
Lederstiefeln. An der Seite hängt ihm ein Säbel. Die Rechte hält eine Rolle, die Linke ein Scepter.
Links vorne an einen Baumstrunk gelehnt ein Schild mit gekröntem steigenden Löwen.
Die Kleidung ist derjenigen auf dem Holzschnitte (s. Fig. 14) vollkommen nachgebildet, ebenso
in der Hauptsache die Haltung der Figur und sogar die kleinen Beigaben, selbst die Zeichnung des
Hintergrundes. Dagegen fehlt auf dem Holzschnitte
das Scepter und die Rolle ist dort in die linke Hand
gelegt; auch Hut und Bart sind verschieden.
Auffallend und für die Autorschaft Flötner's be-
weisend ist die Uebereinstimmung dieser Figur, und
zwar mehr noch des Reliefs als des Holzschnittes, mit
der des Attila auf Blatt 11 der Hungern Chronika:
»Von der zukunft des pabsts Leonis zu dem könig
Athila«. Die Kleidung ist nahezu durchaus dieselbe,
auch das Schwert mit dem in einen Thierkopf aus-
laufenden Griff, ebenso das Scepter und die Bewegung
der Hand (bei Attila der Rechten), welche es hält.
10. Ariovistus, der um das Jahr 60 v. Chr. lebte
und über die ganze deutsche Nation herrschte, führte
mit abwechselndem Glücke Krieg gegen die Römer
(»zu des keisers Julii zeiten«), zog auch über den Rhein
und »hat ganz Franckreich ingehabt«.
Die Figur des geharnischten, mit einem Mantel
umkleideten Mannes ist fast von vorne aufgenommen,
der Kopf nach links gewendet. Der auf dem Boden
stehende Schild, welcher der Rechten zur Stütze dient,
zeigt drei Kronen; die Linke hält ein gezücktes Schwert.
Der Ariovist des Holzschnittes geht (wie der
Heriwon) auf eine Vorlage Burgkmair's zurück: auf
den König Artus in dem bekannten Blatte: »Drei gut
Cristen«. Das Relief hat vom Holzschnitte nur die
Motive der Bewegung beibehalten, dagegen ist die Stellung ungezwungener, die Rüstung zierlicher,
das ganze Aussehen der Figur schlanker und schneidiger geworden; neu ist der Mantel, während die
eigenthümliche Laubkrone entfiel.
11. Arminius, »den man nent Herman, ein junger held | ein khüner man«, hat als ein Fürst zu
Sachsen gegen Varus gekämpft, dessen Kopf nach Rom geschickt und so die Macht der Römer in
Deutschland gebrochen; »damit Arminius erlangt, Das im das ganze Deutschlandt dankt, Und ward
sein lob bei alt und jungen Hernach vil hundert jar gesungen.«
Geharnischter, mit Helm und Mantel bekleideter Mann, mit wallendem Barte; die Rechte hält das
Schwert, wie gerüstet zum Kampfe, wagrecht vor sich hin; die Linke, in das Ende des Mantels gewickelt,
stützt sich auf den Speer.
In stilistischer Hinsicht die bezeichnendste Figur. Der Arminius im Holzschnitt (s. Fig. 15) ist
nicht wieder zu erkennen. Während dieser ein geradezu geckenhaftes Wesen zur Schau trägt (der
federngeschmückte Hut, das flaumbartige Gesicht, die tänzelnde Stellung der Beine), wird das Relief in
sehr glücklicher Weise der Vorstellung des gewaltigen Nationalhelden, des Vorkämpfers der deutschen
Fig. 14: Wandalus (9).