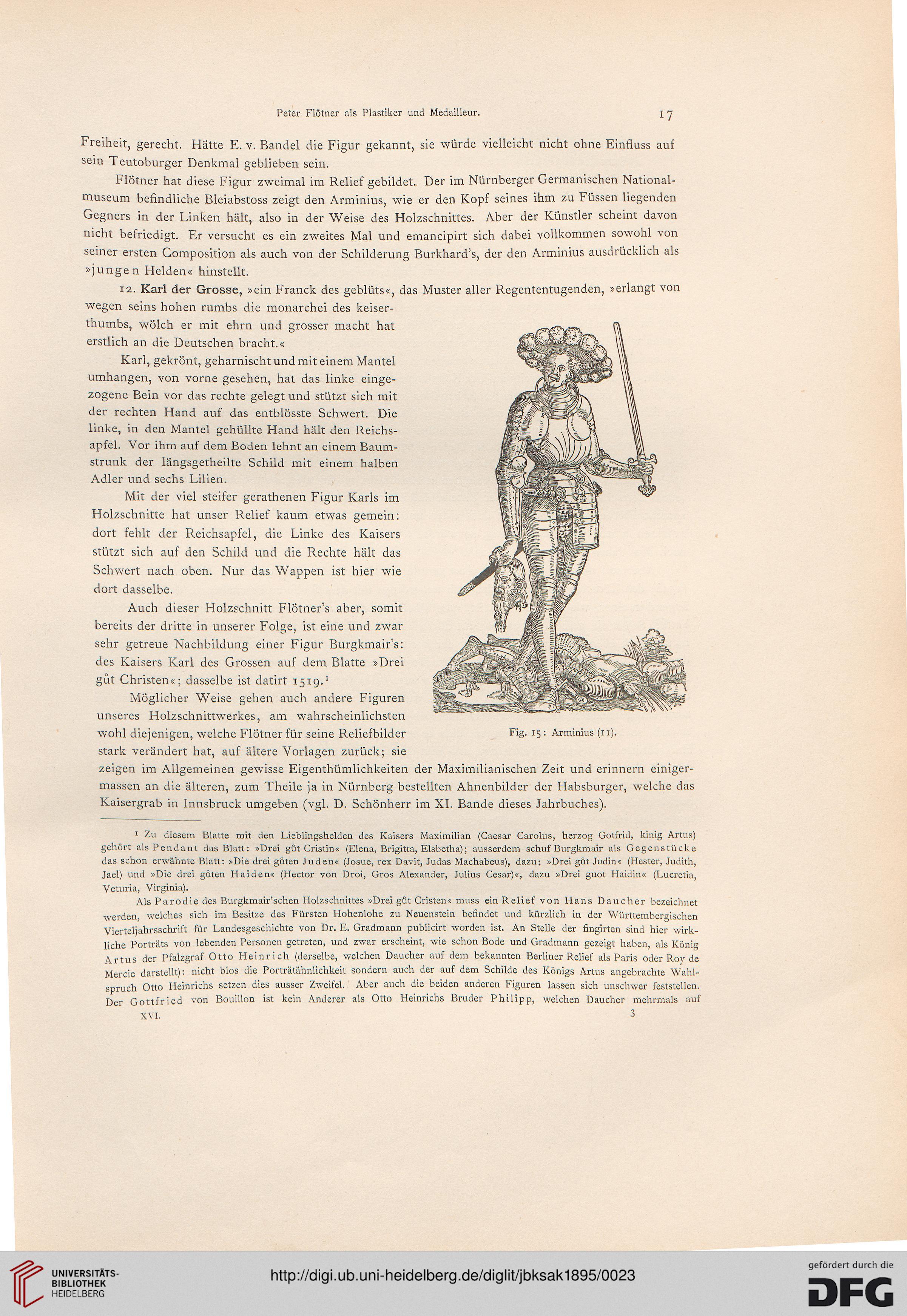Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.
17
Freiheit, gerecht. Hätte E. v. Bändel die Figur gekannt, sie würde vielleicht nicht ohne Einfiuss auf
sein Teutoburger Denkmal geblieben sein.
Flötner hat diese Figur zweimal im Relief gebildet. Der im Nürnberger Germanischen National-
museum befindliche Bleiabstoss zeigt den Arminius, wie er den Kopf seines ihm zu Füssen liegenden
Gegners in der Linken hält, also in der Weise des Holzschnittes. Aber der Künstler scheint davon
nicht befriedigt. Er versucht es ein zweites Mal und emancipirt sich dabei vollkommen sowohl von
seiner ersten Composition als auch von der Schilderung Burkharde, der den Arminius ausdrücklich als
»jungen Helden« hinstellt.
12. Karl der Grosse, »ein Franck des geblüts«, das Muster aller Regententugenden, »erlangt von
wegen seins hohen rumbs die monarchei des keiser-
thumbs, wölch er mit ehrn und grosser macht hat
erstlich an die Deutschen bracht.«
Karl, gekrönt, geharnischt und mit einem Mantel
umhangen, von vorne gesehen, hat das linke einge-
zogene Bein vor das rechte gelegt und stützt sich mit
der rechten Hand auf das entblösste Schwert. Die
linke, in den Mantel gehüllte Hand hält den Reichs-
apfel. Vor ihm auf dem Boden lehnt an einem Baum-
strunk der längsgetheilte Schild mit einem halben
Adler und sechs Lilien.
Mit der viel steifer gerathenen Figur Karls im
Holzschnitte hat unser Relief kaum etwas gemein:
dort fehlt der Reichsapfel, die Linke des Kaisers
stützt sich auf den Schild und die Rechte hält das
Schwert nach oben. Nur das Wappen ist hier wie
dort dasselbe.
Auch dieser Holzschnitt Flötner's aber, somit
bereits der dritte in unserer Folge, ist eine und zwar
sehr getreue Nachbildung einer Figur Burgkmair's:
des Kaisers Karl des Grossen auf dem Blatte »Drei
güt Christen«; dasselbe ist datirt 1519.1
Möglicher Weise gehen auch andere Figuren
unseres Holzschnittwerkes, am wahrscheinlichsten
wohl diejenigen, welche Flötner für seine Reliefbilder Fig- 15 : Arminius (11).
stark verändert hat, auf ältere Vorlagen zurück; sie
zeigen im Allgemeinen gewisse Eigenthümlichkeiten der Maximilianischen Zeit und erinnern einiger-
massen an die älteren, zum Theile ja in Nürnberg bestellten Ahnenbilder der Habsburger, welche das
Kaisergrab in Innsbruck umgeben (vgl. D. Schönherr im XI. Bande dieses Jahrbuches).
1 Zu diesem Blatte mit den I.ieblingshcldcn des Kaisers Maximilian (Caesar Carolus, herzog Gotfrid, kinig Artus)
gehört als Pendant das Blatt: »Drei güt Cristin« (Elena, Brigitta, Elsbetha); ausserdem schuf Burgkmair als Gegenstücke
das schon erwähnte Blatt: »Die drei güten Juden« (Josue, rex Davit, Judas Machabeus), dazu: »Drei güt Judin« (Hcster, Judith,
Jael) und »Die drei güten Haiden« (Hector von Droi, Gros Alexander, Julius Cesar)«, dazu »Drei guot Haidin« (Lucretia,
Veturia, Virginia).
Als Parodie des Burgkmair'schen Holzschnittes »Drei güt Cristen« muss ein Relief von Hans Daucher bezeichnet
werden, welches sich im Besitze des Fürsten Hohenlohe zu Neuenstein befindet und kürzlich in der Württembergischen
Vierteljahrsschrift für Landesgeschichte von Dr. E. Gradmann publicirt worden ist. An Stelle der fingirten sind hier wirk-
liche Porträts von lebenden Personen getreten, und zwar erscheint, wie schon Bode und Gradmann gezeigt haben, als König
Artus der Pfalzgraf Otto Heinrich (derselbe, welchen Daucher auf dem bekannten Berliner Relief als Paris oder Roy de
Mercie darstellt): nicht blos die Porträtähnlichkeit sondern auch der auf dem Schilde des Königs Artus angebrachte Wahl-
spruch Otto Heinrichs setzen dies ausser Zweifel. Aber auch die beiden anderen Figuren lassen sich unschwer feststellen.
Der Gottfried von Bouillon ist kein Anderer als Otto Heinrichs Bruder Philipp, welchen Daucher mehrmals auf
XVI. 3
17
Freiheit, gerecht. Hätte E. v. Bändel die Figur gekannt, sie würde vielleicht nicht ohne Einfiuss auf
sein Teutoburger Denkmal geblieben sein.
Flötner hat diese Figur zweimal im Relief gebildet. Der im Nürnberger Germanischen National-
museum befindliche Bleiabstoss zeigt den Arminius, wie er den Kopf seines ihm zu Füssen liegenden
Gegners in der Linken hält, also in der Weise des Holzschnittes. Aber der Künstler scheint davon
nicht befriedigt. Er versucht es ein zweites Mal und emancipirt sich dabei vollkommen sowohl von
seiner ersten Composition als auch von der Schilderung Burkharde, der den Arminius ausdrücklich als
»jungen Helden« hinstellt.
12. Karl der Grosse, »ein Franck des geblüts«, das Muster aller Regententugenden, »erlangt von
wegen seins hohen rumbs die monarchei des keiser-
thumbs, wölch er mit ehrn und grosser macht hat
erstlich an die Deutschen bracht.«
Karl, gekrönt, geharnischt und mit einem Mantel
umhangen, von vorne gesehen, hat das linke einge-
zogene Bein vor das rechte gelegt und stützt sich mit
der rechten Hand auf das entblösste Schwert. Die
linke, in den Mantel gehüllte Hand hält den Reichs-
apfel. Vor ihm auf dem Boden lehnt an einem Baum-
strunk der längsgetheilte Schild mit einem halben
Adler und sechs Lilien.
Mit der viel steifer gerathenen Figur Karls im
Holzschnitte hat unser Relief kaum etwas gemein:
dort fehlt der Reichsapfel, die Linke des Kaisers
stützt sich auf den Schild und die Rechte hält das
Schwert nach oben. Nur das Wappen ist hier wie
dort dasselbe.
Auch dieser Holzschnitt Flötner's aber, somit
bereits der dritte in unserer Folge, ist eine und zwar
sehr getreue Nachbildung einer Figur Burgkmair's:
des Kaisers Karl des Grossen auf dem Blatte »Drei
güt Christen«; dasselbe ist datirt 1519.1
Möglicher Weise gehen auch andere Figuren
unseres Holzschnittwerkes, am wahrscheinlichsten
wohl diejenigen, welche Flötner für seine Reliefbilder Fig- 15 : Arminius (11).
stark verändert hat, auf ältere Vorlagen zurück; sie
zeigen im Allgemeinen gewisse Eigenthümlichkeiten der Maximilianischen Zeit und erinnern einiger-
massen an die älteren, zum Theile ja in Nürnberg bestellten Ahnenbilder der Habsburger, welche das
Kaisergrab in Innsbruck umgeben (vgl. D. Schönherr im XI. Bande dieses Jahrbuches).
1 Zu diesem Blatte mit den I.ieblingshcldcn des Kaisers Maximilian (Caesar Carolus, herzog Gotfrid, kinig Artus)
gehört als Pendant das Blatt: »Drei güt Cristin« (Elena, Brigitta, Elsbetha); ausserdem schuf Burgkmair als Gegenstücke
das schon erwähnte Blatt: »Die drei güten Juden« (Josue, rex Davit, Judas Machabeus), dazu: »Drei güt Judin« (Hcster, Judith,
Jael) und »Die drei güten Haiden« (Hector von Droi, Gros Alexander, Julius Cesar)«, dazu »Drei guot Haidin« (Lucretia,
Veturia, Virginia).
Als Parodie des Burgkmair'schen Holzschnittes »Drei güt Cristen« muss ein Relief von Hans Daucher bezeichnet
werden, welches sich im Besitze des Fürsten Hohenlohe zu Neuenstein befindet und kürzlich in der Württembergischen
Vierteljahrsschrift für Landesgeschichte von Dr. E. Gradmann publicirt worden ist. An Stelle der fingirten sind hier wirk-
liche Porträts von lebenden Personen getreten, und zwar erscheint, wie schon Bode und Gradmann gezeigt haben, als König
Artus der Pfalzgraf Otto Heinrich (derselbe, welchen Daucher auf dem bekannten Berliner Relief als Paris oder Roy de
Mercie darstellt): nicht blos die Porträtähnlichkeit sondern auch der auf dem Schilde des Königs Artus angebrachte Wahl-
spruch Otto Heinrichs setzen dies ausser Zweifel. Aber auch die beiden anderen Figuren lassen sich unschwer feststellen.
Der Gottfried von Bouillon ist kein Anderer als Otto Heinrichs Bruder Philipp, welchen Daucher mehrmals auf
XVI. 3