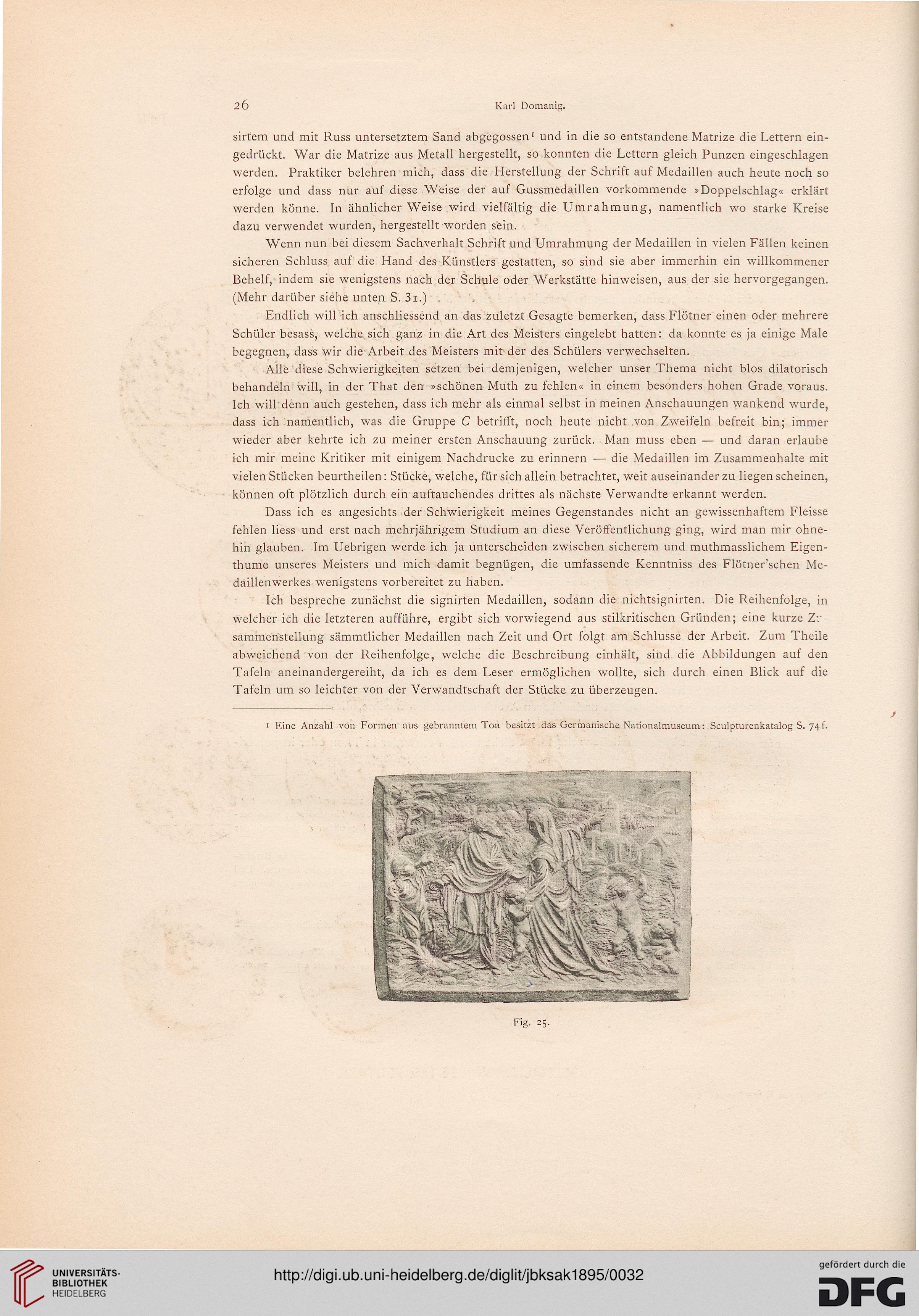26
Karl Domanig.
sirtem und mit Russ untersetztem Sand abgegossen1 und in die so entstandene Matrize die Lettern ein-
gedrückt. War die Matrize aus Metall hergestellt, so konnten die Lettern gleich Punzen eingeschlagen
werden. Praktiker belehren mich, dass die Herstellung der Schrift auf Medaillen auch heute noch so
erfolge und dass nur auf diese Weise der auf Gussmedaillen vorkommende »Doppelschlag« erklärt
werden könne. In ähnlicher Weise wird vielfältig die Umrahmung, namentlich wo starke Kreise
dazu verwendet wurden, hergestellt worden sein.
Wenn nun bei diesem Sachverhalt Schrift und Umrahmung der Medaillen in vielen Fällen keinen
sicheren Schluss. auf die Hand des Künstlers gestatten, so sind sie aber immerhin ein willkommener
Behelf, indem sie wenigstens nach der Schule oder Werkstätte hinweisen, aus der sie hervorgegangen.
(Mehr darüber siehe unten S. 3i.) , ,
Endlich will ich anschliessend an das zuletzt Gesagte bemerken, dass Flötner einen oder mehrere
Schüler besass, welche sich ganz in die Art des Meisters eingelebt hatten: da konnte es ja einige Male
begegnen, dass wir die Arbeit des Meisters mit der des Schülers verwechselten.
Alle diese Schwierigkeiten setzen bei demjenigen, welcher unser Thema nicht blos dilatorisch
behandeln will, in der That den »schönen Muth zu fehlen« in einem besonders hohen Grade voraus.
Ich will denn auch gestehen, dass ich mehr als einmal selbst in meinen Anschauungen wankend wurde,
dass ich namentlich, was die Gruppe C betrifft, noch heute nicht von Zweifeln befreit bin; immer
wieder aber kehrte ich zu meiner ersten Anschauung zurück. Man muss eben — und daran erlaube
ich mir meine Kritiker mit einigem Nachdrucke zu erinnern — die Medaillen im Zusammenhalte mit
vielen Stücken beurtheilen: Stücke, welche, für sich allein betrachtet, weit auseinander zu liegen scheinen,
können oft plötzlich durch ein auftauchendes drittes als nächste Verwandte erkannt werden.
Dass ich es angesichts der Schwierigkeit meines Gegenstandes nicht an gewissenhaftem Fleisse
fehlen Hess und erst nach mehrjährigem Studium an diese Veröffentlichung ging, wird man mir ohne-
hin glauben. Im Uebrigen werde ich ja unterscheiden zwischen sicherem und muthmasslichem Eigen-
thume unseres Meisters und mich damit begnügen, die umfassende Kenntniss des Flötner'schen Me-
daillenwerkes wenigstens vorbereitet zu haben.
Ich bespreche zunächst die signirten Medaillen, sodann die nichtsignirten. Die Reihenfolge, in
welcher ich die letzteren aufführe, ergibt sich vorwiegend aus stilkritischen Gründen; eine kurze Z:
sammeristellung sämmtlicher Medaillen nach Zeit und Ort folgt am.Schlüsse der Arbeit. Zum Theile
abweichend von der Reihenfolge, welche die Beschreibung einhält, sind die Abbildungen auf den
Tafeln aneinandergereiht, da ich es dem Leser ermöglichen wollte, sich durch einen Blick auf die
Tafeln um so leichter von der Verwandtschaft der Stücke zu überzeugen.
' Eine Anzahl von Formen aus gebranntem Ton besitzt das Germanische Nationalmuseum: Sculpturenkatalog S. 74 f.
Fig. 25.
Karl Domanig.
sirtem und mit Russ untersetztem Sand abgegossen1 und in die so entstandene Matrize die Lettern ein-
gedrückt. War die Matrize aus Metall hergestellt, so konnten die Lettern gleich Punzen eingeschlagen
werden. Praktiker belehren mich, dass die Herstellung der Schrift auf Medaillen auch heute noch so
erfolge und dass nur auf diese Weise der auf Gussmedaillen vorkommende »Doppelschlag« erklärt
werden könne. In ähnlicher Weise wird vielfältig die Umrahmung, namentlich wo starke Kreise
dazu verwendet wurden, hergestellt worden sein.
Wenn nun bei diesem Sachverhalt Schrift und Umrahmung der Medaillen in vielen Fällen keinen
sicheren Schluss. auf die Hand des Künstlers gestatten, so sind sie aber immerhin ein willkommener
Behelf, indem sie wenigstens nach der Schule oder Werkstätte hinweisen, aus der sie hervorgegangen.
(Mehr darüber siehe unten S. 3i.) , ,
Endlich will ich anschliessend an das zuletzt Gesagte bemerken, dass Flötner einen oder mehrere
Schüler besass, welche sich ganz in die Art des Meisters eingelebt hatten: da konnte es ja einige Male
begegnen, dass wir die Arbeit des Meisters mit der des Schülers verwechselten.
Alle diese Schwierigkeiten setzen bei demjenigen, welcher unser Thema nicht blos dilatorisch
behandeln will, in der That den »schönen Muth zu fehlen« in einem besonders hohen Grade voraus.
Ich will denn auch gestehen, dass ich mehr als einmal selbst in meinen Anschauungen wankend wurde,
dass ich namentlich, was die Gruppe C betrifft, noch heute nicht von Zweifeln befreit bin; immer
wieder aber kehrte ich zu meiner ersten Anschauung zurück. Man muss eben — und daran erlaube
ich mir meine Kritiker mit einigem Nachdrucke zu erinnern — die Medaillen im Zusammenhalte mit
vielen Stücken beurtheilen: Stücke, welche, für sich allein betrachtet, weit auseinander zu liegen scheinen,
können oft plötzlich durch ein auftauchendes drittes als nächste Verwandte erkannt werden.
Dass ich es angesichts der Schwierigkeit meines Gegenstandes nicht an gewissenhaftem Fleisse
fehlen Hess und erst nach mehrjährigem Studium an diese Veröffentlichung ging, wird man mir ohne-
hin glauben. Im Uebrigen werde ich ja unterscheiden zwischen sicherem und muthmasslichem Eigen-
thume unseres Meisters und mich damit begnügen, die umfassende Kenntniss des Flötner'schen Me-
daillenwerkes wenigstens vorbereitet zu haben.
Ich bespreche zunächst die signirten Medaillen, sodann die nichtsignirten. Die Reihenfolge, in
welcher ich die letzteren aufführe, ergibt sich vorwiegend aus stilkritischen Gründen; eine kurze Z:
sammeristellung sämmtlicher Medaillen nach Zeit und Ort folgt am.Schlüsse der Arbeit. Zum Theile
abweichend von der Reihenfolge, welche die Beschreibung einhält, sind die Abbildungen auf den
Tafeln aneinandergereiht, da ich es dem Leser ermöglichen wollte, sich durch einen Blick auf die
Tafeln um so leichter von der Verwandtschaft der Stücke zu überzeugen.
' Eine Anzahl von Formen aus gebranntem Ton besitzt das Germanische Nationalmuseum: Sculpturenkatalog S. 74 f.
Fig. 25.