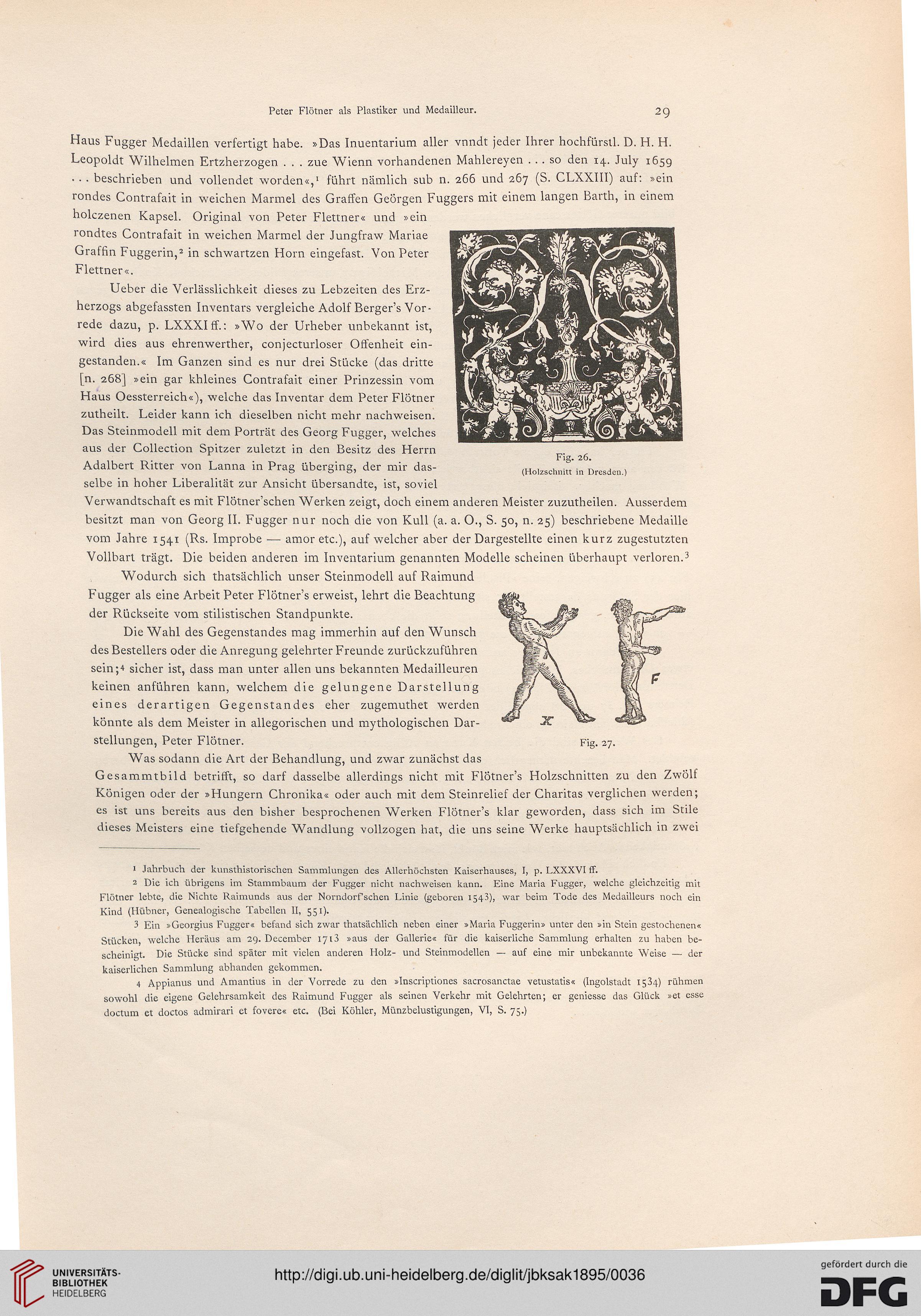Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.
29
Haus Fugger Medaillen verfertigt habe. »Das Inuentarium aller vnndt jeder Ihrer hochfürstl. D. H. H.
Leopoldt Wilhelmen Ertzherzogen . . . zue Wienn vorhandenen Mahlereyen ... so den 14. July 1659
■ ■ . beschrieben und vollendet worden«,1 führt nämlich sub n. 266 und 267 (S. CLXXIII) auf: »ein
rondes Contrafait in weichen Marmel des Graffen Georgen Fuggers mit einem langen Barth, in einem
holczenen Kapsel. Original von Peter Flettner« und »ein
rondtes Contrafait in weichen Marmel der Jungfraw Mariae
Graffin Fuggerin,2 in schwartzen Horn eingefast. Von Peter
Flettner«.
Ueber die Verlässlichkeit dieses zu Lebzeiten des Erz-
herzogs abgefassten Inventars vergleiche Adolf Berger's Vor-
rede dazu, p. LXXXIff.: »Wo der Urheber unbekannt ist,
wird dies aus ehrenwerther, conjecturloser Offenheit ein-
gestanden.« Im Ganzen sind es nur drei Stücke (das dritte
[n. 268] »ein gar khleines Contrafait einer Prinzessin vom
Haus Oessterreich«), welche das Inventar dem Peter Flötner
zutheilt. Leider kann ich dieselben nicht mehr nachweisen.
Das Steinmodell mit dem Porträt des Georg Fugger, welches
aus der Collection Spitzer zuletzt in den Besitz des Herrn
Adalbert Ritter von Lamra in Prag überging, der mir das-
selbe in hoher Liberalität zur Ansicht übersandte, ist, soviel
Verwandtschaft es mit Flötner'schen Werken zeigt, doch einem anderen Meister zuzutheilen. Ausserdem
besitzt man von Georg II. Fugger nur noch die von Kuli (a. a. O., S. 50, n. 25) beschriebene Medaille
vom Jahre 1541 (Rs. Improbe — amor etc.), auf welcher aber der Dargestellte einen kurz zugestutzten
Vollbart trägt. Die beiden anderen im Inventarium genannten Modelle scheinen überhaupt verloren.3
Wodurch sich thatsächlich unser Steinmodell auf Raimund
Fagger als eine Arbeit Peter Flötner's erweist, lehrt die Beachtung
der Rückseite vom stilistischen Standpunkte.
Die Wahl des Gegenstandes mag immerhin auf den Wunsch
des Bestellers oder die Anregung gelehrter Freunde zurückzuführen
sein; * sicher ist, dass man unter allen uns bekannten Medailleuren
keinen anführen kann, welchem die gelungene Darstellung
eines derartigen Gegenstandes eher zugemuthet werden
könnte als dem Meister in allegorischen und mythologischen Dar-
stellungen, Peter Flötner. Fig. 27.
Was sodann die Art der Behandlung, und zwar zunächst das
Gesammtbild betrifft, so darf dasselbe allerdings nicht mit Flötner's Holzschnitten zu den Zwölf
Königen oder der »Hungern Chronika« oder auch mit dem Steinrelief der Charitas verglichen werden;
es ist uns bereits aus den bisher besprochenen Werken Flötner's klar geworden, dass sich im Stile
dieses Meisters eine tiefgehende Wandlung vollzogen hat, die uns seine Werke hauptsächlich in zwei
1 Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, I, p. LXXXVI ff.
2 Die ich übrigens im Stammbaum der Fugger nicht nachweisen kann. Eine Maria Fugger, welche gleichzeitig mit
Flötner lebte, die Nichte Raimunds aus der Norndorf'schen Linie (geboren 1543), war beim Tode des Medailleurs noch ein
Kind (Hübner, Genealogische Tabellen II, 551).
3 Ein »Georgius Fugger« befand sich zwar thatsächlich neben einer »Maria Fuggerin» unter den »in Stein gestochenen«
Stücken, welche Heraus am 29. Dccember 1713 »aus der Gallerie« für die kaiserliche Sammlung erhalten zu haben be-
scheinigt. Die Stücke sind später mit vielen anderen Holz- und Steinmodellen — auf eine mir unbekannte Weise — der
kaiserlichen Sammlung abhanden gekommen.
4 Appianus und Amantius in der Vorrede zu den »Inscriptiones sacrosanctae vetustatis« (Ingolstadt 1534) rühmen
sowohl die eigene Gelehrsamkeit des Raimund Fugger als seinen Verkehr mit Gelehrten; er geniesse das Glück »et esse
doctum et doctos admirari et fovere« etc. (Bei Köhler, Münzbelustigungen, VI, S. 75.)
29
Haus Fugger Medaillen verfertigt habe. »Das Inuentarium aller vnndt jeder Ihrer hochfürstl. D. H. H.
Leopoldt Wilhelmen Ertzherzogen . . . zue Wienn vorhandenen Mahlereyen ... so den 14. July 1659
■ ■ . beschrieben und vollendet worden«,1 führt nämlich sub n. 266 und 267 (S. CLXXIII) auf: »ein
rondes Contrafait in weichen Marmel des Graffen Georgen Fuggers mit einem langen Barth, in einem
holczenen Kapsel. Original von Peter Flettner« und »ein
rondtes Contrafait in weichen Marmel der Jungfraw Mariae
Graffin Fuggerin,2 in schwartzen Horn eingefast. Von Peter
Flettner«.
Ueber die Verlässlichkeit dieses zu Lebzeiten des Erz-
herzogs abgefassten Inventars vergleiche Adolf Berger's Vor-
rede dazu, p. LXXXIff.: »Wo der Urheber unbekannt ist,
wird dies aus ehrenwerther, conjecturloser Offenheit ein-
gestanden.« Im Ganzen sind es nur drei Stücke (das dritte
[n. 268] »ein gar khleines Contrafait einer Prinzessin vom
Haus Oessterreich«), welche das Inventar dem Peter Flötner
zutheilt. Leider kann ich dieselben nicht mehr nachweisen.
Das Steinmodell mit dem Porträt des Georg Fugger, welches
aus der Collection Spitzer zuletzt in den Besitz des Herrn
Adalbert Ritter von Lamra in Prag überging, der mir das-
selbe in hoher Liberalität zur Ansicht übersandte, ist, soviel
Verwandtschaft es mit Flötner'schen Werken zeigt, doch einem anderen Meister zuzutheilen. Ausserdem
besitzt man von Georg II. Fugger nur noch die von Kuli (a. a. O., S. 50, n. 25) beschriebene Medaille
vom Jahre 1541 (Rs. Improbe — amor etc.), auf welcher aber der Dargestellte einen kurz zugestutzten
Vollbart trägt. Die beiden anderen im Inventarium genannten Modelle scheinen überhaupt verloren.3
Wodurch sich thatsächlich unser Steinmodell auf Raimund
Fagger als eine Arbeit Peter Flötner's erweist, lehrt die Beachtung
der Rückseite vom stilistischen Standpunkte.
Die Wahl des Gegenstandes mag immerhin auf den Wunsch
des Bestellers oder die Anregung gelehrter Freunde zurückzuführen
sein; * sicher ist, dass man unter allen uns bekannten Medailleuren
keinen anführen kann, welchem die gelungene Darstellung
eines derartigen Gegenstandes eher zugemuthet werden
könnte als dem Meister in allegorischen und mythologischen Dar-
stellungen, Peter Flötner. Fig. 27.
Was sodann die Art der Behandlung, und zwar zunächst das
Gesammtbild betrifft, so darf dasselbe allerdings nicht mit Flötner's Holzschnitten zu den Zwölf
Königen oder der »Hungern Chronika« oder auch mit dem Steinrelief der Charitas verglichen werden;
es ist uns bereits aus den bisher besprochenen Werken Flötner's klar geworden, dass sich im Stile
dieses Meisters eine tiefgehende Wandlung vollzogen hat, die uns seine Werke hauptsächlich in zwei
1 Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, I, p. LXXXVI ff.
2 Die ich übrigens im Stammbaum der Fugger nicht nachweisen kann. Eine Maria Fugger, welche gleichzeitig mit
Flötner lebte, die Nichte Raimunds aus der Norndorf'schen Linie (geboren 1543), war beim Tode des Medailleurs noch ein
Kind (Hübner, Genealogische Tabellen II, 551).
3 Ein »Georgius Fugger« befand sich zwar thatsächlich neben einer »Maria Fuggerin» unter den »in Stein gestochenen«
Stücken, welche Heraus am 29. Dccember 1713 »aus der Gallerie« für die kaiserliche Sammlung erhalten zu haben be-
scheinigt. Die Stücke sind später mit vielen anderen Holz- und Steinmodellen — auf eine mir unbekannte Weise — der
kaiserlichen Sammlung abhanden gekommen.
4 Appianus und Amantius in der Vorrede zu den »Inscriptiones sacrosanctae vetustatis« (Ingolstadt 1534) rühmen
sowohl die eigene Gelehrsamkeit des Raimund Fugger als seinen Verkehr mit Gelehrten; er geniesse das Glück »et esse
doctum et doctos admirari et fovere« etc. (Bei Köhler, Münzbelustigungen, VI, S. 75.)