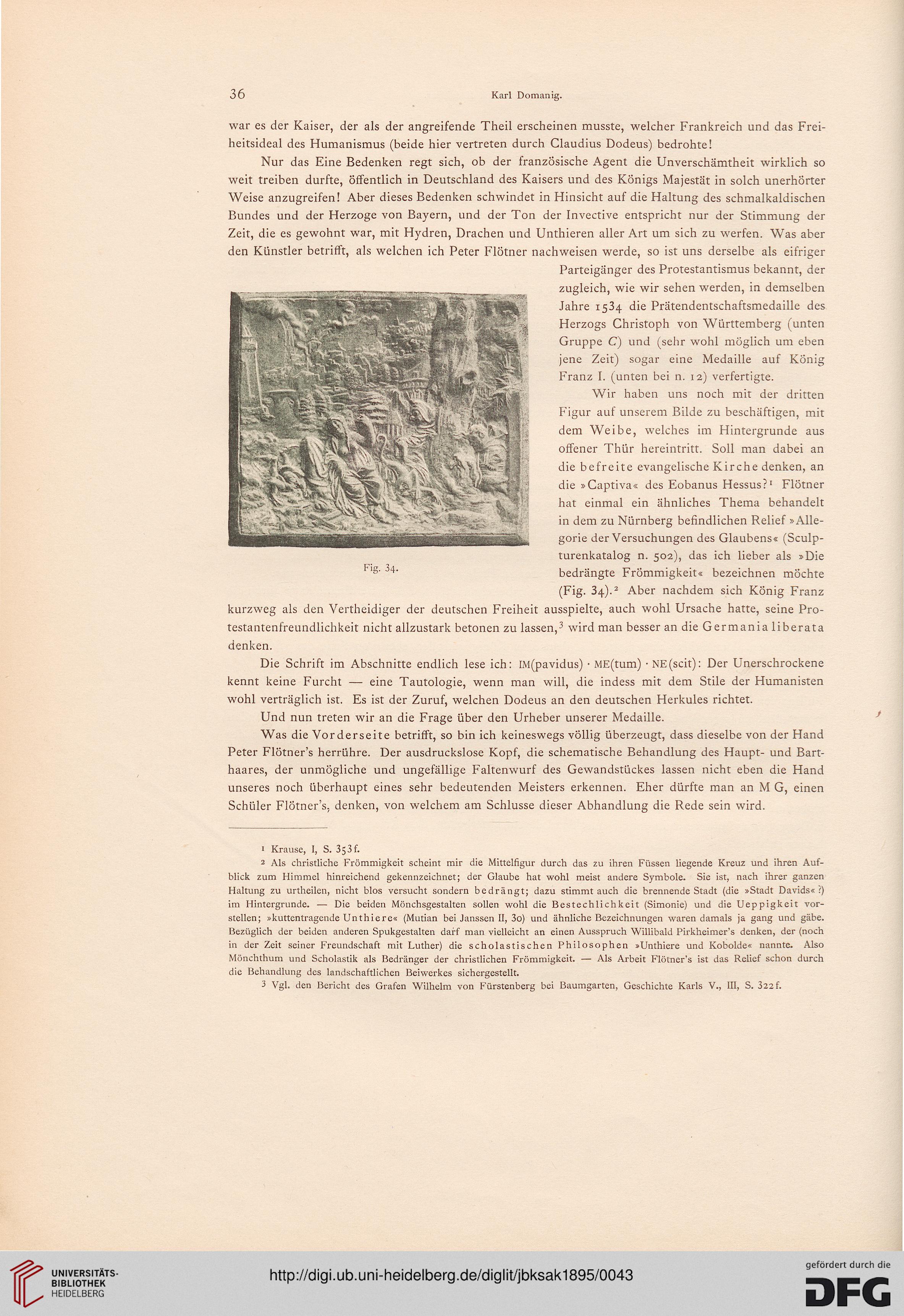36
Karl Domanig.
war es der Kaiser, der als der angreifende Theil erscheinen musste, welcher Frankreich und das Frei-
heitsideal des Humanismus (beide hier vertreten durch Claudius Dodeus) bedrohte!
Nur das Eine Bedenken regt sich, ob der französische Agent die Unverschämtheit wirklich so
weit treiben durfte, öffentlich in Deutschland des Kaisers und des Königs Majestät in solch unerhörter
Weise anzugreifen! Aber dieses Bedenken schwindet in Hinsicht auf die Haltung des schmalkaldischen
Bundes und der Herzoge von Bayern, und der Ton der Invective entspricht nur der Stimmung der
Zeit, die es gewohnt war, mit Hydren, Drachen und Unthieren aller Art um sich zu werfen. Was aber
den Künstler betrifft, als welchen ich Peter Flötner nachweisen werde, so ist uns derselbe als eifriger
Parteigänger des Protestantismus bekannt, der
zugleich, wie wir sehen werden, in demselben
Jahre 1534 die Prätendentschaftsmedaille des
Herzogs Christoph von Württemberg (unten
Gruppe C) und (sehr wohl möglich um eben
jene Zeit) sogar eine Medaille auf König
Franz I. (unten bei n. 12) verfertigte.
Wir haben uns noch mit der dritten
Figur auf unserem Bilde zu beschäftigen, mit
dem Weibe, welches im Hintergrunde aus
offener Thür hereintritt. Soll man dabei an
die befreite evangelische Kirche denken, an
die »Captiva« des Eobanus Hessus?1 Flötner
hat einmal ein ähnliches Thema behandelt
in dem zu Nürnberg befindlichen Relief »Alle-
gorie der Versuchungen des Glaubens« (Sculp-
turenkatalog n. 502), das ich lieber als »Die
bedrängte Frömmigkeit« bezeichnen möchte
(Fig. 34).2 Aber nachdem sich König Franz
kurzweg als den Vertheidiger der deutschen Freiheit ausspielte, auch wohl Ursache hatte, seine Pro-
testantenfreundlichkeit nicht allzustark betonen zu lassen,3 wird man besser an die Germania liberata
denken.
Die Schrift im Abschnitte endlich lese ich: IM(pavidus) • ME(tum) • NE (seit): Der Unerschrockene
kennt keine Furcht — eine Tautologie, wenn man will, die indess mit dem Stile der Humanisten
wohl verträglich ist. Es ist der Zuruf, welchen Dodeus an den deutschen Herkules richtet.
Und nun treten wir an die Frage über den Urheber unserer Medaille.
Was die Vorderseite betrifft, so bin ich keineswegs völlig überzeugt, dass dieselbe von der Hand
Peter Flötner's herrühre. Der ausdruckslose Kopf, die schematische Behandlung des Haupt- und Bart-
haares, der unmögliche und ungefällige Faltenwurf des Gewandstückes lassen nicht eben die Hand
unseres noch überhaupt eines sehr bedeutenden Meisters erkennen. Eher dürfte man an M G, einen
Schüler Flötner's, denken, von welchem am Schlüsse dieser Abhandlung die Rede sein wird.
1 Krause, I, S. 353 f.
2 Als christliche Frömmigkeit scheint mir die Mittelfigur durch das zu ihren Füssen liegende Kreuz und ihren Auf-
blick zum Himmel hinreichend gekennzeichnet; der Glaube hat wohl meist andere Symbole. Sie ist, nach ihrer ganzen
Haltung zu urtheilen, nicht blos versucht sondern bedrängt; dazu stimmtauch die brennende Stadt (die »Stadt Davids«?)
im Hintergrunde. — Die beiden Mönchsgestalten sollen wohl die Bestechlichkeit (Simonie) und die Ueppigkeit vor-
stellen; »kuttentragende Unthiere« (Mutian bei Janssen II, 3o) und ähnliche Bezeichnungen waren damals ja gang und gäbe.
Bezüglich der beiden anderen Spukgestalten darf man vielleicht an einen Ausspruch Willibald Pirkheimer's denken, der (noch
in der Zeit seiner Freundschaft mit Luther) die scholastischen Philosophen »Unthiere und Kobolde« nannte. Also
Mönchthum und Scholastik als Bedränger der christlichen Frömmigkeit. — Als Arbeit Flötner's ist das Relief schon durch
die Behandlung des landschaftlichen Beiwerkes sichergestellt.
'i Vgl. den Bericht des Grafen Wilhelm von Fürstenberg bei Baumgarten, Geschichte Karls V., III, S. 322 f.
Karl Domanig.
war es der Kaiser, der als der angreifende Theil erscheinen musste, welcher Frankreich und das Frei-
heitsideal des Humanismus (beide hier vertreten durch Claudius Dodeus) bedrohte!
Nur das Eine Bedenken regt sich, ob der französische Agent die Unverschämtheit wirklich so
weit treiben durfte, öffentlich in Deutschland des Kaisers und des Königs Majestät in solch unerhörter
Weise anzugreifen! Aber dieses Bedenken schwindet in Hinsicht auf die Haltung des schmalkaldischen
Bundes und der Herzoge von Bayern, und der Ton der Invective entspricht nur der Stimmung der
Zeit, die es gewohnt war, mit Hydren, Drachen und Unthieren aller Art um sich zu werfen. Was aber
den Künstler betrifft, als welchen ich Peter Flötner nachweisen werde, so ist uns derselbe als eifriger
Parteigänger des Protestantismus bekannt, der
zugleich, wie wir sehen werden, in demselben
Jahre 1534 die Prätendentschaftsmedaille des
Herzogs Christoph von Württemberg (unten
Gruppe C) und (sehr wohl möglich um eben
jene Zeit) sogar eine Medaille auf König
Franz I. (unten bei n. 12) verfertigte.
Wir haben uns noch mit der dritten
Figur auf unserem Bilde zu beschäftigen, mit
dem Weibe, welches im Hintergrunde aus
offener Thür hereintritt. Soll man dabei an
die befreite evangelische Kirche denken, an
die »Captiva« des Eobanus Hessus?1 Flötner
hat einmal ein ähnliches Thema behandelt
in dem zu Nürnberg befindlichen Relief »Alle-
gorie der Versuchungen des Glaubens« (Sculp-
turenkatalog n. 502), das ich lieber als »Die
bedrängte Frömmigkeit« bezeichnen möchte
(Fig. 34).2 Aber nachdem sich König Franz
kurzweg als den Vertheidiger der deutschen Freiheit ausspielte, auch wohl Ursache hatte, seine Pro-
testantenfreundlichkeit nicht allzustark betonen zu lassen,3 wird man besser an die Germania liberata
denken.
Die Schrift im Abschnitte endlich lese ich: IM(pavidus) • ME(tum) • NE (seit): Der Unerschrockene
kennt keine Furcht — eine Tautologie, wenn man will, die indess mit dem Stile der Humanisten
wohl verträglich ist. Es ist der Zuruf, welchen Dodeus an den deutschen Herkules richtet.
Und nun treten wir an die Frage über den Urheber unserer Medaille.
Was die Vorderseite betrifft, so bin ich keineswegs völlig überzeugt, dass dieselbe von der Hand
Peter Flötner's herrühre. Der ausdruckslose Kopf, die schematische Behandlung des Haupt- und Bart-
haares, der unmögliche und ungefällige Faltenwurf des Gewandstückes lassen nicht eben die Hand
unseres noch überhaupt eines sehr bedeutenden Meisters erkennen. Eher dürfte man an M G, einen
Schüler Flötner's, denken, von welchem am Schlüsse dieser Abhandlung die Rede sein wird.
1 Krause, I, S. 353 f.
2 Als christliche Frömmigkeit scheint mir die Mittelfigur durch das zu ihren Füssen liegende Kreuz und ihren Auf-
blick zum Himmel hinreichend gekennzeichnet; der Glaube hat wohl meist andere Symbole. Sie ist, nach ihrer ganzen
Haltung zu urtheilen, nicht blos versucht sondern bedrängt; dazu stimmtauch die brennende Stadt (die »Stadt Davids«?)
im Hintergrunde. — Die beiden Mönchsgestalten sollen wohl die Bestechlichkeit (Simonie) und die Ueppigkeit vor-
stellen; »kuttentragende Unthiere« (Mutian bei Janssen II, 3o) und ähnliche Bezeichnungen waren damals ja gang und gäbe.
Bezüglich der beiden anderen Spukgestalten darf man vielleicht an einen Ausspruch Willibald Pirkheimer's denken, der (noch
in der Zeit seiner Freundschaft mit Luther) die scholastischen Philosophen »Unthiere und Kobolde« nannte. Also
Mönchthum und Scholastik als Bedränger der christlichen Frömmigkeit. — Als Arbeit Flötner's ist das Relief schon durch
die Behandlung des landschaftlichen Beiwerkes sichergestellt.
'i Vgl. den Bericht des Grafen Wilhelm von Fürstenberg bei Baumgarten, Geschichte Karls V., III, S. 322 f.