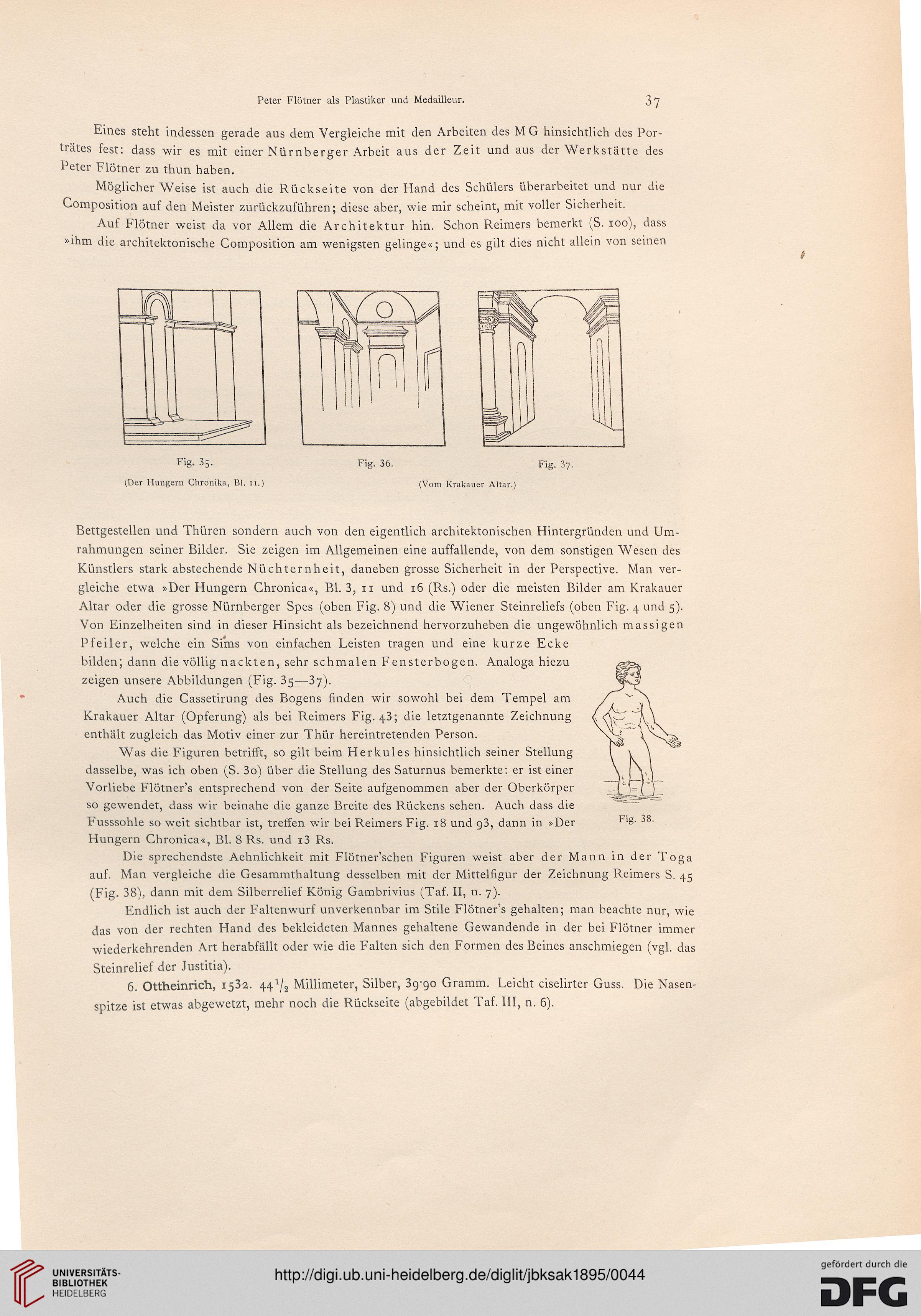Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.
37
Eines steht indessen gerade aus dem Vergleiche mit den Arbeiten des MG hinsichtlich des Por-
trätes fest: dass wir es mit einer Nürnberger Arbeit aus der Zeit und aus der Werkstätte des
Peter Flötner zu thun haben.
Möglicher Weise ist auch die Rückseite von der Hand des Schülers überarbeitet und nur die
Composition auf den Meister zurückzuführen; diese aber, wie mir scheint, mit voller Sicherheit.
Auf Flötner weist da vor Allem die Architektur hin. Schon Reimers bemerkt (S. 100), dass
»ihm die architektonische Composition am wenigsten gelinge«; und es gilt dies nicht allein von seinen
Fig- 35- Fig. 36. Fig. 37.
(Der Hungern Ghronika, Bl. 11.) (Vom Krakauer Altar.)
Bettgestellen und Thüren sondern auch von den eigentlich architektonischen Hintergründen und Um-
rahmungen seiner Bilder. Sie zeigen im Allgemeinen eine auffallende, von dem sonstigen Wesen des
Künstlers stark abstechende Nüchternheit, daneben grosse Sicherheit in der Perspective. Man ver-
gleiche etwa »Der Hungern Chronica«, Bl. 3, n und 16 (Rs.) oder die meisten Bilder am Krakauer
Altar oder die grosse Nürnberger Spes (oben Fig. 8) und die Wiener Steinreliefs (oben Fig. 4 und 5).
Von Einzelheiten sind in dieser Hinsicht als bezeichnend hervorzuheben die ungewöhnlich massigen
Pfeiler, welche ein Sims von einfachen Leisten tragen und eine kurze Ecke
bilden; dann die völlig nackten, sehr schmalen Fensterbogen. Analoga hiezu
zeigen unsere Abbildungen (Fig. 35—37).
Auch die Cassetirung des Bogens finden wir sowohl bei dem Tempel am
Krakauer Altar (Opferung) als bei Reimers Fig. 43; die letztgenannte Zeichnung
enthält zugleich das Motiv einer zur Thür hereintretenden Person.
Was die Figuren betrifft, so gilt beim Herkules hinsichtlich seiner Stellung
dasselbe, was ich oben (S. 3o) über die Stellung des Saturnus bemerkte: er ist einer
Vorliebe Flötner's entsprechend von der Seite aufgenommen aber der Oberkörper
so gewendet, dass wir beinahe die ganze Breite des Rückens sehen. Auch dass die
Fusssohle so weit sichtbar ist, treffen wir bei Reimers Fig. 18 und g3, dann in »Der
Hungern Chronica«, Bl. 8 Rs. und i3 Rs.
Die sprechendste Aehnlichkeit mit Flötner'schen Figuren weist aber der Mann in der Toga
auf. Man vergleiche die Gesammthaltung desselben mit der Mittelfigur der Zeichnung Reimers S. 45
(Fig. 38), dann mit dem Silberrelief König Gambrivius (Taf. II, n. 7).
Endlich ist auch der Faltenwurf unverkennbar im Stile Flötner's gehalten; man beachte nur, wie
das von der rechten Hand des bekleideten Mannes gehaltene Gewandende in der bei Flötner immer
wiederkehrenden Art herabfällt oder wie die Falten sich den Formen des Beines anschmiegen (vgl. das
Steinrelief der Justitia).
6. Ottheinrich, 1532. 44 ^ Millimeter, Silber, 3a-go Gramm. Leicht ciselirter Guss. Die Nasen-
spitze ist etwas abgewetzt, mehr noch die Rückseite (abgebildet Taf. III, n. 6).
37
Eines steht indessen gerade aus dem Vergleiche mit den Arbeiten des MG hinsichtlich des Por-
trätes fest: dass wir es mit einer Nürnberger Arbeit aus der Zeit und aus der Werkstätte des
Peter Flötner zu thun haben.
Möglicher Weise ist auch die Rückseite von der Hand des Schülers überarbeitet und nur die
Composition auf den Meister zurückzuführen; diese aber, wie mir scheint, mit voller Sicherheit.
Auf Flötner weist da vor Allem die Architektur hin. Schon Reimers bemerkt (S. 100), dass
»ihm die architektonische Composition am wenigsten gelinge«; und es gilt dies nicht allein von seinen
Fig- 35- Fig. 36. Fig. 37.
(Der Hungern Ghronika, Bl. 11.) (Vom Krakauer Altar.)
Bettgestellen und Thüren sondern auch von den eigentlich architektonischen Hintergründen und Um-
rahmungen seiner Bilder. Sie zeigen im Allgemeinen eine auffallende, von dem sonstigen Wesen des
Künstlers stark abstechende Nüchternheit, daneben grosse Sicherheit in der Perspective. Man ver-
gleiche etwa »Der Hungern Chronica«, Bl. 3, n und 16 (Rs.) oder die meisten Bilder am Krakauer
Altar oder die grosse Nürnberger Spes (oben Fig. 8) und die Wiener Steinreliefs (oben Fig. 4 und 5).
Von Einzelheiten sind in dieser Hinsicht als bezeichnend hervorzuheben die ungewöhnlich massigen
Pfeiler, welche ein Sims von einfachen Leisten tragen und eine kurze Ecke
bilden; dann die völlig nackten, sehr schmalen Fensterbogen. Analoga hiezu
zeigen unsere Abbildungen (Fig. 35—37).
Auch die Cassetirung des Bogens finden wir sowohl bei dem Tempel am
Krakauer Altar (Opferung) als bei Reimers Fig. 43; die letztgenannte Zeichnung
enthält zugleich das Motiv einer zur Thür hereintretenden Person.
Was die Figuren betrifft, so gilt beim Herkules hinsichtlich seiner Stellung
dasselbe, was ich oben (S. 3o) über die Stellung des Saturnus bemerkte: er ist einer
Vorliebe Flötner's entsprechend von der Seite aufgenommen aber der Oberkörper
so gewendet, dass wir beinahe die ganze Breite des Rückens sehen. Auch dass die
Fusssohle so weit sichtbar ist, treffen wir bei Reimers Fig. 18 und g3, dann in »Der
Hungern Chronica«, Bl. 8 Rs. und i3 Rs.
Die sprechendste Aehnlichkeit mit Flötner'schen Figuren weist aber der Mann in der Toga
auf. Man vergleiche die Gesammthaltung desselben mit der Mittelfigur der Zeichnung Reimers S. 45
(Fig. 38), dann mit dem Silberrelief König Gambrivius (Taf. II, n. 7).
Endlich ist auch der Faltenwurf unverkennbar im Stile Flötner's gehalten; man beachte nur, wie
das von der rechten Hand des bekleideten Mannes gehaltene Gewandende in der bei Flötner immer
wiederkehrenden Art herabfällt oder wie die Falten sich den Formen des Beines anschmiegen (vgl. das
Steinrelief der Justitia).
6. Ottheinrich, 1532. 44 ^ Millimeter, Silber, 3a-go Gramm. Leicht ciselirter Guss. Die Nasen-
spitze ist etwas abgewetzt, mehr noch die Rückseite (abgebildet Taf. III, n. 6).