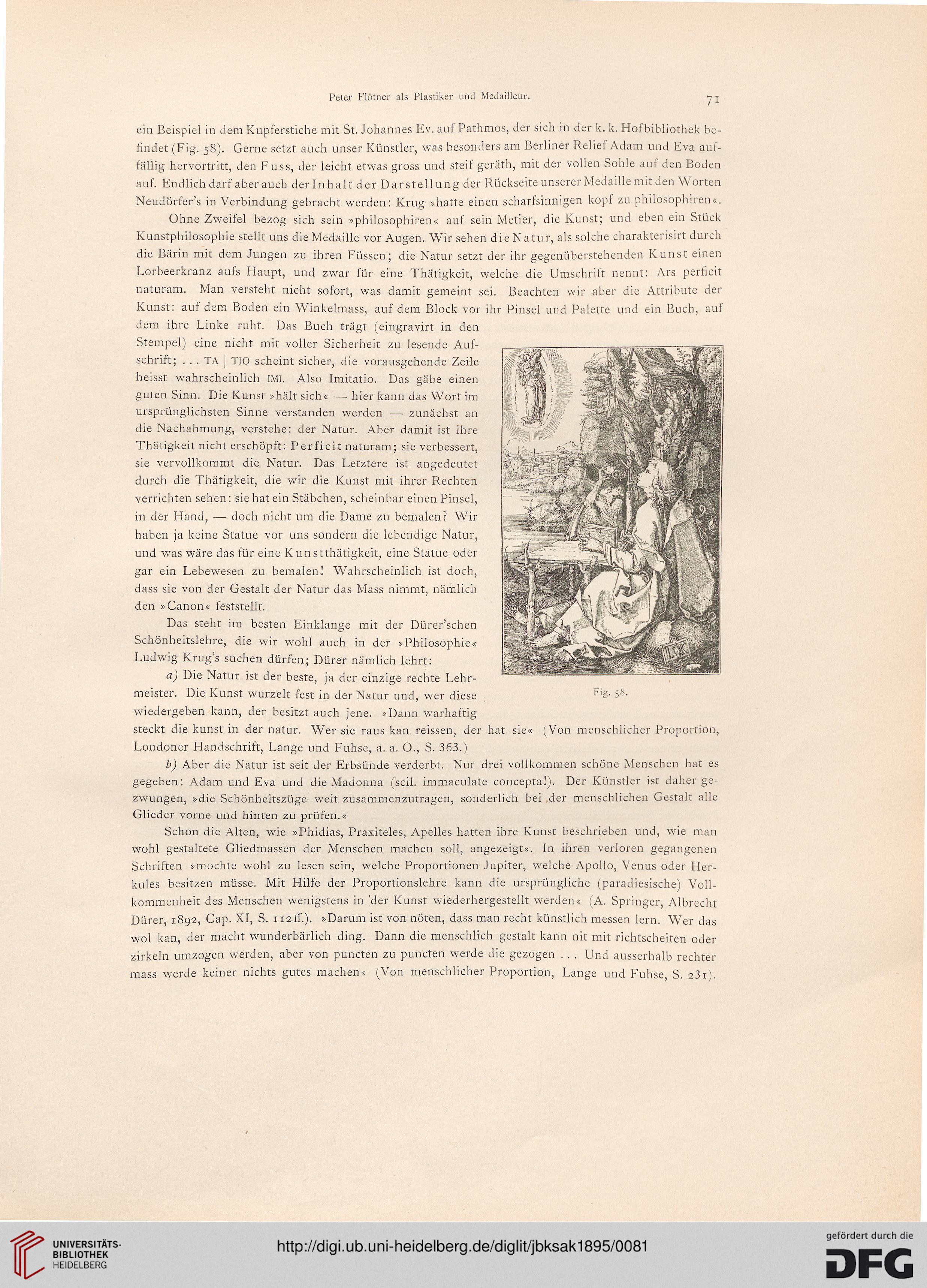Peter Flötner als Plastiker und Medailleur.
71
ein Beispiel in dem Kupferstiche mit St. Johannes Ev. auf Pathmos, der sich in der k. k. Hof bihliothek be-
findet (Fig. 58). Gerne setzt auch unser Künstler, was besonders am Berliner Relief Adam und Eva auf-
fällig hervortritt, den Fuss, der leicht etwas gross und steif geräth, mit der vollen Sohle auf den Boden
auf. Endlich darf aber auch der Inhalt der Darstellung der Rückseite unserer Medaille mit den Worten
Neudörfels in Verbindung gebracht werden: Krug »hatte einen scharfsinnigen köpf zu philosophiren«.
Ohne Zweifel bezog sich sein »philosophiren« auf sein Metier, die Kunst; und eben ein Stück
Kunstphilosophie stellt uns die Medaille vor Augen. Wir sehen die Natur, als solche charakterisirt durch
die Bärin mit dem Jungen zu ihren Füssen; die Natur setzt der ihr gegenüberstehenden Kunst einen
Lorbeerkranz aufs Haupt, und zwar für eine Thätigkeit, welche die Umschrift nennt: Ars perficit
naturam. Man versteht nicht sofort, was damit gemeint sei. Beachten wir aber die Attribute der
Kunst: auf dem Boden ein Winkelmass, auf dem Block vor ihr Pinsel und Palette und ein Buch, auf
dem ihre Linke ruht. Das Buch trägt (eingravirt in den
Stempel) eine nicht mit voller Sicherheit zu lesende Auf-
schrift; ... TA | TIO scheint sicher, die vorausgehende Zeile
heisst wahrscheinlich IMI. Also Imitatio. Das gäbe einen
guten Sinn. Die Kunst »hält sich« — hier kann das Wort im
ursprünglichsten Sinne verstanden werden — zunächst an
die Nachahmung, verstehe: der Natur. Aber damit ist ihre
Thätigkeit nicht erschöpft: Perficit naturam; sie verbessert,
sie vervollkommt die Natur. Das Letztere ist angedeutet
durch die Thätigkeit, die wir die Kunst mit ihrer Rechten
verrichten sehen: sie hat ein Stäbchen, scheinbar einen Pinsel,
in der Hand, — doch nicht um die Dame zu bemalen? Wir
haben ja keine Statue vor uns sondern die lebendige Natur,
und was wäre das für eine Kun stthätigkeit, eine Statue oder
gar ein Lebewesen zu bemalen! Wahrscheinlich ist doch,
dass sie von der Gestalt der Natur das Mass nimmt, nämlich
den »Canon« feststellt.
Das steht im besten Einklänge mit der Dürer'schen
Schönheitslehre, die wir wohl auch in der »Philosophie«
Ludwig Krug's suchen dürfen; Dürer nämlich lehrt:
a) Die Natur ist der beste, ja der einzige rechte Lehr-
meister. Die Kunst wurzelt fest in der Natur und, wer diese
wiedergeben kann, der besitzt auch jene. »Dann warhaftig
steckt die kunst in der natur. Wer sie raus kan reissen, der hat sie« (Von menschlicher Proportion,
Londoner Handschrift, Lange und Fuhse, a. a. O., S. 363.)
b) Aber die Natur ist seit der Erbsünde verderbt. Nur drei vollkommen schöne Menschen hat es
gegeben: Adam und Eva und die Madonna (seil, immaculate coneepta!). Der Künstler ist daher ge-
zwungen, »die Schönheitszüge weit zusammenzutragen, sonderlich bei .der menschlichen Gestalt alle
Glieder vorne und hinten zu prüfen.«
Schon die Alten, wie »Phidias, Praxiteles, Apelles hatten ihre Kunst beschrieben und, wie man
wohl gestaltete Gliedmassen der Menschen machen soll, angezeigt«. In ihren verloren gegangenen
Schriften »mochte wohl zu lesen sein, welche Proportionen Jupiter, welche Apollo, Venus oder Her-
kules besitzen müsse. Mit Hilfe der Proportionslehre kann die ursprüngliche (paradiesische) Voll-
kommenheit des Menschen wenigstens in 'der Kunst wiederhergestellt werden« (A. Springer, Albrecht
Dürer, 1892, Cap. XI, S. ii2ff.). »Darum ist von nöten, dass man recht künstlich messen lern. Wer das
wol kan, der macht wunderbärlich ding. Dann die menschlich gestalt kann nit mit richtscheiten oder
zirkeln umzogen werden, aber von puneten zu puneten werde die gezogen . . . Und ausserhalb rechter
mass werde keiner nichts gutes machen« (Von menschlicher Proportion, Lange und Fuhse, S. 23i).
Fig. 58.
71
ein Beispiel in dem Kupferstiche mit St. Johannes Ev. auf Pathmos, der sich in der k. k. Hof bihliothek be-
findet (Fig. 58). Gerne setzt auch unser Künstler, was besonders am Berliner Relief Adam und Eva auf-
fällig hervortritt, den Fuss, der leicht etwas gross und steif geräth, mit der vollen Sohle auf den Boden
auf. Endlich darf aber auch der Inhalt der Darstellung der Rückseite unserer Medaille mit den Worten
Neudörfels in Verbindung gebracht werden: Krug »hatte einen scharfsinnigen köpf zu philosophiren«.
Ohne Zweifel bezog sich sein »philosophiren« auf sein Metier, die Kunst; und eben ein Stück
Kunstphilosophie stellt uns die Medaille vor Augen. Wir sehen die Natur, als solche charakterisirt durch
die Bärin mit dem Jungen zu ihren Füssen; die Natur setzt der ihr gegenüberstehenden Kunst einen
Lorbeerkranz aufs Haupt, und zwar für eine Thätigkeit, welche die Umschrift nennt: Ars perficit
naturam. Man versteht nicht sofort, was damit gemeint sei. Beachten wir aber die Attribute der
Kunst: auf dem Boden ein Winkelmass, auf dem Block vor ihr Pinsel und Palette und ein Buch, auf
dem ihre Linke ruht. Das Buch trägt (eingravirt in den
Stempel) eine nicht mit voller Sicherheit zu lesende Auf-
schrift; ... TA | TIO scheint sicher, die vorausgehende Zeile
heisst wahrscheinlich IMI. Also Imitatio. Das gäbe einen
guten Sinn. Die Kunst »hält sich« — hier kann das Wort im
ursprünglichsten Sinne verstanden werden — zunächst an
die Nachahmung, verstehe: der Natur. Aber damit ist ihre
Thätigkeit nicht erschöpft: Perficit naturam; sie verbessert,
sie vervollkommt die Natur. Das Letztere ist angedeutet
durch die Thätigkeit, die wir die Kunst mit ihrer Rechten
verrichten sehen: sie hat ein Stäbchen, scheinbar einen Pinsel,
in der Hand, — doch nicht um die Dame zu bemalen? Wir
haben ja keine Statue vor uns sondern die lebendige Natur,
und was wäre das für eine Kun stthätigkeit, eine Statue oder
gar ein Lebewesen zu bemalen! Wahrscheinlich ist doch,
dass sie von der Gestalt der Natur das Mass nimmt, nämlich
den »Canon« feststellt.
Das steht im besten Einklänge mit der Dürer'schen
Schönheitslehre, die wir wohl auch in der »Philosophie«
Ludwig Krug's suchen dürfen; Dürer nämlich lehrt:
a) Die Natur ist der beste, ja der einzige rechte Lehr-
meister. Die Kunst wurzelt fest in der Natur und, wer diese
wiedergeben kann, der besitzt auch jene. »Dann warhaftig
steckt die kunst in der natur. Wer sie raus kan reissen, der hat sie« (Von menschlicher Proportion,
Londoner Handschrift, Lange und Fuhse, a. a. O., S. 363.)
b) Aber die Natur ist seit der Erbsünde verderbt. Nur drei vollkommen schöne Menschen hat es
gegeben: Adam und Eva und die Madonna (seil, immaculate coneepta!). Der Künstler ist daher ge-
zwungen, »die Schönheitszüge weit zusammenzutragen, sonderlich bei .der menschlichen Gestalt alle
Glieder vorne und hinten zu prüfen.«
Schon die Alten, wie »Phidias, Praxiteles, Apelles hatten ihre Kunst beschrieben und, wie man
wohl gestaltete Gliedmassen der Menschen machen soll, angezeigt«. In ihren verloren gegangenen
Schriften »mochte wohl zu lesen sein, welche Proportionen Jupiter, welche Apollo, Venus oder Her-
kules besitzen müsse. Mit Hilfe der Proportionslehre kann die ursprüngliche (paradiesische) Voll-
kommenheit des Menschen wenigstens in 'der Kunst wiederhergestellt werden« (A. Springer, Albrecht
Dürer, 1892, Cap. XI, S. ii2ff.). »Darum ist von nöten, dass man recht künstlich messen lern. Wer das
wol kan, der macht wunderbärlich ding. Dann die menschlich gestalt kann nit mit richtscheiten oder
zirkeln umzogen werden, aber von puneten zu puneten werde die gezogen . . . Und ausserhalb rechter
mass werde keiner nichts gutes machen« (Von menschlicher Proportion, Lange und Fuhse, S. 23i).
Fig. 58.