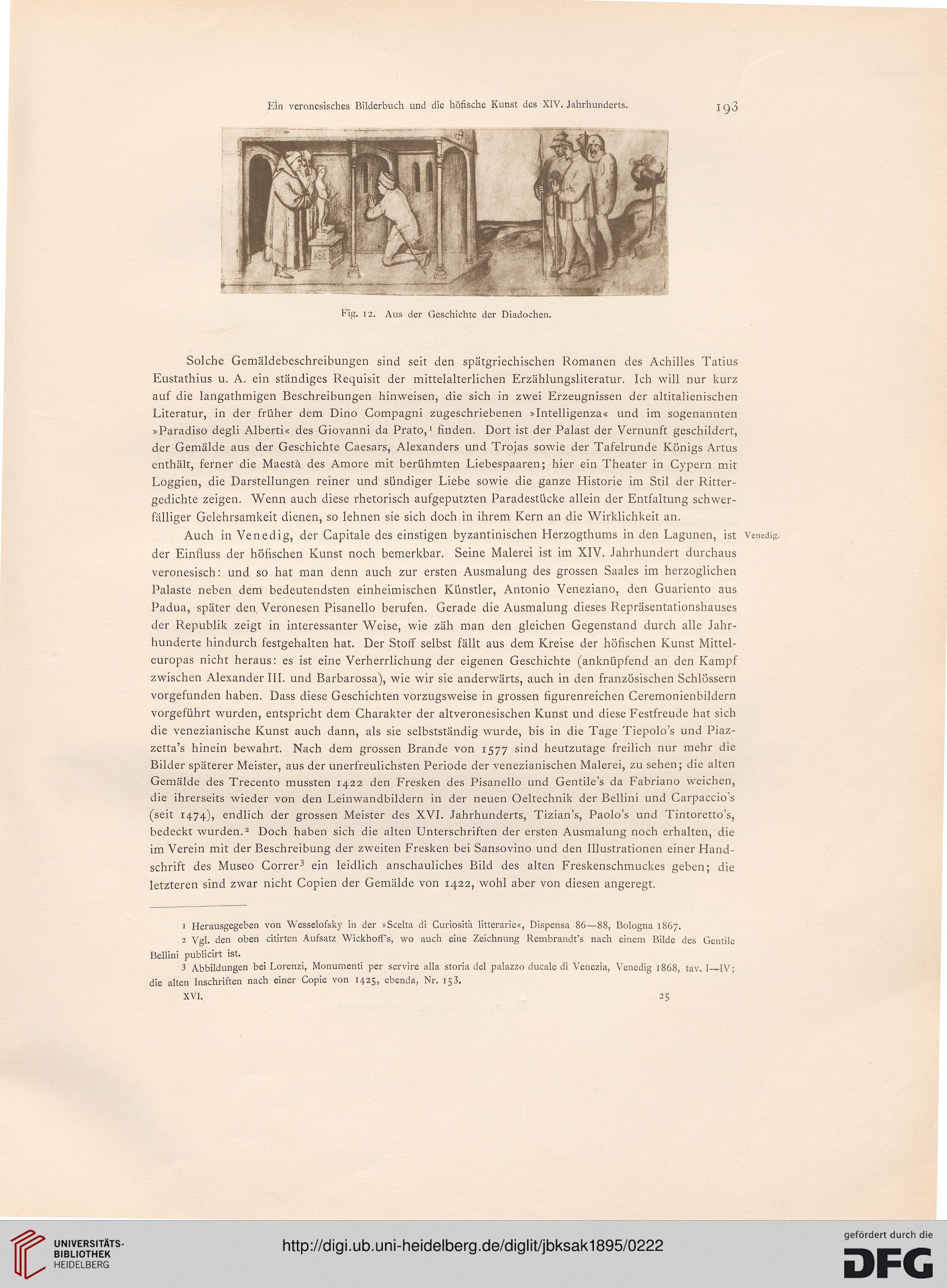Ein veronesisches Bilderbuch und die höfische Kunst des XIV. Jahrhunderls.
Solche Gemäldebeschreibungen sind seit den spätgriechischen Romanen des Achilles Tatius
Eustathius u. A. ein ständiges Requisit der mittelalterlichen Erzählungsliteratur. Ich will nur kurz
auf die langathmigen Beschreibungen hinweisen, die sich in zwei Erzeugnissen der altitalienischen
Literatur, in der früher dem Dino Compagni zugeschriebenen »Intelligenza« und im sogenannten
»Paradiso degli Alberti« des Giovanni da Prato,1 finden. Dort ist der Palast der Vernunft geschildert,
der Gemälde aus der Geschichte Caesars, Alexanders und Trojas sowie der Tafelrunde Königs Artus
enthält, ferner die Maestä des Amore mit berühmten Liebespaaren; hier ein Theater in Cypern mit
Loggien, die Darstellungen reiner und sündiger Liebe sowie die ganze Historie im Stil der Ritter-
gedichte zeigen. Wenn auch diese rhetorisch aufgeputzten Paradestücke allein der Entfaltung schwer-
fälliger Gelehrsamkeit dienen, so lehnen sie sich doch in ihrem Kern an die Wirklichkeit an.
Auch in Venedig, der Capitale des einstigen byzantinischen Herzogthums in den Lagunen, ist Venedig,
der Einfluss der höfischen Kunst noch bemerkbar. Seine Malerei ist im XIV. Jahrhundert durchaus
veronesisch: und so hat man denn auch zur ersten Ausmalung des grossen Saales im herzoglichen
Palaste neben dem bedeutendsten einheimischen Künstler, Antonio Veneziano, den Guariento aus
Padua, später den Veronesen Pisanello berufen. Gerade die Ausmalung dieses Repräsentationshauses
der Republik zeigt in interessanter Weise, wie zäh man den gleichen Gegenstand durch alle Jahr-
hunderte hindurch festgehalten hat. Der Stoff selbst fällt aus dem Kreise der höfischen Kunst Mittel-
europas nicht heraus: es ist eine Verherrlichung der eigenen Geschichte (anknüpfend an den Kampf
zwischen Alexander III. und Barbarossa), wie wir sie anderwärts, auch in den französischen Schlössern
vorgefunden haben. Dass diese Geschichten vorzugsweise in grossen figurenreichen Ceremonienbildern
vorgeführt wurden, entspricht dem Charakter der altveronesischen Kunst und diese Festfreude hat sich
die venezianische Kunst auch dann, als sie selbstständig wurde, bis in die Tage Tiepolo's und Piaz-
zetta's hinein bewahrt. Nach dem grossen Brande von 1577 sind heutzutage freilich nur mehr die
Bilder späterer Meister, aus der unerfreulichsten Periode der venezianischen Malerei, zu sehen; die alten
Gemälde des Trecento mussten 1422 den Fresken des Pisanello und Gentile's da Fabriano weichen,
die ihrerseits wieder von den Leinwandbildern in der neuen Oeltechnik der Bellini und Carpaccio's
(seit 1474), endlich der grossen Meister des XVI. Jahrhunderts, Tizian's, Paolo's und Tintoretto's,
bedeckt wurden.2 Doch haben sich die alten Unterschriften der ersten Ausmalung noch erhalten, die
im Verein mit der Beschreibung der zweiten Fresken bei Sansovino und den Illustrationen einer Hand-
schrift des Museo Correr3 ein leidlich anschauliches Bild des alten Freskenschmuckes geben; die
letzteren sind zwar nicht Copien der Gemälde von 1422, wohl aber von diesen angeregt.
1 Herausgegeben von Wesselofsky in der »Scelta di Curiositä litterarie«, Dispensa 86—88, Bologna 1867.
2 Vgl. den oben citirten Aufsatz Wickhoffs, wo auch eine Zeichnung Rembrandt's nach einem Bilde des Gentile
Bellini publicirt ist.
3 Abbildungen bei Lorenzi, Monumenti per servire alla storia del palazzo ducale di Venezia, Venedig 1868, tav. I_IV;
die alten Inschriften nach einer Copie von 1425, ebenda, Nr. 153.
XVI. 25
Solche Gemäldebeschreibungen sind seit den spätgriechischen Romanen des Achilles Tatius
Eustathius u. A. ein ständiges Requisit der mittelalterlichen Erzählungsliteratur. Ich will nur kurz
auf die langathmigen Beschreibungen hinweisen, die sich in zwei Erzeugnissen der altitalienischen
Literatur, in der früher dem Dino Compagni zugeschriebenen »Intelligenza« und im sogenannten
»Paradiso degli Alberti« des Giovanni da Prato,1 finden. Dort ist der Palast der Vernunft geschildert,
der Gemälde aus der Geschichte Caesars, Alexanders und Trojas sowie der Tafelrunde Königs Artus
enthält, ferner die Maestä des Amore mit berühmten Liebespaaren; hier ein Theater in Cypern mit
Loggien, die Darstellungen reiner und sündiger Liebe sowie die ganze Historie im Stil der Ritter-
gedichte zeigen. Wenn auch diese rhetorisch aufgeputzten Paradestücke allein der Entfaltung schwer-
fälliger Gelehrsamkeit dienen, so lehnen sie sich doch in ihrem Kern an die Wirklichkeit an.
Auch in Venedig, der Capitale des einstigen byzantinischen Herzogthums in den Lagunen, ist Venedig,
der Einfluss der höfischen Kunst noch bemerkbar. Seine Malerei ist im XIV. Jahrhundert durchaus
veronesisch: und so hat man denn auch zur ersten Ausmalung des grossen Saales im herzoglichen
Palaste neben dem bedeutendsten einheimischen Künstler, Antonio Veneziano, den Guariento aus
Padua, später den Veronesen Pisanello berufen. Gerade die Ausmalung dieses Repräsentationshauses
der Republik zeigt in interessanter Weise, wie zäh man den gleichen Gegenstand durch alle Jahr-
hunderte hindurch festgehalten hat. Der Stoff selbst fällt aus dem Kreise der höfischen Kunst Mittel-
europas nicht heraus: es ist eine Verherrlichung der eigenen Geschichte (anknüpfend an den Kampf
zwischen Alexander III. und Barbarossa), wie wir sie anderwärts, auch in den französischen Schlössern
vorgefunden haben. Dass diese Geschichten vorzugsweise in grossen figurenreichen Ceremonienbildern
vorgeführt wurden, entspricht dem Charakter der altveronesischen Kunst und diese Festfreude hat sich
die venezianische Kunst auch dann, als sie selbstständig wurde, bis in die Tage Tiepolo's und Piaz-
zetta's hinein bewahrt. Nach dem grossen Brande von 1577 sind heutzutage freilich nur mehr die
Bilder späterer Meister, aus der unerfreulichsten Periode der venezianischen Malerei, zu sehen; die alten
Gemälde des Trecento mussten 1422 den Fresken des Pisanello und Gentile's da Fabriano weichen,
die ihrerseits wieder von den Leinwandbildern in der neuen Oeltechnik der Bellini und Carpaccio's
(seit 1474), endlich der grossen Meister des XVI. Jahrhunderts, Tizian's, Paolo's und Tintoretto's,
bedeckt wurden.2 Doch haben sich die alten Unterschriften der ersten Ausmalung noch erhalten, die
im Verein mit der Beschreibung der zweiten Fresken bei Sansovino und den Illustrationen einer Hand-
schrift des Museo Correr3 ein leidlich anschauliches Bild des alten Freskenschmuckes geben; die
letzteren sind zwar nicht Copien der Gemälde von 1422, wohl aber von diesen angeregt.
1 Herausgegeben von Wesselofsky in der »Scelta di Curiositä litterarie«, Dispensa 86—88, Bologna 1867.
2 Vgl. den oben citirten Aufsatz Wickhoffs, wo auch eine Zeichnung Rembrandt's nach einem Bilde des Gentile
Bellini publicirt ist.
3 Abbildungen bei Lorenzi, Monumenti per servire alla storia del palazzo ducale di Venezia, Venedig 1868, tav. I_IV;
die alten Inschriften nach einer Copie von 1425, ebenda, Nr. 153.
XVI. 25