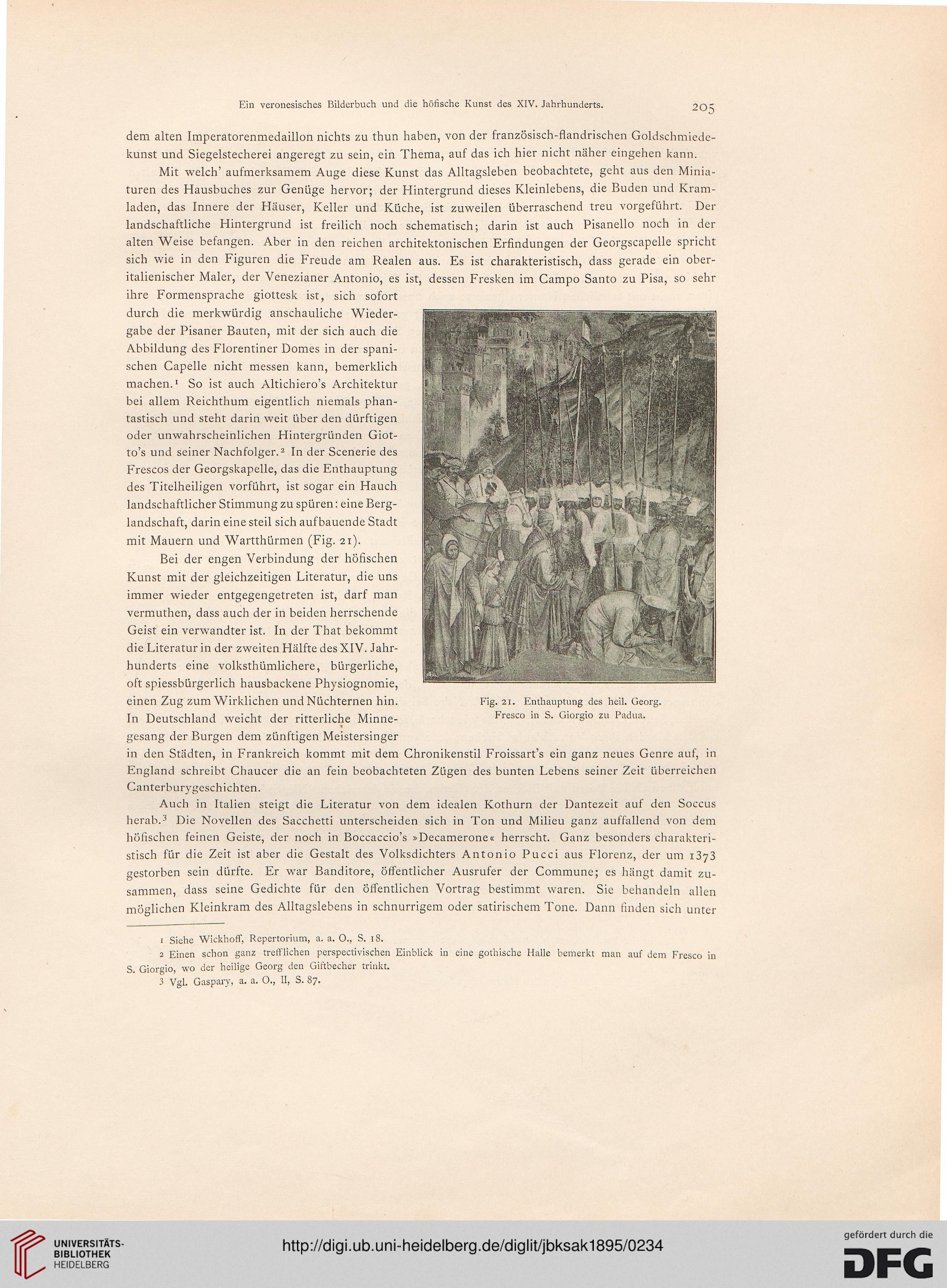Ein veronesisches Bilderbuch und die höfische Kunst des XIV. Jahrhunderts.
205
dem alten Imperatorenmedaillon nichts zu thun haben, von der französisch-flandrischen Goldschmiede-
kunst und Siegelstecherei angeregt zu sein, ein Thema, auf das ich hier nicht näher eingehen kann.
Mit welch' aufmerksamem Auge diese Kunst das Alltagsleben beobachtete, geht aus den Minia-
turen des Hausbuches zur Genüge hervor; der Hintergrund dieses Kleinlebens, die Buden und Kram-
laden, das Innere der Häuser, Keller und Küche, ist zuweilen überraschend treu vorgeführt. Der
landschaftliche Hintergrund ist freilich noch schematisch; darin ist auch Pisanello noch in der
alten Weise befangen. Aber in den reichen architektonischen Erfindungen der Georgscapelle spricht
sich wie in den Figuren die Freude am Realen aus. Es ist charakteristisch, dass gerade ein ober-
italienischer Maler, der Venezianer Antonio, es ist, dessen Fresken im Campo Santo zu Pisa, so sehr
ihre Formensprache giottesk ist, sich sofort
durch die merkwürdig anschauliche Wieder-
gabe der Pisaner Bauten, mit der sich auch die
Abbildung des Florentiner Domes in der spani-
schen Capelle nicht messen kann, bemerklich
machen.1 So ist auch Altichiero's Architektur
bei allem Reichthum eigentlich niemals phan-
tastisch und steht darin weit über den dürftigen
oder unwahrscheinlichen Hintergründen Giot-
to's und seiner Nachfolger.2 In der Scenerie des
Frescos der Georgskapelle, das die Enthauptung
des Titelheiligen vorführt, ist sogar ein Hauch
landschaftlicher Stimmung zu spüren: eine Berg-
landschaft, darin eine steil sich aufbauende Stadt
mit Mauern und Wartthürmen (Fig. 21).
Bei der engen Verbindung der höfischen
Kunst mit der gleichzeitigen Literatur, die uns
immer wieder entgegengetreten ist, darf man
vermuthen, dass auch der in beiden herrschende
Geist ein verwandter ist. In der That bekommt
die Literatur in der zweiten Hälfte des XIV. Jahr-
hunderts eine volkstümlichere, bürgerliche,
oft spiessbürgerlich hausbackene Physiognomie,
einen Zug zum Wirklichen und Nüchternen hin.
In Deutschland weicht der ritterliche Minne-
gesang der Burgen dem zünftigen Meistersinger
in den Städten, in Frankreich kommt mit dem Chronikenstil Froissart's ein ganz neues Genre auf, in
England schreibt Chaucer die an fein beobachteten Zügen des bunten Lebens seiner Zeit überreichen
Canterburygeschichten.
Auch in Italien steigt die Literatur von dem idealen Kothurn der Dantezeit auf den Soccus
herab.3 Die Novellen des Sacchetti unterscheiden sich in Ton und Milieu ganz auffallend von dem
höfischen feinen Geiste, der noch in Boccaccio's »Decamerone« herrscht. Ganz besonders charakteri-
stisch für die Zeit ist aber die Gestalt des Volksdichters Antonio Pucci aus Florenz, der um 1373
gestorben sein dürfte. Er war Banditore, öffentlicher Ausrufer der Commune; es hängt damit zu-
sammen, dass seine Gedichte für den öffentlichen Vortrag bestimmt waren. Sie behandeln allen
möglichen Kleinkram des Alltagslebens in schnurrigem oder satirischem Tone. Dann finden sich unter
Fig. 21. Enthauptung des heil. Georg
Fresco in S. Gioraio zu Padua.
1 Siehe Wickhoff, Repertorium, a. a. O., S. 18.
2 Einen schon ganz trefflichen perspectivischen Einblick in eine gothische Halle bemerkt man auf dem Fresco
S. Giorgio, wo der heilige Georg den Giftbecher trinkt.
3 Vgl. Gaspary, a. a. O., II, S. 87.
205
dem alten Imperatorenmedaillon nichts zu thun haben, von der französisch-flandrischen Goldschmiede-
kunst und Siegelstecherei angeregt zu sein, ein Thema, auf das ich hier nicht näher eingehen kann.
Mit welch' aufmerksamem Auge diese Kunst das Alltagsleben beobachtete, geht aus den Minia-
turen des Hausbuches zur Genüge hervor; der Hintergrund dieses Kleinlebens, die Buden und Kram-
laden, das Innere der Häuser, Keller und Küche, ist zuweilen überraschend treu vorgeführt. Der
landschaftliche Hintergrund ist freilich noch schematisch; darin ist auch Pisanello noch in der
alten Weise befangen. Aber in den reichen architektonischen Erfindungen der Georgscapelle spricht
sich wie in den Figuren die Freude am Realen aus. Es ist charakteristisch, dass gerade ein ober-
italienischer Maler, der Venezianer Antonio, es ist, dessen Fresken im Campo Santo zu Pisa, so sehr
ihre Formensprache giottesk ist, sich sofort
durch die merkwürdig anschauliche Wieder-
gabe der Pisaner Bauten, mit der sich auch die
Abbildung des Florentiner Domes in der spani-
schen Capelle nicht messen kann, bemerklich
machen.1 So ist auch Altichiero's Architektur
bei allem Reichthum eigentlich niemals phan-
tastisch und steht darin weit über den dürftigen
oder unwahrscheinlichen Hintergründen Giot-
to's und seiner Nachfolger.2 In der Scenerie des
Frescos der Georgskapelle, das die Enthauptung
des Titelheiligen vorführt, ist sogar ein Hauch
landschaftlicher Stimmung zu spüren: eine Berg-
landschaft, darin eine steil sich aufbauende Stadt
mit Mauern und Wartthürmen (Fig. 21).
Bei der engen Verbindung der höfischen
Kunst mit der gleichzeitigen Literatur, die uns
immer wieder entgegengetreten ist, darf man
vermuthen, dass auch der in beiden herrschende
Geist ein verwandter ist. In der That bekommt
die Literatur in der zweiten Hälfte des XIV. Jahr-
hunderts eine volkstümlichere, bürgerliche,
oft spiessbürgerlich hausbackene Physiognomie,
einen Zug zum Wirklichen und Nüchternen hin.
In Deutschland weicht der ritterliche Minne-
gesang der Burgen dem zünftigen Meistersinger
in den Städten, in Frankreich kommt mit dem Chronikenstil Froissart's ein ganz neues Genre auf, in
England schreibt Chaucer die an fein beobachteten Zügen des bunten Lebens seiner Zeit überreichen
Canterburygeschichten.
Auch in Italien steigt die Literatur von dem idealen Kothurn der Dantezeit auf den Soccus
herab.3 Die Novellen des Sacchetti unterscheiden sich in Ton und Milieu ganz auffallend von dem
höfischen feinen Geiste, der noch in Boccaccio's »Decamerone« herrscht. Ganz besonders charakteri-
stisch für die Zeit ist aber die Gestalt des Volksdichters Antonio Pucci aus Florenz, der um 1373
gestorben sein dürfte. Er war Banditore, öffentlicher Ausrufer der Commune; es hängt damit zu-
sammen, dass seine Gedichte für den öffentlichen Vortrag bestimmt waren. Sie behandeln allen
möglichen Kleinkram des Alltagslebens in schnurrigem oder satirischem Tone. Dann finden sich unter
Fig. 21. Enthauptung des heil. Georg
Fresco in S. Gioraio zu Padua.
1 Siehe Wickhoff, Repertorium, a. a. O., S. 18.
2 Einen schon ganz trefflichen perspectivischen Einblick in eine gothische Halle bemerkt man auf dem Fresco
S. Giorgio, wo der heilige Georg den Giftbecher trinkt.
3 Vgl. Gaspary, a. a. O., II, S. 87.