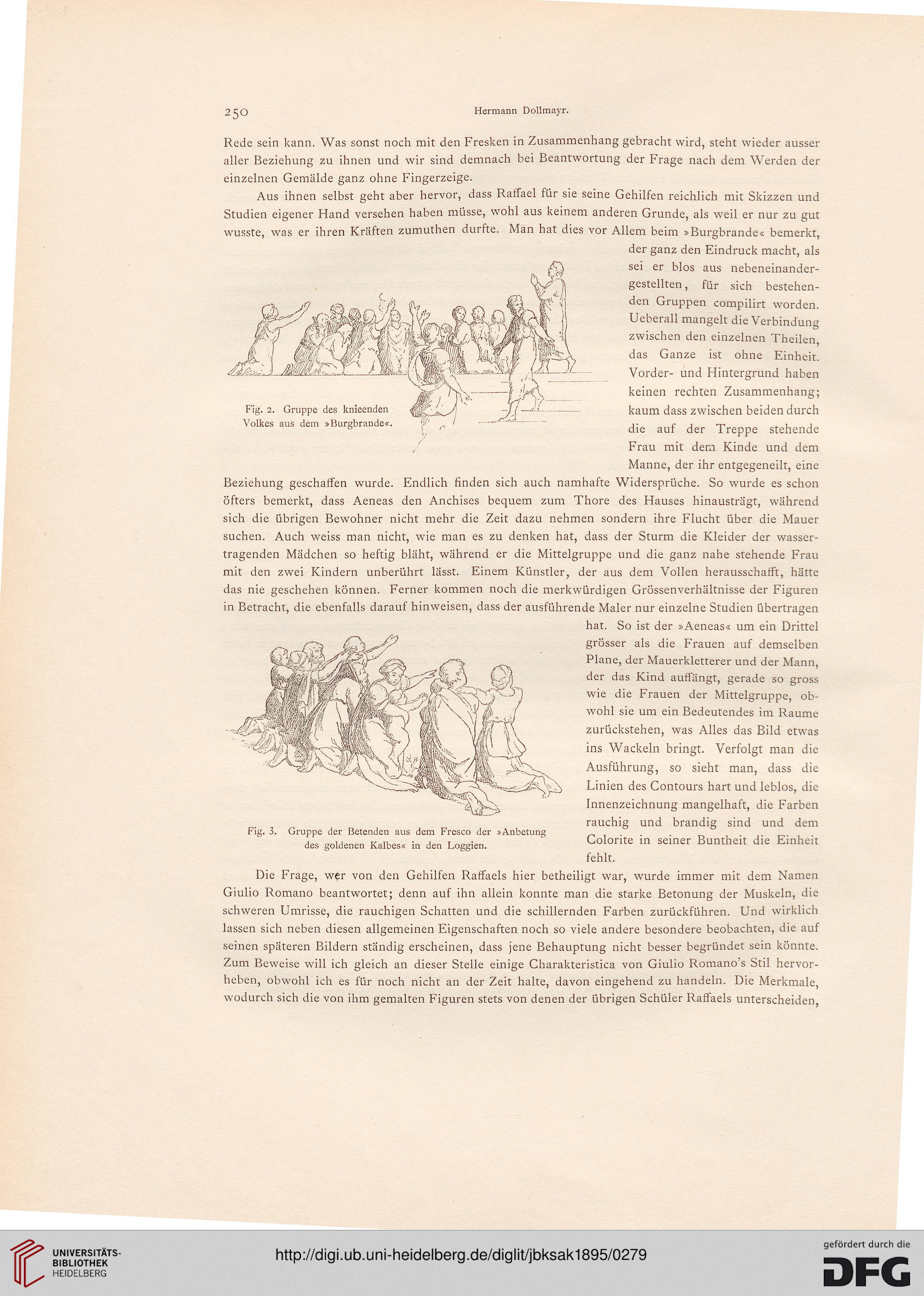Hermann Dollmayr.
Fig. 2. Gruppe des knieenden
Volkes aus dem »Burgbrande«
Rede sein kann. Was sonst noch mit den Fresken in Zusammenhang gebracht wird, steht wieder ausser
aller Beziehung zu ihnen und wir sind demnach bei Beantwortung der Frage nach dem Werden der
einzelnen Gemälde ganz ohne Fingerzeige.
Aus ihnen selbst geht aber hervor, dass Raffael für sie seine Gehilfen reichlich mit Skizzen und
Studien eigener Hand versehen haben müsse, wohl aus keinem anderen Grunde, als weil er nur zu gut
wusste, was er ihren Kräften zumuthen durfte. Man hat dies vor Allem beim »Burgbrande« bemerkt,
der ganz den Eindruck macht, als
sei er blos aus nebeneinander-
gestellten, für sich bestehen-
den Gruppen compilirt worden.
Ueberall mangelt die Verbindung
zwischen den einzelnen Theilen,
das Ganze ist ohne Einheit.
Vorder- und Hintergrund haben
keinen rechten Zusammenhang;
kaum dass zwischen beiden durch
die auf der Treppe stehende
,/ Frau mit dem Kinde und dem
Manne, der ihr entgegeneilt, eine
Beziehung geschaffen wurde. Endlich finden sich auch namhafte Widersprüche. So wurde es schon
öfters bemerkt, dass Aeneas den Anchises bequem zum Thore des Hauses hinausträgt, während
sich die übrigen Bewohner nicht mehr die Zeit dazu nehmen sondern ihre Flucht über die Mauer
suchen. Auch weiss man nicht, wie man es zu denken hat, dass der Sturm die Kleider der wasser-
tragenden Mädchen so heftig bläht, während er die Mittelgruppe und die ganz nahe stehende Frau
mit den zwei Kindern unberührt lässt. Einem Künstler, der aus dem Vollen herausschafft, hätte
das nie geschehen können. Ferner kommen noch die merkwürdigen Grössenverhältnisse der Figuren
in Betracht, die ebenfalls darauf hinweisen, dass der ausführende Maler nur einzelne Studien übertragen
hat. So ist der »Aeneas« um ein Drittel
grösser als die Frauen auf demselben
Plane, der Mauerkletterer und der Mann,
der das Kind auffangt, gerade so gross
wie die Frauen der Mittelgruppe, ob-
wohl sie um ein Bedeutendes im Räume
zurückstehen, was Alles das Bild etwas
ins Wackeln bringt. Verfolgt man die
Ausführung, so sieht man, dass die
Linien des Contours hart und leblos, die
Innenzeichnung mangelhaft, die Farben
rauchig und brandig sind und dem
Colorite in seiner Buntheit die Einheit
fehlt.
Die Frage, wer von den Gehilfen Raffaels hier betheiligt war, wurde immer mit dem Namen
Giulio Romano beantwortet; denn auf ihn allein konnte man die starke Betonung der Muskeln, die
schweren Umrisse, die rauchigen Schatten und die schillernden Farben zurückführen. Und wirklich
lassen sich neben diesen allgemeinen Eigenschaften noch so viele andere besondere beobachten, die auf
seinen späteren Bildern ständig erscheinen, dass jene Behauptung nicht besser begründet sein könnte.
Zum Beweise will ich gleich an dieser Stelle einige Charakteristica von Giulio Romano's Stil hervor-
heben, obwohl ich es für noch nicht an der Zeit halte, davon eingehend zu handeln. Die Merkmale,
wodurch sich die von ihm gemalten Figuren stets von denen der übrigen Schüler Raffaels unterscheiden,
Fig. 3. Gruppe der Betenden aus dem Fresco der »Anbetung
des goldenen Kalbes« in den Loggien.
Fig. 2. Gruppe des knieenden
Volkes aus dem »Burgbrande«
Rede sein kann. Was sonst noch mit den Fresken in Zusammenhang gebracht wird, steht wieder ausser
aller Beziehung zu ihnen und wir sind demnach bei Beantwortung der Frage nach dem Werden der
einzelnen Gemälde ganz ohne Fingerzeige.
Aus ihnen selbst geht aber hervor, dass Raffael für sie seine Gehilfen reichlich mit Skizzen und
Studien eigener Hand versehen haben müsse, wohl aus keinem anderen Grunde, als weil er nur zu gut
wusste, was er ihren Kräften zumuthen durfte. Man hat dies vor Allem beim »Burgbrande« bemerkt,
der ganz den Eindruck macht, als
sei er blos aus nebeneinander-
gestellten, für sich bestehen-
den Gruppen compilirt worden.
Ueberall mangelt die Verbindung
zwischen den einzelnen Theilen,
das Ganze ist ohne Einheit.
Vorder- und Hintergrund haben
keinen rechten Zusammenhang;
kaum dass zwischen beiden durch
die auf der Treppe stehende
,/ Frau mit dem Kinde und dem
Manne, der ihr entgegeneilt, eine
Beziehung geschaffen wurde. Endlich finden sich auch namhafte Widersprüche. So wurde es schon
öfters bemerkt, dass Aeneas den Anchises bequem zum Thore des Hauses hinausträgt, während
sich die übrigen Bewohner nicht mehr die Zeit dazu nehmen sondern ihre Flucht über die Mauer
suchen. Auch weiss man nicht, wie man es zu denken hat, dass der Sturm die Kleider der wasser-
tragenden Mädchen so heftig bläht, während er die Mittelgruppe und die ganz nahe stehende Frau
mit den zwei Kindern unberührt lässt. Einem Künstler, der aus dem Vollen herausschafft, hätte
das nie geschehen können. Ferner kommen noch die merkwürdigen Grössenverhältnisse der Figuren
in Betracht, die ebenfalls darauf hinweisen, dass der ausführende Maler nur einzelne Studien übertragen
hat. So ist der »Aeneas« um ein Drittel
grösser als die Frauen auf demselben
Plane, der Mauerkletterer und der Mann,
der das Kind auffangt, gerade so gross
wie die Frauen der Mittelgruppe, ob-
wohl sie um ein Bedeutendes im Räume
zurückstehen, was Alles das Bild etwas
ins Wackeln bringt. Verfolgt man die
Ausführung, so sieht man, dass die
Linien des Contours hart und leblos, die
Innenzeichnung mangelhaft, die Farben
rauchig und brandig sind und dem
Colorite in seiner Buntheit die Einheit
fehlt.
Die Frage, wer von den Gehilfen Raffaels hier betheiligt war, wurde immer mit dem Namen
Giulio Romano beantwortet; denn auf ihn allein konnte man die starke Betonung der Muskeln, die
schweren Umrisse, die rauchigen Schatten und die schillernden Farben zurückführen. Und wirklich
lassen sich neben diesen allgemeinen Eigenschaften noch so viele andere besondere beobachten, die auf
seinen späteren Bildern ständig erscheinen, dass jene Behauptung nicht besser begründet sein könnte.
Zum Beweise will ich gleich an dieser Stelle einige Charakteristica von Giulio Romano's Stil hervor-
heben, obwohl ich es für noch nicht an der Zeit halte, davon eingehend zu handeln. Die Merkmale,
wodurch sich die von ihm gemalten Figuren stets von denen der übrigen Schüler Raffaels unterscheiden,
Fig. 3. Gruppe der Betenden aus dem Fresco der »Anbetung
des goldenen Kalbes« in den Loggien.