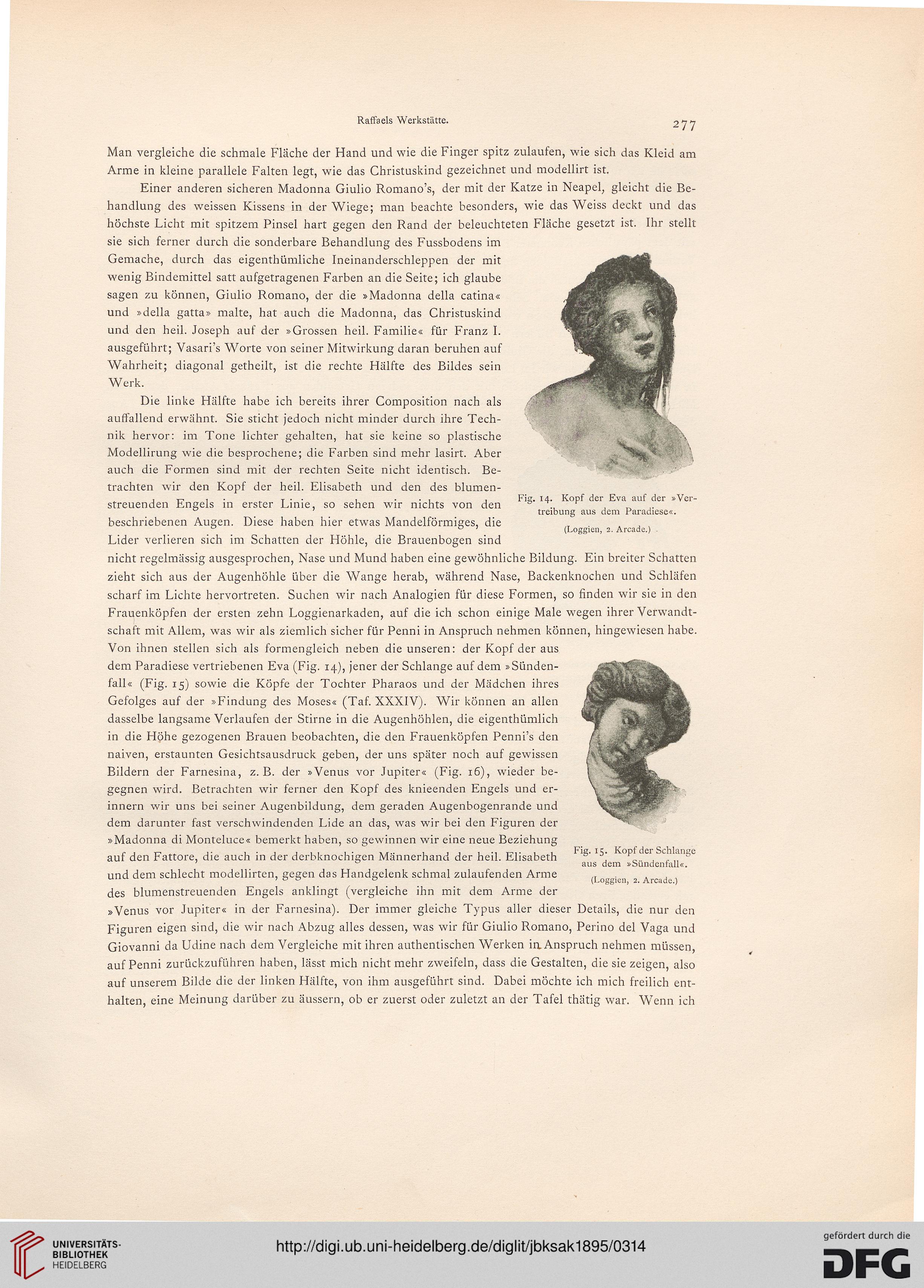Raffaels Werkstätte.
277
Fig. 14. Kopf der Eva auf der »Ver-
treibung aus dem Paradiese«.
(Loggien, 2. Arcade.)
Man vergleiche die schmale Fläche der Hand und wie die Finger spitz zulaufen, wie sich das Kleid am
Arme in kleine parallele Falten legt, wie das Christuskind gezeichnet und modellirt ist.
Einer anderen sicheren Madonna Giulio Romano's, der mit der Katze in Neapel, gleicht die Be-
handlung des weissen Kissens in der Wiege; man beachte besonders, wie das Weiss deckt und das
höchste Licht mit spitzem Pinsel hart gegen den Rand der beleuchteten Fläche gesetzt ist. Ihr stellt
sie sich ferner durch die sonderbare Behandlung des Fussbodens im
Gemache, durch das eigenthümliche Ineinanderschleppen der mit
wenig Bindemittel satt aufgetragenen Farben an die Seite; ich glaube
sagen zu können, Giulio Romano, der die »Madonna della catina«
und »della gatta» malte, hat auch die Madonna, das Christuskind
und den heil. Joseph auf der »Grossen heil. Familie« für Franz I.
ausgeführt; Vasari's Worte von seiner Mitwirkung daran beruhen auf
Wahrheit; diagonal getheilt, ist die rechte Hälfte des Bildes sein
Werk.
Die linke Hälfte habe ich bereits ihrer Composition nach als
auffallend erwähnt. Sie sticht jedoch nicht minder durch ihre Tech-
nik hervor: im Tone lichter gehalten, hat sie keine so plastische
Modellirung wie die besprochene; die Farben sind mehr lasirt. Aber
auch die Formen sind mit der rechten Seite nicht identisch. Be-
trachten wir den Kopf der heil. Elisabeth und den des blumen-
streuenden Engels in erster Linie, so sehen wir nichts von den
beschriebenen Augen. Diese haben hier etwas Mandelförmiges, die
Lider verlieren sich im Schatten der Höhle, die Brauenbogen sind
nicht regelmässig ausgesprochen, Nase und Mund haben eine gewöhnliche Bildung. Ein breiter Schatten
zieht sich aus der Augenhöhle über die Wange herab, während Nase, Backenknochen und Schläfen
scharf im Lichte hervortreten. Suchen wir nach Analogien für diese Formen, so finden wir sie in den
Frauenköpfen der ersten zehn Loggienarkaden, auf die ich schon einige Male wegen ihrer Verwandt-
schaft mit Allem, was wir als ziemlich sicher für Penni in Anspruch nehmen können, hingewiesen habe.
Von ihnen stellen sich als formengleich neben die unseren: der Kopf der aus
dem Paradiese vertriebenen Eva (Fig. 14), jener der Schlange auf dem »Sünden-
fall« (Fig. 15) sowie die Köpfe der Tochter Pharaos und der Mädchen ihres
Gefolges auf der »Findung des Moses« (Taf. XXXIV). Wir können an allen
dasselbe langsame Verlaufen der Stirne in die Augenhöhlen, die eigenthümlich
in die Höhe gezogenen Brauen beobachten, die den Frauenköpfen Penni's den
naiven, erstaunten Gesichtsausdruck geben, der uns später noch auf gewissen
Bildern der Farnesina, z.B. der »Venus vor Jupiter« (Fig. 16), wieder be-
gegnen wird. Betrachten wir ferner den Kopf des knieenden Engels und er-
innern wir uns bei seiner Augenbildung, dem geraden Augenbogenrande und
dem darunter fast verschwindenden Lide an das, was wir bei den Figuren der
»Madonna di Monteluce« bemerkt haben, so gewinnen wir eine neue Beziehung
auf den Fattore, die auch in der derbknochigen Männerhand der heil. Elisabeth
und dem schlecht modellirten, gegen das Handgelenk schmal zulaufenden Arme
des blumenstreuenden Engels anklingt (vergleiche ihn mit dem Arme der
»Venus vor Jupiter« in der Farnesina). Der immer gleiche Typus aller dieser Details, die nur den
Figuren eigen sind, die wir nach Abzug alles dessen, was wir für Giulio Romano, Perino del Vaga und
Giovanni da Udine nach dem Vergleiche mit ihren authentischen Werken ia Anspruch nehmen müssen,
auf Penni zurückzuführen haben, lässt mich nicht mehr zweifeln, dass die Gestalten, die sie zeigen, also
auf unserem Bilde die der linken Hälfte, von ihm ausgeführt sind. Dabei möchte ich mich freilich ent-
halten, eine Meinung darüber zu äussern, ob er zuerst oder zuletzt an der Tafel thätig war. Wenn ich
Fig. 15. Kopf der Schlange
aus dem »Sündenfall«.
(Loggien, 2. Arcade.)
277
Fig. 14. Kopf der Eva auf der »Ver-
treibung aus dem Paradiese«.
(Loggien, 2. Arcade.)
Man vergleiche die schmale Fläche der Hand und wie die Finger spitz zulaufen, wie sich das Kleid am
Arme in kleine parallele Falten legt, wie das Christuskind gezeichnet und modellirt ist.
Einer anderen sicheren Madonna Giulio Romano's, der mit der Katze in Neapel, gleicht die Be-
handlung des weissen Kissens in der Wiege; man beachte besonders, wie das Weiss deckt und das
höchste Licht mit spitzem Pinsel hart gegen den Rand der beleuchteten Fläche gesetzt ist. Ihr stellt
sie sich ferner durch die sonderbare Behandlung des Fussbodens im
Gemache, durch das eigenthümliche Ineinanderschleppen der mit
wenig Bindemittel satt aufgetragenen Farben an die Seite; ich glaube
sagen zu können, Giulio Romano, der die »Madonna della catina«
und »della gatta» malte, hat auch die Madonna, das Christuskind
und den heil. Joseph auf der »Grossen heil. Familie« für Franz I.
ausgeführt; Vasari's Worte von seiner Mitwirkung daran beruhen auf
Wahrheit; diagonal getheilt, ist die rechte Hälfte des Bildes sein
Werk.
Die linke Hälfte habe ich bereits ihrer Composition nach als
auffallend erwähnt. Sie sticht jedoch nicht minder durch ihre Tech-
nik hervor: im Tone lichter gehalten, hat sie keine so plastische
Modellirung wie die besprochene; die Farben sind mehr lasirt. Aber
auch die Formen sind mit der rechten Seite nicht identisch. Be-
trachten wir den Kopf der heil. Elisabeth und den des blumen-
streuenden Engels in erster Linie, so sehen wir nichts von den
beschriebenen Augen. Diese haben hier etwas Mandelförmiges, die
Lider verlieren sich im Schatten der Höhle, die Brauenbogen sind
nicht regelmässig ausgesprochen, Nase und Mund haben eine gewöhnliche Bildung. Ein breiter Schatten
zieht sich aus der Augenhöhle über die Wange herab, während Nase, Backenknochen und Schläfen
scharf im Lichte hervortreten. Suchen wir nach Analogien für diese Formen, so finden wir sie in den
Frauenköpfen der ersten zehn Loggienarkaden, auf die ich schon einige Male wegen ihrer Verwandt-
schaft mit Allem, was wir als ziemlich sicher für Penni in Anspruch nehmen können, hingewiesen habe.
Von ihnen stellen sich als formengleich neben die unseren: der Kopf der aus
dem Paradiese vertriebenen Eva (Fig. 14), jener der Schlange auf dem »Sünden-
fall« (Fig. 15) sowie die Köpfe der Tochter Pharaos und der Mädchen ihres
Gefolges auf der »Findung des Moses« (Taf. XXXIV). Wir können an allen
dasselbe langsame Verlaufen der Stirne in die Augenhöhlen, die eigenthümlich
in die Höhe gezogenen Brauen beobachten, die den Frauenköpfen Penni's den
naiven, erstaunten Gesichtsausdruck geben, der uns später noch auf gewissen
Bildern der Farnesina, z.B. der »Venus vor Jupiter« (Fig. 16), wieder be-
gegnen wird. Betrachten wir ferner den Kopf des knieenden Engels und er-
innern wir uns bei seiner Augenbildung, dem geraden Augenbogenrande und
dem darunter fast verschwindenden Lide an das, was wir bei den Figuren der
»Madonna di Monteluce« bemerkt haben, so gewinnen wir eine neue Beziehung
auf den Fattore, die auch in der derbknochigen Männerhand der heil. Elisabeth
und dem schlecht modellirten, gegen das Handgelenk schmal zulaufenden Arme
des blumenstreuenden Engels anklingt (vergleiche ihn mit dem Arme der
»Venus vor Jupiter« in der Farnesina). Der immer gleiche Typus aller dieser Details, die nur den
Figuren eigen sind, die wir nach Abzug alles dessen, was wir für Giulio Romano, Perino del Vaga und
Giovanni da Udine nach dem Vergleiche mit ihren authentischen Werken ia Anspruch nehmen müssen,
auf Penni zurückzuführen haben, lässt mich nicht mehr zweifeln, dass die Gestalten, die sie zeigen, also
auf unserem Bilde die der linken Hälfte, von ihm ausgeführt sind. Dabei möchte ich mich freilich ent-
halten, eine Meinung darüber zu äussern, ob er zuerst oder zuletzt an der Tafel thätig war. Wenn ich
Fig. 15. Kopf der Schlange
aus dem »Sündenfall«.
(Loggien, 2. Arcade.)