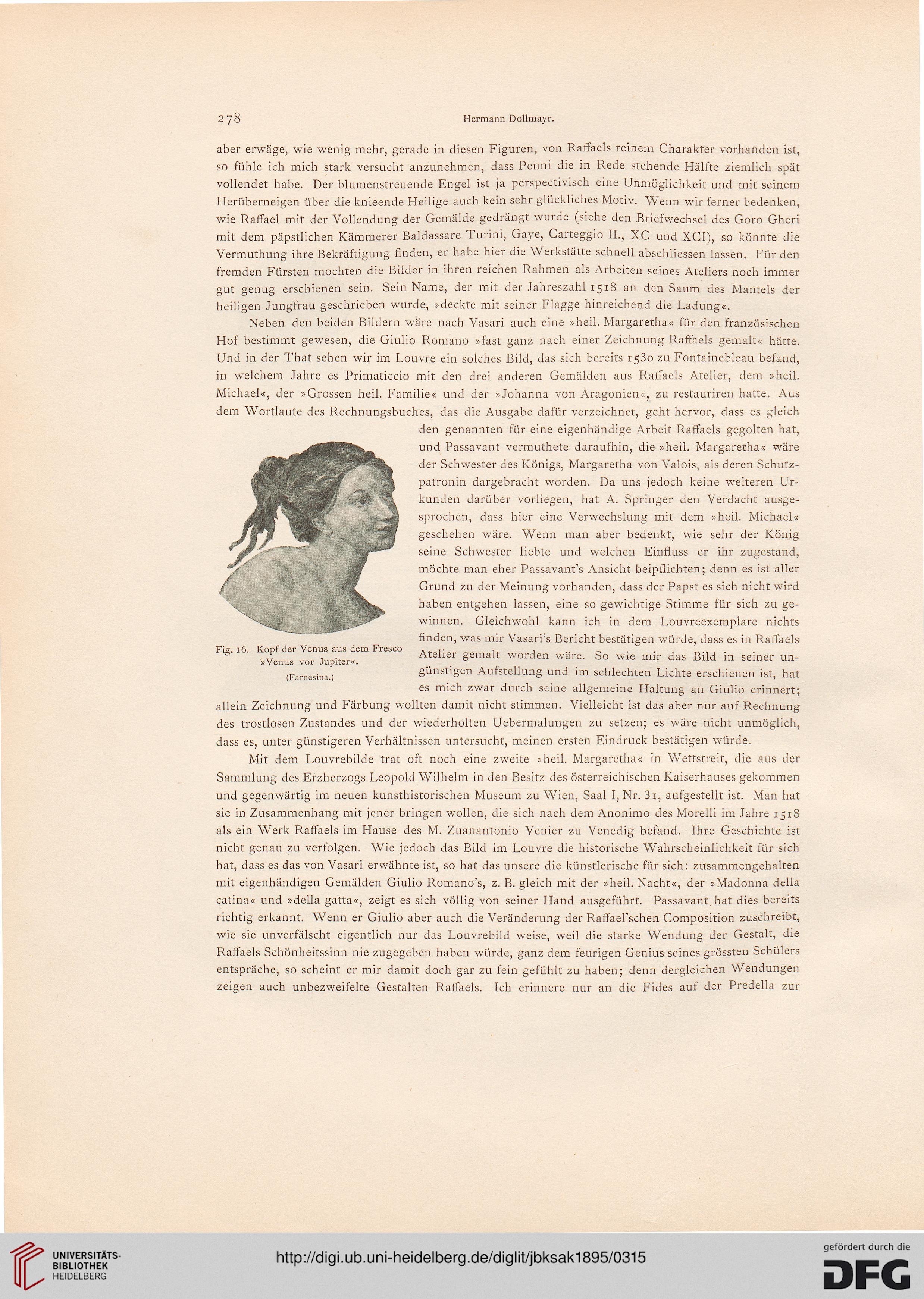278
Hermann Dollmayr.
aber erwäge, wie wenig mehr, gerade in diesen Figuren, von Raffaels reinem Charakter vorhanden ist,
so fühle ich mich stark versucht anzunehmen, dass Penni die in Rede stehende Hälfte ziemlich spät
vollendet habe. Der blumenstreuende Engel ist ja perspectivisch eine Unmöglichkeit und mit seinem
Herüberneigen über die knieende Heilige auch kein sehr glückliches Motiv. Wenn wir ferner bedenken,
wie Raffael mit der Vollendung der Gemälde gedrängt wurde (siehe den Briefwechsel des Goro Gheri
mit dem päpstlichen Kämmerer Baldassare Turini, Gaye, Carteggio IL, XC und XCI), so könnte die
Vermuthung ihre Bekräftigung finden, er habe hier die Werkstätte schnell abschliessen lassen. Für den
fremden Fürsten mochten die Bilder in ihren reichen Rahmen als Arbeiten seines Ateliers noch immer
gut genug erschienen sein. Sein Name, der mit der Jahreszahl 1518 an den Saum des Mantels der
heiligen Jungfrau geschrieben wurde, »deckte mit seiner Flagge hinreichend die Ladung«.
Neben den beiden Bildern wäre nach Vasari auch eine »heil. Margaretha« für den französischen
Hof bestimmt gewesen, die Giulio Romano »fast ganz nach einer Zeichnung Raffaels gemalt« hätte.
Und in der That sehen wir im Louvre ein solches Bild, das sich bereits 1530 zu Fontainebleau befand,
in welchem Jahre es Primaticcio mit den drei anderen Gemälden aus Raffaels Atelier, dem »heil.
Michael«, der »Grossen heil. Familie« und der »Johanna von Aragonien«, zu restauriren hatte. Aus
dem Wortlaute des Rechnungsbuches, das die Ausgabe dafür verzeichnet, geht hervor, dass es gleich
den genannten für eine eigenhändige Arbeit Raffaels gegolten hat,
^^I^BBjJ^. und Passavant vermuthete daraufhin, die »heil. Margaretha« wäre
^BB^HH^BH^^R^ der Schwester des Königs, Margaretha von Valois, als deren Schutz-
[^^B patronin dargebracht worden. Da uns jedoch keine weiteren Ur-
■Rf ,ijigp künden darüber vorliegen, hat A. Springer den Verdacht ausge-
mflr iflBB* ^^HH sprachen, dass hier eine Verwechslung mit dem »heil. Michael«
jfrjß Ipjf **' - *m geschehen wäre. Wenn man aber bedenkt, wie sehr der König
*.-jg*P»,r seine Schwester liebte und welchen Eintluss er ihr zugestand,
/ möchte man eher Passavant's Ansicht beipflichten; denn es ist aller
Grund zu der Meinung vorhanden, dass der Papst es sich nicht wird
'■V, haben entgehen lassen, eine so gewichtige Stimme für sich zu ge-
winnen. Gleichwohl kann ich in dem Louvreexemplare nichts
finden, was mir Vasari's Bericht bestätigen würde, dass es in Raffaels
Fig. 16. Kopf der Venus aus dem Fresco »»„1: 1. , .. „ .
»Venus vor Jupiter«. Atelier gemalt worden wäre. So wie mir das Bild in seiner un-
(Farnesina.) günstigen Aufstellung und im schlechten Lichte erschienen ist, hat
es mich zwar durch seine allgemeine Haltung an Giulio erinnert;
allein Zeichnung und Färbung wollten damit nicht stimmen. Vielleicht ist das aber nur auf Rechnung
des trostlosen Zustandes und der wiederholten Uebermalungen zu setzen; es wäre nicht unmöglich,
dass es, unter günstigeren Verhältnissen untersucht, meinen ersten Eindruck bestätigen würde.
Mit dem Louvrebilde trat oft noch eine zweite »heil. Margaretha« in Wettstreit, die aus der
Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm in den Besitz des österreichischen Kaiserhauses gekommen
und gegenwärtig im neuen kunsthistorischen Museum zu Wien, Saal I, Nr. 3i, aufgestellt ist. Man hat
sie in Zusammenhang mit jener bringen wollen, die sich nach dem Anonimo des Morelli im Jahre 1518
als ein Werk Raffaels im Hause des M. Zuanantonio Venier zu Venedig befand. Ihre Geschichte ist
nicht genau zu verfolgen. Wie jedoch das Bild im Louvre die historische Wahrscheinlichkeit für sich
hat, dass es das von Vasari erwähnte ist, so hat das unsere die künstlerische für sich: zusammengehalten
mit eigenhändigen Gemälden Giulio Romanos, z. B. gleich mit der »heil. Nacht«, der »Madonna della
catina« und »della gatta«, zeigt es sich völlig von seiner Hand ausgeführt. Passavant, hat dies bereits
richtig erkannt. Wenn er Giulio aber auch die Veränderung der Raffael'schen Composition zuschreibt,
wie sie unverfälscht eigentlich nur das Louvrebild weise, weil die starke Wendung der Gestalt, die
Raffaels Schönheitssinn nie zugegeben haben würde, ganz dem feurigen Genius seines grössten Schülers
entspräche, so scheint er mir damit doch gar zu fein gefühlt zu haben; denn dergleichen Wendungen
zeigen auch unbezweifelte Gestalten Raffaels. Ich erinnere nur an die Fides auf der Predella zur
Hermann Dollmayr.
aber erwäge, wie wenig mehr, gerade in diesen Figuren, von Raffaels reinem Charakter vorhanden ist,
so fühle ich mich stark versucht anzunehmen, dass Penni die in Rede stehende Hälfte ziemlich spät
vollendet habe. Der blumenstreuende Engel ist ja perspectivisch eine Unmöglichkeit und mit seinem
Herüberneigen über die knieende Heilige auch kein sehr glückliches Motiv. Wenn wir ferner bedenken,
wie Raffael mit der Vollendung der Gemälde gedrängt wurde (siehe den Briefwechsel des Goro Gheri
mit dem päpstlichen Kämmerer Baldassare Turini, Gaye, Carteggio IL, XC und XCI), so könnte die
Vermuthung ihre Bekräftigung finden, er habe hier die Werkstätte schnell abschliessen lassen. Für den
fremden Fürsten mochten die Bilder in ihren reichen Rahmen als Arbeiten seines Ateliers noch immer
gut genug erschienen sein. Sein Name, der mit der Jahreszahl 1518 an den Saum des Mantels der
heiligen Jungfrau geschrieben wurde, »deckte mit seiner Flagge hinreichend die Ladung«.
Neben den beiden Bildern wäre nach Vasari auch eine »heil. Margaretha« für den französischen
Hof bestimmt gewesen, die Giulio Romano »fast ganz nach einer Zeichnung Raffaels gemalt« hätte.
Und in der That sehen wir im Louvre ein solches Bild, das sich bereits 1530 zu Fontainebleau befand,
in welchem Jahre es Primaticcio mit den drei anderen Gemälden aus Raffaels Atelier, dem »heil.
Michael«, der »Grossen heil. Familie« und der »Johanna von Aragonien«, zu restauriren hatte. Aus
dem Wortlaute des Rechnungsbuches, das die Ausgabe dafür verzeichnet, geht hervor, dass es gleich
den genannten für eine eigenhändige Arbeit Raffaels gegolten hat,
^^I^BBjJ^. und Passavant vermuthete daraufhin, die »heil. Margaretha« wäre
^BB^HH^BH^^R^ der Schwester des Königs, Margaretha von Valois, als deren Schutz-
[^^B patronin dargebracht worden. Da uns jedoch keine weiteren Ur-
■Rf ,ijigp künden darüber vorliegen, hat A. Springer den Verdacht ausge-
mflr iflBB* ^^HH sprachen, dass hier eine Verwechslung mit dem »heil. Michael«
jfrjß Ipjf **' - *m geschehen wäre. Wenn man aber bedenkt, wie sehr der König
*.-jg*P»,r seine Schwester liebte und welchen Eintluss er ihr zugestand,
/ möchte man eher Passavant's Ansicht beipflichten; denn es ist aller
Grund zu der Meinung vorhanden, dass der Papst es sich nicht wird
'■V, haben entgehen lassen, eine so gewichtige Stimme für sich zu ge-
winnen. Gleichwohl kann ich in dem Louvreexemplare nichts
finden, was mir Vasari's Bericht bestätigen würde, dass es in Raffaels
Fig. 16. Kopf der Venus aus dem Fresco »»„1: 1. , .. „ .
»Venus vor Jupiter«. Atelier gemalt worden wäre. So wie mir das Bild in seiner un-
(Farnesina.) günstigen Aufstellung und im schlechten Lichte erschienen ist, hat
es mich zwar durch seine allgemeine Haltung an Giulio erinnert;
allein Zeichnung und Färbung wollten damit nicht stimmen. Vielleicht ist das aber nur auf Rechnung
des trostlosen Zustandes und der wiederholten Uebermalungen zu setzen; es wäre nicht unmöglich,
dass es, unter günstigeren Verhältnissen untersucht, meinen ersten Eindruck bestätigen würde.
Mit dem Louvrebilde trat oft noch eine zweite »heil. Margaretha« in Wettstreit, die aus der
Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm in den Besitz des österreichischen Kaiserhauses gekommen
und gegenwärtig im neuen kunsthistorischen Museum zu Wien, Saal I, Nr. 3i, aufgestellt ist. Man hat
sie in Zusammenhang mit jener bringen wollen, die sich nach dem Anonimo des Morelli im Jahre 1518
als ein Werk Raffaels im Hause des M. Zuanantonio Venier zu Venedig befand. Ihre Geschichte ist
nicht genau zu verfolgen. Wie jedoch das Bild im Louvre die historische Wahrscheinlichkeit für sich
hat, dass es das von Vasari erwähnte ist, so hat das unsere die künstlerische für sich: zusammengehalten
mit eigenhändigen Gemälden Giulio Romanos, z. B. gleich mit der »heil. Nacht«, der »Madonna della
catina« und »della gatta«, zeigt es sich völlig von seiner Hand ausgeführt. Passavant, hat dies bereits
richtig erkannt. Wenn er Giulio aber auch die Veränderung der Raffael'schen Composition zuschreibt,
wie sie unverfälscht eigentlich nur das Louvrebild weise, weil die starke Wendung der Gestalt, die
Raffaels Schönheitssinn nie zugegeben haben würde, ganz dem feurigen Genius seines grössten Schülers
entspräche, so scheint er mir damit doch gar zu fein gefühlt zu haben; denn dergleichen Wendungen
zeigen auch unbezweifelte Gestalten Raffaels. Ich erinnere nur an die Fides auf der Predella zur