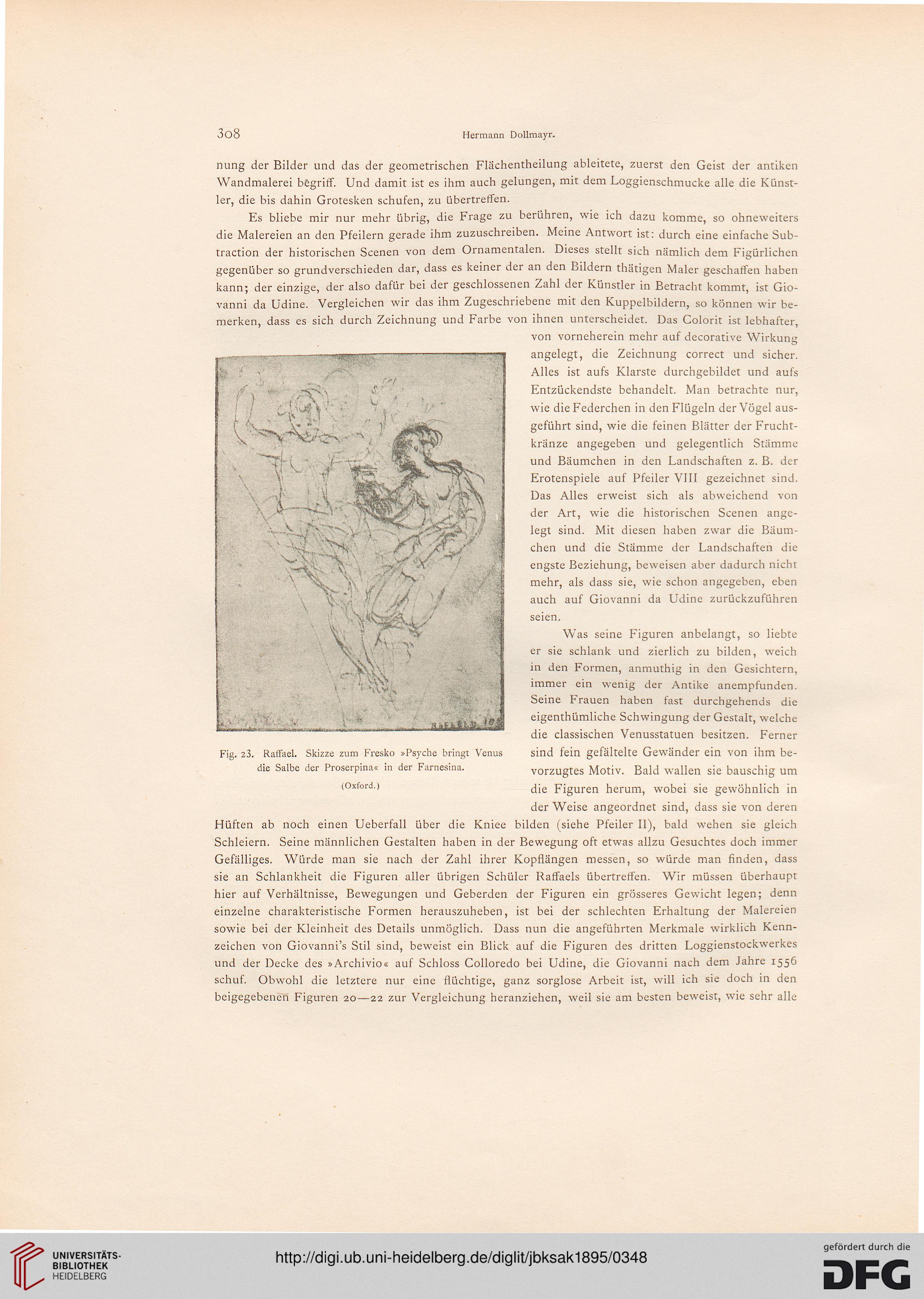3o8
Hermann Dollmayr.
nung der Bilder und das der geometrischen Flächentheilung ableitete, zuerst den Geist der antiken
Wandmalerei begriff. Und damit ist es ihm auch gelungen, mit dem Loggienschmucke alle die Künst-
ler, die bis dahin Grotesken schufen, zu übertreffen.
Es bliebe mir nur mehr übrig, die Frage zu berühren, wie ich dazu komme, so ohneweiters
die Malereien an den Pfeilern gerade ihm zuzuschreiben. Meine Antwort ist: durch eine einfache Sub-
traction der historischen Scenen von dem Ornamentalen. Dieses stellt sich nämlich dem Figürlichen
gegenüber so grundverschieden dar, dass es keiner der an den Bildern thätigen Maler geschaffen haben
kann; der einzige, der also dafür bei der geschlossenen Zahl der Künstler in Betracht kommt, ist Gio-
vanni da Udine. Vergleichen wir das ihm Zugeschriebene mit den Kuppelbildern, so können wir be-
merken, dass es sich durch Zeichnung und Farbe von ihnen unterscheidet. Das Colorit ist lebhafter,
von vorneherein mehr auf decorative Wirkung
angelegt, die Zeichnung correct und sicher.
Alles ist aufs Klarste durchgebildet und aufs
Entzückendste behandelt. Man betrachte nur,
wie die Federchen in den Flügeln der Vögel aus-
geführt sind, wie die feinen Blätter der Frucht-
kränze angegeben und gelegentlich Stämme
und Bäumchen in den Landschaften z. B. der
Erotenspiele auf Pfeiler VIII gezeichnet sind.
Das Alles erweist sich als abweichend von
der Art, wie die historischen Scenen ange-
legt sind. Mit diesen haben zwar die Bäum-
chen und die Stämme der Landschaften die
engste Beziehung, beweisen aber dadurch nicht
mehr, als dass sie, wie schon angegeben, eben
auch auf Giovanni da Udine zurückzuführen
seien.
Was seine Figuren anbelangt, so liebte
er sie schlank und zierlich zu bilden, weich
in den Formen, anmuthig in den Gesichtern,
immer ein wenig der Antike anempfunden.
Seine Frauen haben fast durchgehends die
eigenthümliche Schwingung der Gestalt, welche
die classischen Venusstatuen besitzen. Ferner
sind fein gefältelte Gewänder ein von ihm be-
vorzugtes Motiv. Bald wallen sie bauschig um
die Figuren herum, wobei sie gewöhnlich in
der Weise angeordnet sind, dass sie von deren
Hüften ab noch einen Ueberfall über die Kniee bilden (siehe Pfeiler II), bald wehen sie gleich
Schleiern. Seine männlichen Gestalten haben in der Bewegung oft etwas allzu Gesuchtes doch immer
Gefälliges. Würde man sie nach der Zahl ihrer Kopflängen messen, so würde man finden, dass
sie an Schlankheit die Figuren aller übrigen Schüler Raffaels übertreffen. Wir müssen überhaupt
hier auf Verhältnisse, Bewegungen und Geberden der Figuren ein grösseres Gewicht legen; denn
einzelne charakteristische Formen herauszuheben, ist bei der schlechten Erhaltung der Malereien
sowie bei der Kleinheit des Details unmöglich. Dass nun die angeführten Merkmale wirklich Kenn-
zeichen von Giovanni's Stil sind, beweist ein Blick auf die Figuren des dritten Loggienstockwerkes
und der Decke des »Archivio« auf Schloss Colloredo bei Udine, die Giovanni nach dem Jahre 1556
schuf. Obwohl die letztere nur eine flüchtige, ganz sorglose Arbeit ist, will ich sie doch in den
beigegebenen Figuren 20—22 zur Vergleichung heranziehen, weil sie am besten beweist, wie sehr alle
■ )r>rn'iiiitr ufrifr 'r '
Fig. 23. Raffael. Skizze zum Fresko »Psyche bringt Venus
die Salbe der Proserpina« in der Farnesina.
(Oxford.)
Hermann Dollmayr.
nung der Bilder und das der geometrischen Flächentheilung ableitete, zuerst den Geist der antiken
Wandmalerei begriff. Und damit ist es ihm auch gelungen, mit dem Loggienschmucke alle die Künst-
ler, die bis dahin Grotesken schufen, zu übertreffen.
Es bliebe mir nur mehr übrig, die Frage zu berühren, wie ich dazu komme, so ohneweiters
die Malereien an den Pfeilern gerade ihm zuzuschreiben. Meine Antwort ist: durch eine einfache Sub-
traction der historischen Scenen von dem Ornamentalen. Dieses stellt sich nämlich dem Figürlichen
gegenüber so grundverschieden dar, dass es keiner der an den Bildern thätigen Maler geschaffen haben
kann; der einzige, der also dafür bei der geschlossenen Zahl der Künstler in Betracht kommt, ist Gio-
vanni da Udine. Vergleichen wir das ihm Zugeschriebene mit den Kuppelbildern, so können wir be-
merken, dass es sich durch Zeichnung und Farbe von ihnen unterscheidet. Das Colorit ist lebhafter,
von vorneherein mehr auf decorative Wirkung
angelegt, die Zeichnung correct und sicher.
Alles ist aufs Klarste durchgebildet und aufs
Entzückendste behandelt. Man betrachte nur,
wie die Federchen in den Flügeln der Vögel aus-
geführt sind, wie die feinen Blätter der Frucht-
kränze angegeben und gelegentlich Stämme
und Bäumchen in den Landschaften z. B. der
Erotenspiele auf Pfeiler VIII gezeichnet sind.
Das Alles erweist sich als abweichend von
der Art, wie die historischen Scenen ange-
legt sind. Mit diesen haben zwar die Bäum-
chen und die Stämme der Landschaften die
engste Beziehung, beweisen aber dadurch nicht
mehr, als dass sie, wie schon angegeben, eben
auch auf Giovanni da Udine zurückzuführen
seien.
Was seine Figuren anbelangt, so liebte
er sie schlank und zierlich zu bilden, weich
in den Formen, anmuthig in den Gesichtern,
immer ein wenig der Antike anempfunden.
Seine Frauen haben fast durchgehends die
eigenthümliche Schwingung der Gestalt, welche
die classischen Venusstatuen besitzen. Ferner
sind fein gefältelte Gewänder ein von ihm be-
vorzugtes Motiv. Bald wallen sie bauschig um
die Figuren herum, wobei sie gewöhnlich in
der Weise angeordnet sind, dass sie von deren
Hüften ab noch einen Ueberfall über die Kniee bilden (siehe Pfeiler II), bald wehen sie gleich
Schleiern. Seine männlichen Gestalten haben in der Bewegung oft etwas allzu Gesuchtes doch immer
Gefälliges. Würde man sie nach der Zahl ihrer Kopflängen messen, so würde man finden, dass
sie an Schlankheit die Figuren aller übrigen Schüler Raffaels übertreffen. Wir müssen überhaupt
hier auf Verhältnisse, Bewegungen und Geberden der Figuren ein grösseres Gewicht legen; denn
einzelne charakteristische Formen herauszuheben, ist bei der schlechten Erhaltung der Malereien
sowie bei der Kleinheit des Details unmöglich. Dass nun die angeführten Merkmale wirklich Kenn-
zeichen von Giovanni's Stil sind, beweist ein Blick auf die Figuren des dritten Loggienstockwerkes
und der Decke des »Archivio« auf Schloss Colloredo bei Udine, die Giovanni nach dem Jahre 1556
schuf. Obwohl die letztere nur eine flüchtige, ganz sorglose Arbeit ist, will ich sie doch in den
beigegebenen Figuren 20—22 zur Vergleichung heranziehen, weil sie am besten beweist, wie sehr alle
■ )r>rn'iiiitr ufrifr 'r '
Fig. 23. Raffael. Skizze zum Fresko »Psyche bringt Venus
die Salbe der Proserpina« in der Farnesina.
(Oxford.)