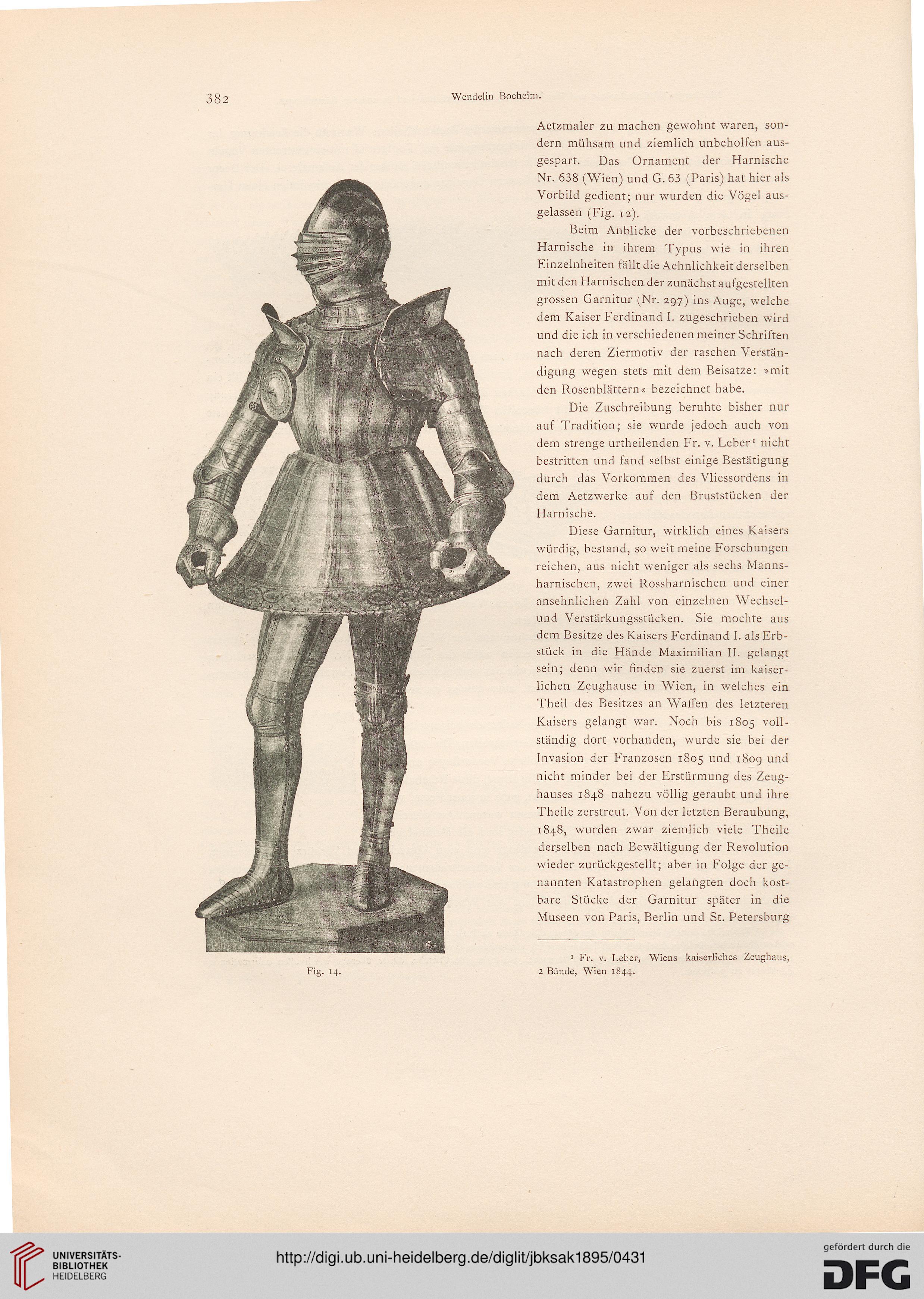Aetzmaler zu machen gewohnt waren, son-
dern mühsam und ziemlich unbeholfen aus-
gespart. Das Ornament der Harnische
Nr. 638 (Wien) und G. 63 (Paris) hat hier als
Vorbild gedient; nur wurden die Vögel aus-
gelassen (Fig. 12).
Beim Anblicke der vorbeschriebenen
Harnische in ihrem Typus wie in ihren
Einzelnheiten fällt die Aehnlichkeit derselben
mit den Harnischen der zunächst aufgestellten
grossen Garnitur (Nr. 297) ins Auge, welche
dem Kaiser Ferdinand I. zugeschrieben wird
und die ich in verschiedenen meiner Schriften
nach deren Ziermotiv der raschen Verstän-
digung wegen stets mit dem Beisatze: »mit
den Rosenblättern« bezeichnet habe.
Die Zuschreibung beruhte bisher nur
auf Tradition; sie wurde jedoch auch von
dem strenge urtheilenden Fr. v. Leber1 nicht
bestritten und fand selbst einige Bestätigung
durch das Vorkommen des Vliessordens in
dem Aetzwerke auf den Bruststücken der
Harnische.
Diese Garnitur, wirklich eines Kaisers
würdig, bestand, so weit meine Forschungen
reichen, aus nicht weniger als sechs Manns-
harnischen, zwei Rossharnischen und einer
ansehnlichen Zahl von einzelnen Wechsel-
und Verstärkungsstücken. Sie mochte aus
dem Besitze des Kaisers Ferdinand I. als Erb-
stück in die Hände Maximilian II. gelangt
sein; denn wir finden sie zuerst im kaiser-
lichen Zeughause in Wien, in welches ein
Theil des Besitzes an Waffen des letzteren
Kaisers gelangt war. Noch bis 1805 voll-
ständig dort vorhanden, wurde sie bei der
Invasion der Franzosen 1805 und 1809 und
nicht minder bei der Erstürmung des Zeug-
hauses 1848 nahezu völlig geraubt und ihre
Theile zerstreut. Von der letzten Beraubung,
1848, wurden zwar ziemlich viele Theile
derselben nach Bewältigung der Revolution
wieder zurückgestellt; aber in Folge der ge-
nannten Katastrophen gelangten doch kost-
bare Stücke der Garnitur später in die
Museen von Paris, Berlin und St. Petersburg
1 Fr. v. Leber, Wiens kaiserliches Zeughaus,
2 Bände, Wien 1844.
dern mühsam und ziemlich unbeholfen aus-
gespart. Das Ornament der Harnische
Nr. 638 (Wien) und G. 63 (Paris) hat hier als
Vorbild gedient; nur wurden die Vögel aus-
gelassen (Fig. 12).
Beim Anblicke der vorbeschriebenen
Harnische in ihrem Typus wie in ihren
Einzelnheiten fällt die Aehnlichkeit derselben
mit den Harnischen der zunächst aufgestellten
grossen Garnitur (Nr. 297) ins Auge, welche
dem Kaiser Ferdinand I. zugeschrieben wird
und die ich in verschiedenen meiner Schriften
nach deren Ziermotiv der raschen Verstän-
digung wegen stets mit dem Beisatze: »mit
den Rosenblättern« bezeichnet habe.
Die Zuschreibung beruhte bisher nur
auf Tradition; sie wurde jedoch auch von
dem strenge urtheilenden Fr. v. Leber1 nicht
bestritten und fand selbst einige Bestätigung
durch das Vorkommen des Vliessordens in
dem Aetzwerke auf den Bruststücken der
Harnische.
Diese Garnitur, wirklich eines Kaisers
würdig, bestand, so weit meine Forschungen
reichen, aus nicht weniger als sechs Manns-
harnischen, zwei Rossharnischen und einer
ansehnlichen Zahl von einzelnen Wechsel-
und Verstärkungsstücken. Sie mochte aus
dem Besitze des Kaisers Ferdinand I. als Erb-
stück in die Hände Maximilian II. gelangt
sein; denn wir finden sie zuerst im kaiser-
lichen Zeughause in Wien, in welches ein
Theil des Besitzes an Waffen des letzteren
Kaisers gelangt war. Noch bis 1805 voll-
ständig dort vorhanden, wurde sie bei der
Invasion der Franzosen 1805 und 1809 und
nicht minder bei der Erstürmung des Zeug-
hauses 1848 nahezu völlig geraubt und ihre
Theile zerstreut. Von der letzten Beraubung,
1848, wurden zwar ziemlich viele Theile
derselben nach Bewältigung der Revolution
wieder zurückgestellt; aber in Folge der ge-
nannten Katastrophen gelangten doch kost-
bare Stücke der Garnitur später in die
Museen von Paris, Berlin und St. Petersburg
1 Fr. v. Leber, Wiens kaiserliches Zeughaus,
2 Bände, Wien 1844.