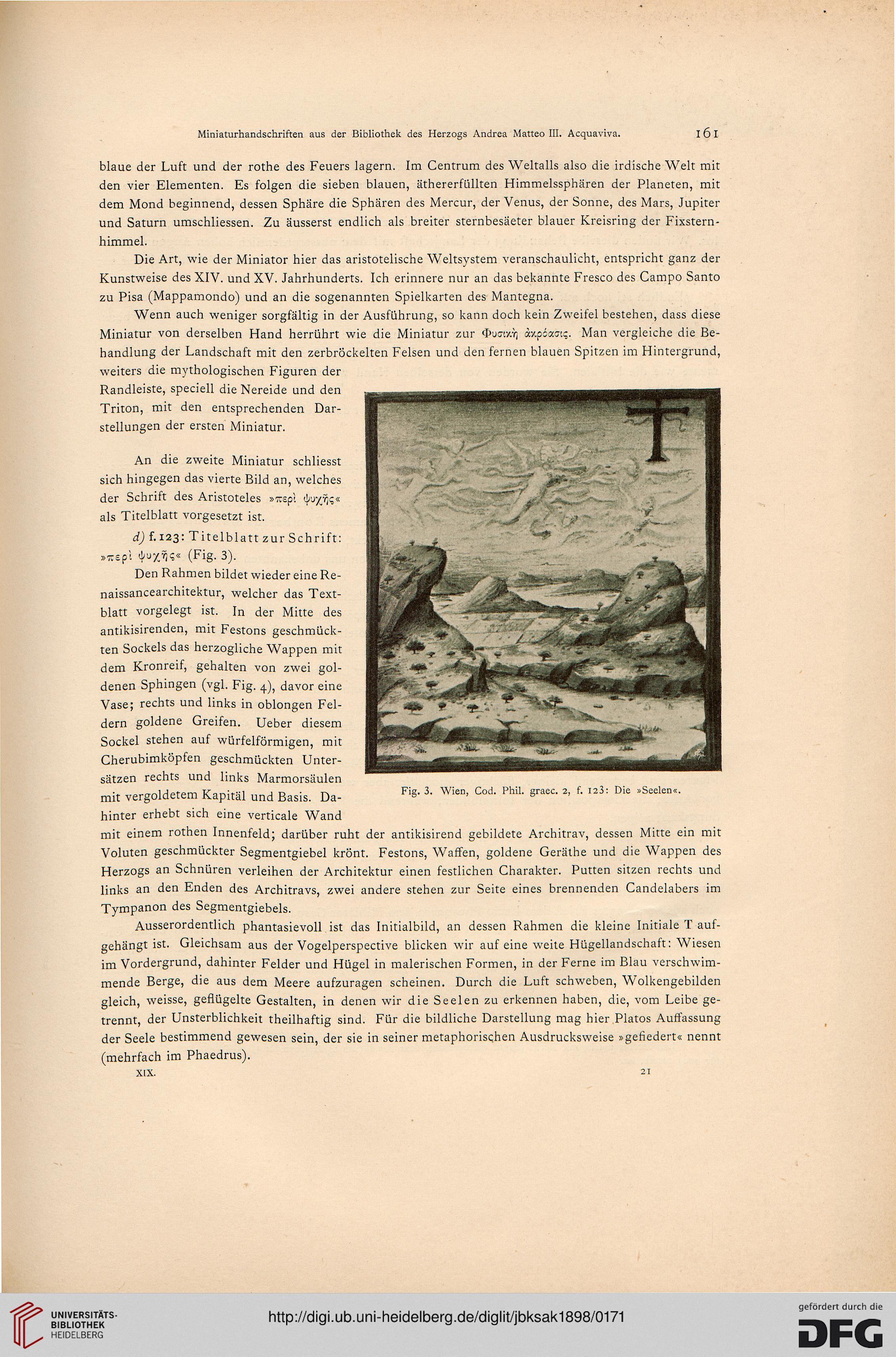Miniaturhandschriften aus der Bibliothek des Herzogs Andrea Matteo III. Acquaviva.
161
blaue der Luft und der rothe des Feuers lagern. Im Centrum des Weltalls also die irdische Welt mit
den vier Elementen. Es folgen die sieben blauen, äthererfüllten Himmelssphären der Planeten, mit
dem Mond beginnend, dessen Sphäre die Sphären des Mercur, der Venus, der Sonne, des Mars, Jupiter
und Saturn umschliessen. Zu äusserst endlich als breiter sternbesäeter blauer Kreisring der Plxstern-
himmel.
Die Art, wie der Miniator hier das aristotelische Weltsystem veranschaulicht, entspricht ganz der
Kunstweise des XIV. und XV. Jahrhunderts. Ich erinnere nur an das bekannte Fresco des Campo Santo
zu Pisa (Mappamondo) und an die sogenannten Spielkarten des Mantegna.
Wenn auch weniger sorgfältig in der Ausführung, so kann doch kein Zweifel bestehen, dass diese
Miniatur von derselben Hand herrührt wie die Miniatur zur $u9txvj ay.pix-i;. Man vergleiche die Be-
handlung der Landschaft mit den zerbröckelten Felsen und den fernen blauen Spitzen im Hintergrund,
weiters die mythologischen Figuren der
Randleiste, speciell die Nereide und den
Triton, mit den entsprechenden Dar-
stellungen der ersten Miniatur.
An die zweite Miniatur schliesst
sich hingegen das vierte Bild an, welches
der Schrift des Aristoteles »7:sp; fyr/r^«
als Titelblatt vorgesetzt ist.
d)t 133: Titelblatt zur Schrift:
»rcept 4u/r;c;« (Fig. 3).
Den Rahmen bildet wieder eine Re-
naissancearchitektur, welcher das Text-
blatt vorgelegt ist. In der Mitte des
antikisirenden, mit Festons geschmück-
ten Sockels das herzogliche Wappen mit
dem Kronreif, gehalten von zwei gol-
denen Sphingen (vgl. Fig. 4), davor eine
Vase; rechts und links in oblongen Fel-
dern goldene Greifen. Ueber diesem
Sockel stehen auf würfelförmigen, mit
Cherubimköpfen geschmückten Unter-
sätzen rechts und links Marmorsäulen
mit vergoldetem Kapital und Basis. Da- Fig- 3> Wien' Cod- Phü" graec- 2' f> I23: Die *Seelen'-
hinter erhebt sich eine verticale Wand
mit einem rothen Innenfeld; darüber ruht der antikisirend gebildete Architrav, dessen Mitte ein mit
Voluten geschmückter Segmentgiebel krönt. Festons, Waffen, goldene Geräthe und die Wappen des
Herzogs an Schnüren verleihen der Architektur einen festlichen Charakter. Putten sitzen rechts und
links an den Enden des Architravs, zwei andere stehen zur Seite eines brennenden Candelabers im
Tympanon des Segmentgiebels.
Ausserordentlich phantasievoll ist das Initialbild, an dessen Rahmen die kleine Initiale T auf-
gehängt ist. Gleichsam aus der Vogelperspective blicken wir auf eine weite Hügellandschaft: Wiesen
im Vordergrund, dahinter Felder und Hügel in malerischen Formen, in der Ferne im Blau verschwim-
mende Berge, die aus dem Meere aufzuragen scheinen. Durch die Luft schweben, Wolkengebilden
gleich, weisse, geflügelte Gestalten, in denen wir die Seelen zu erkennen haben, die, vom Leibe ge-
trennt, der Unsterblichkeit theilhaftig sind. Für die bildliche Darstellung mag hier Piatos Auffassung
der Seele bestimmend gewesen sein, der sie in seiner metaphorischen Ausdrucksweise »gefiedert« nennt
(mehrfach im Phaedrus).
XIX. 21
161
blaue der Luft und der rothe des Feuers lagern. Im Centrum des Weltalls also die irdische Welt mit
den vier Elementen. Es folgen die sieben blauen, äthererfüllten Himmelssphären der Planeten, mit
dem Mond beginnend, dessen Sphäre die Sphären des Mercur, der Venus, der Sonne, des Mars, Jupiter
und Saturn umschliessen. Zu äusserst endlich als breiter sternbesäeter blauer Kreisring der Plxstern-
himmel.
Die Art, wie der Miniator hier das aristotelische Weltsystem veranschaulicht, entspricht ganz der
Kunstweise des XIV. und XV. Jahrhunderts. Ich erinnere nur an das bekannte Fresco des Campo Santo
zu Pisa (Mappamondo) und an die sogenannten Spielkarten des Mantegna.
Wenn auch weniger sorgfältig in der Ausführung, so kann doch kein Zweifel bestehen, dass diese
Miniatur von derselben Hand herrührt wie die Miniatur zur $u9txvj ay.pix-i;. Man vergleiche die Be-
handlung der Landschaft mit den zerbröckelten Felsen und den fernen blauen Spitzen im Hintergrund,
weiters die mythologischen Figuren der
Randleiste, speciell die Nereide und den
Triton, mit den entsprechenden Dar-
stellungen der ersten Miniatur.
An die zweite Miniatur schliesst
sich hingegen das vierte Bild an, welches
der Schrift des Aristoteles »7:sp; fyr/r^«
als Titelblatt vorgesetzt ist.
d)t 133: Titelblatt zur Schrift:
»rcept 4u/r;c;« (Fig. 3).
Den Rahmen bildet wieder eine Re-
naissancearchitektur, welcher das Text-
blatt vorgelegt ist. In der Mitte des
antikisirenden, mit Festons geschmück-
ten Sockels das herzogliche Wappen mit
dem Kronreif, gehalten von zwei gol-
denen Sphingen (vgl. Fig. 4), davor eine
Vase; rechts und links in oblongen Fel-
dern goldene Greifen. Ueber diesem
Sockel stehen auf würfelförmigen, mit
Cherubimköpfen geschmückten Unter-
sätzen rechts und links Marmorsäulen
mit vergoldetem Kapital und Basis. Da- Fig- 3> Wien' Cod- Phü" graec- 2' f> I23: Die *Seelen'-
hinter erhebt sich eine verticale Wand
mit einem rothen Innenfeld; darüber ruht der antikisirend gebildete Architrav, dessen Mitte ein mit
Voluten geschmückter Segmentgiebel krönt. Festons, Waffen, goldene Geräthe und die Wappen des
Herzogs an Schnüren verleihen der Architektur einen festlichen Charakter. Putten sitzen rechts und
links an den Enden des Architravs, zwei andere stehen zur Seite eines brennenden Candelabers im
Tympanon des Segmentgiebels.
Ausserordentlich phantasievoll ist das Initialbild, an dessen Rahmen die kleine Initiale T auf-
gehängt ist. Gleichsam aus der Vogelperspective blicken wir auf eine weite Hügellandschaft: Wiesen
im Vordergrund, dahinter Felder und Hügel in malerischen Formen, in der Ferne im Blau verschwim-
mende Berge, die aus dem Meere aufzuragen scheinen. Durch die Luft schweben, Wolkengebilden
gleich, weisse, geflügelte Gestalten, in denen wir die Seelen zu erkennen haben, die, vom Leibe ge-
trennt, der Unsterblichkeit theilhaftig sind. Für die bildliche Darstellung mag hier Piatos Auffassung
der Seele bestimmend gewesen sein, der sie in seiner metaphorischen Ausdrucksweise »gefiedert« nennt
(mehrfach im Phaedrus).
XIX. 21