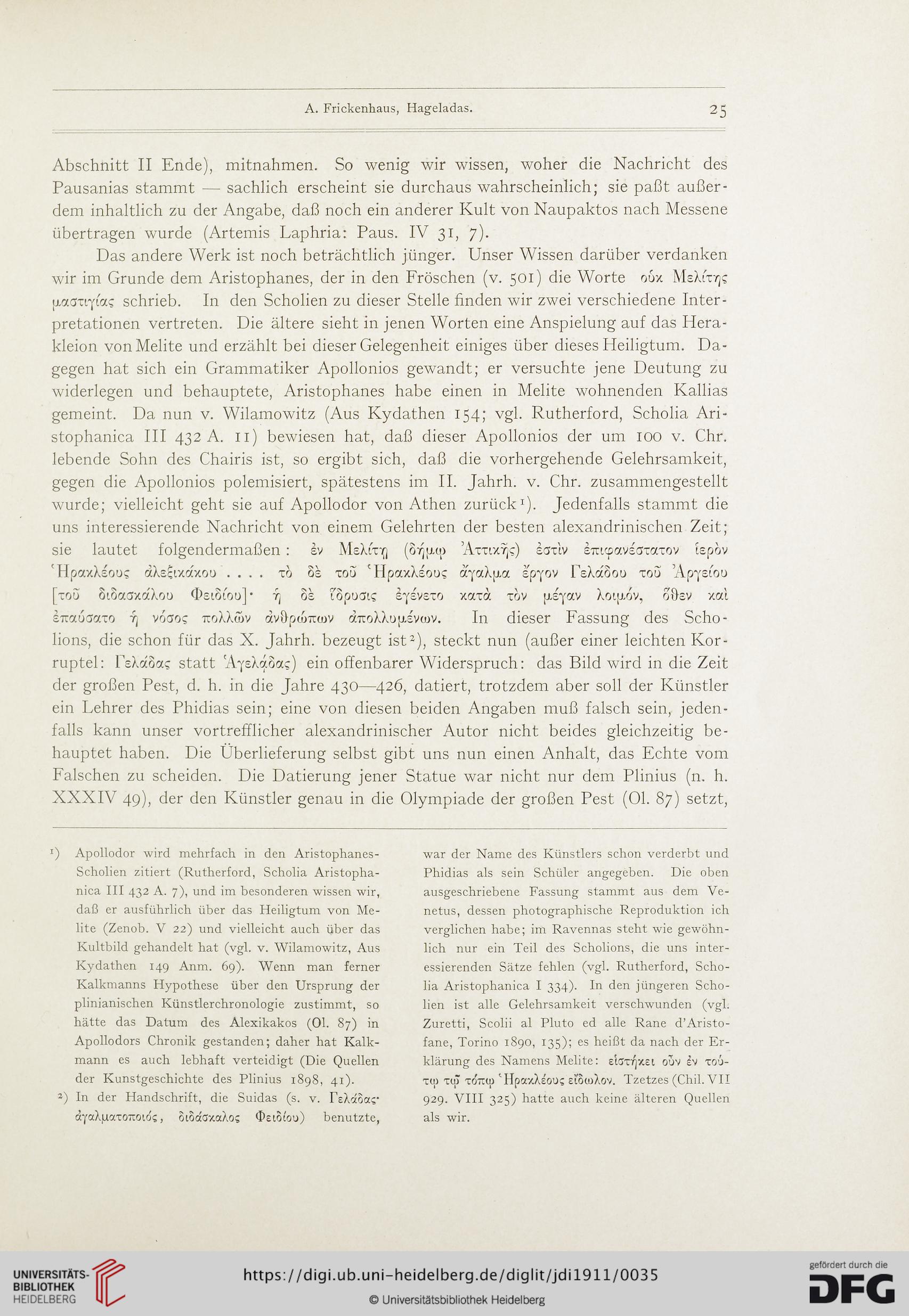A. Frickenhaus, Hageladas.
25
Abschnitt II Ende), mitnahmen. So wenig wir wissen, woher die Nachricht des
Pausanias stammt — sachlich erscheint sie durchaus wahrscheinlich; sie paßt außer-
dem inhaltlich zu der Angabe, daß noch ein anderer Kult von Naupaktos nach Messene
übertragen wurde (Artemis Laphria: Paus. IV 31, 7).
Das andere Werk ist noch beträchtlich jünger. Unser Wissen darüber verdanken
wir im Grunde dem Aristophanes, der in den Fröschen (v. 501) die Worte oux MeXrwjg
ij,a<jTtYtas schrieb. In den Scholien zu dieser Stelle finden wir zwei verschiedene Inter-
pretationen vertreten. Die ältere sieht in jenen Worten eine Anspielung auf das Hera-
kleion vonMelite und erzählt bei dieser Gelegenheit einiges über dieses Heiligtum. Da-
gegen hat sich ein Grammatiker Apollonios gewandt; er versuchte jene Deutung zu
widerlegen und behauptete, Aristophanes habe einen in Melite wohnenden Kailias
gemeint. Da nun v. Wilamowitz (Aus Kydathen 154; vgl. Rutherford, Scholia Ari-
stophanica III 432 A. 11) bewiesen hat, daß dieser Apollonios der um 100 v. Chr.
lebende Sohn des Chairis ist, so ergibt sich, daß die vorhergehende Gelehrsamkeit,
gegen die Apollonios polemisiert, spätestens im II. Jahrh. v. Chr. zusammengestellt
wurde; vielleicht geht sie auf Apollodor von Athen zurück1). Jedenfalls stammt die
uns interessierende Nachricht von einem Gelehrten der besten alexandrinischen Zeit;
sie lautet folgendermaßen : sv MsXGtq ’Attix^?) sötiv ImcpaveöTarov tepov
'HpaxXeoug aXe£ixaxou .... to Ss tou 'HpaxXeou; aJaXp,a epyov FeXaSou tou ’Apfsiou
[rou StSaaxdXou OstoGo]’ os fopodt«; eyevsTO xard tov pZyav Xotjiov, oftev xat
srozusaTO 7) voöo? TtoXXäiv dvö-pwTuyv aTwXXüpZvcnv. In dieser Fassung des Scho-
lions, die schon für das X. Jahrh. bezeugt ist2), steckt nun (außer einer leichten Kor-
ruptel: FsXdoa? statt 'AysXaSa«;) ein offenbarer Widerspruch: das Bild wird in die Zeit
der großen Pest, d. h. in die Jahre 430—426, datiert, trotzdem aber soll der Künstler
ein Lehrer des Phidias sein; eine von diesen beiden Angaben muß falsch sein, jeden-
falls kann unser vortrefflicher alexandrinischer Autor nicht beides gleichzeitig be-
hauptet haben. Die Überlieferung selbst gibt uns nun einen Anhalt, das Echte vom
Falschen zu scheiden. Die Datierung jener Statue war nicht nur dem Plinius (n. h.
XXXIV 49), der den Künstler genau in die Olympiade der großen Pest (01. 87) setzt,
z) Apollodor wird mehrfach in den Aristophanes-
Scholien zitiert (Rutherford, Scholia Aristopha-
nica III 432 A. 7), und im besonderen wissen wir,
daß er ausführlich über das Heiligtum von Me-
lite (Zenob. V 22) und vielleicht auch über das
Kultbild gehandelt hat (vgl. v. Wilamowitz, Aus
Kydathen 149 Anm. 69). Wenn man ferner
Kalkmanns Hypothese über den Ursprung der
plinianischen Künstlerchronologie zustimmt, so
hätte das Datum des Alexikakos (01. 87) in
Apollodors Chronik gestanden; daher hat Kalk-
mann es auch lebhaft verteidigt (Die Quellen
der Kunstgeschichte des Plinius 1898, 41).
2) In der Handschrift, die Suidas (s. v. FeXaSas-
djaXparoTtoid;, oiSaszaXo; Oeioi'ou) benutzte,
war der Name des Künstlers schon verderbt und
Phidias als sein Schüler angegeben. Die oben
ausgeschriebene Fassung stammt aus dem Ve-
netus, dessen photographische Reproduktion ich
verglichen habe; im Ravennas steht wie gewöhn-
lich nur ein Teil des Scholions, die uns inter-
essierenden Sätze fehlen (vgl. Rutherford, Scho-
lia Aristophanica I 334). In den jüngeren Scho-
lien ist alle Gelehrsamkeit verschwunden (vgl.
Zuretti, Scolii al Pluto ed alle Rane d’Aristo-
fane, Torino 1890, 135); es heißt da nach der Er-
klärung des Namens Melite: EtffTijzEt oöv dv roö-
tu) rtü TOKtp ^HpazXsou; EtSoXov. Tzetzes (Ch.il. VII
929. VIII 325) hatte auch keine älteren Quellen
als wir.
25
Abschnitt II Ende), mitnahmen. So wenig wir wissen, woher die Nachricht des
Pausanias stammt — sachlich erscheint sie durchaus wahrscheinlich; sie paßt außer-
dem inhaltlich zu der Angabe, daß noch ein anderer Kult von Naupaktos nach Messene
übertragen wurde (Artemis Laphria: Paus. IV 31, 7).
Das andere Werk ist noch beträchtlich jünger. Unser Wissen darüber verdanken
wir im Grunde dem Aristophanes, der in den Fröschen (v. 501) die Worte oux MeXrwjg
ij,a<jTtYtas schrieb. In den Scholien zu dieser Stelle finden wir zwei verschiedene Inter-
pretationen vertreten. Die ältere sieht in jenen Worten eine Anspielung auf das Hera-
kleion vonMelite und erzählt bei dieser Gelegenheit einiges über dieses Heiligtum. Da-
gegen hat sich ein Grammatiker Apollonios gewandt; er versuchte jene Deutung zu
widerlegen und behauptete, Aristophanes habe einen in Melite wohnenden Kailias
gemeint. Da nun v. Wilamowitz (Aus Kydathen 154; vgl. Rutherford, Scholia Ari-
stophanica III 432 A. 11) bewiesen hat, daß dieser Apollonios der um 100 v. Chr.
lebende Sohn des Chairis ist, so ergibt sich, daß die vorhergehende Gelehrsamkeit,
gegen die Apollonios polemisiert, spätestens im II. Jahrh. v. Chr. zusammengestellt
wurde; vielleicht geht sie auf Apollodor von Athen zurück1). Jedenfalls stammt die
uns interessierende Nachricht von einem Gelehrten der besten alexandrinischen Zeit;
sie lautet folgendermaßen : sv MsXGtq ’Attix^?) sötiv ImcpaveöTarov tepov
'HpaxXeoug aXe£ixaxou .... to Ss tou 'HpaxXeou; aJaXp,a epyov FeXaSou tou ’Apfsiou
[rou StSaaxdXou OstoGo]’ os fopodt«; eyevsTO xard tov pZyav Xotjiov, oftev xat
srozusaTO 7) voöo? TtoXXäiv dvö-pwTuyv aTwXXüpZvcnv. In dieser Fassung des Scho-
lions, die schon für das X. Jahrh. bezeugt ist2), steckt nun (außer einer leichten Kor-
ruptel: FsXdoa? statt 'AysXaSa«;) ein offenbarer Widerspruch: das Bild wird in die Zeit
der großen Pest, d. h. in die Jahre 430—426, datiert, trotzdem aber soll der Künstler
ein Lehrer des Phidias sein; eine von diesen beiden Angaben muß falsch sein, jeden-
falls kann unser vortrefflicher alexandrinischer Autor nicht beides gleichzeitig be-
hauptet haben. Die Überlieferung selbst gibt uns nun einen Anhalt, das Echte vom
Falschen zu scheiden. Die Datierung jener Statue war nicht nur dem Plinius (n. h.
XXXIV 49), der den Künstler genau in die Olympiade der großen Pest (01. 87) setzt,
z) Apollodor wird mehrfach in den Aristophanes-
Scholien zitiert (Rutherford, Scholia Aristopha-
nica III 432 A. 7), und im besonderen wissen wir,
daß er ausführlich über das Heiligtum von Me-
lite (Zenob. V 22) und vielleicht auch über das
Kultbild gehandelt hat (vgl. v. Wilamowitz, Aus
Kydathen 149 Anm. 69). Wenn man ferner
Kalkmanns Hypothese über den Ursprung der
plinianischen Künstlerchronologie zustimmt, so
hätte das Datum des Alexikakos (01. 87) in
Apollodors Chronik gestanden; daher hat Kalk-
mann es auch lebhaft verteidigt (Die Quellen
der Kunstgeschichte des Plinius 1898, 41).
2) In der Handschrift, die Suidas (s. v. FeXaSas-
djaXparoTtoid;, oiSaszaXo; Oeioi'ou) benutzte,
war der Name des Künstlers schon verderbt und
Phidias als sein Schüler angegeben. Die oben
ausgeschriebene Fassung stammt aus dem Ve-
netus, dessen photographische Reproduktion ich
verglichen habe; im Ravennas steht wie gewöhn-
lich nur ein Teil des Scholions, die uns inter-
essierenden Sätze fehlen (vgl. Rutherford, Scho-
lia Aristophanica I 334). In den jüngeren Scho-
lien ist alle Gelehrsamkeit verschwunden (vgl.
Zuretti, Scolii al Pluto ed alle Rane d’Aristo-
fane, Torino 1890, 135); es heißt da nach der Er-
klärung des Namens Melite: EtffTijzEt oöv dv roö-
tu) rtü TOKtp ^HpazXsou; EtSoXov. Tzetzes (Ch.il. VII
929. VIII 325) hatte auch keine älteren Quellen
als wir.