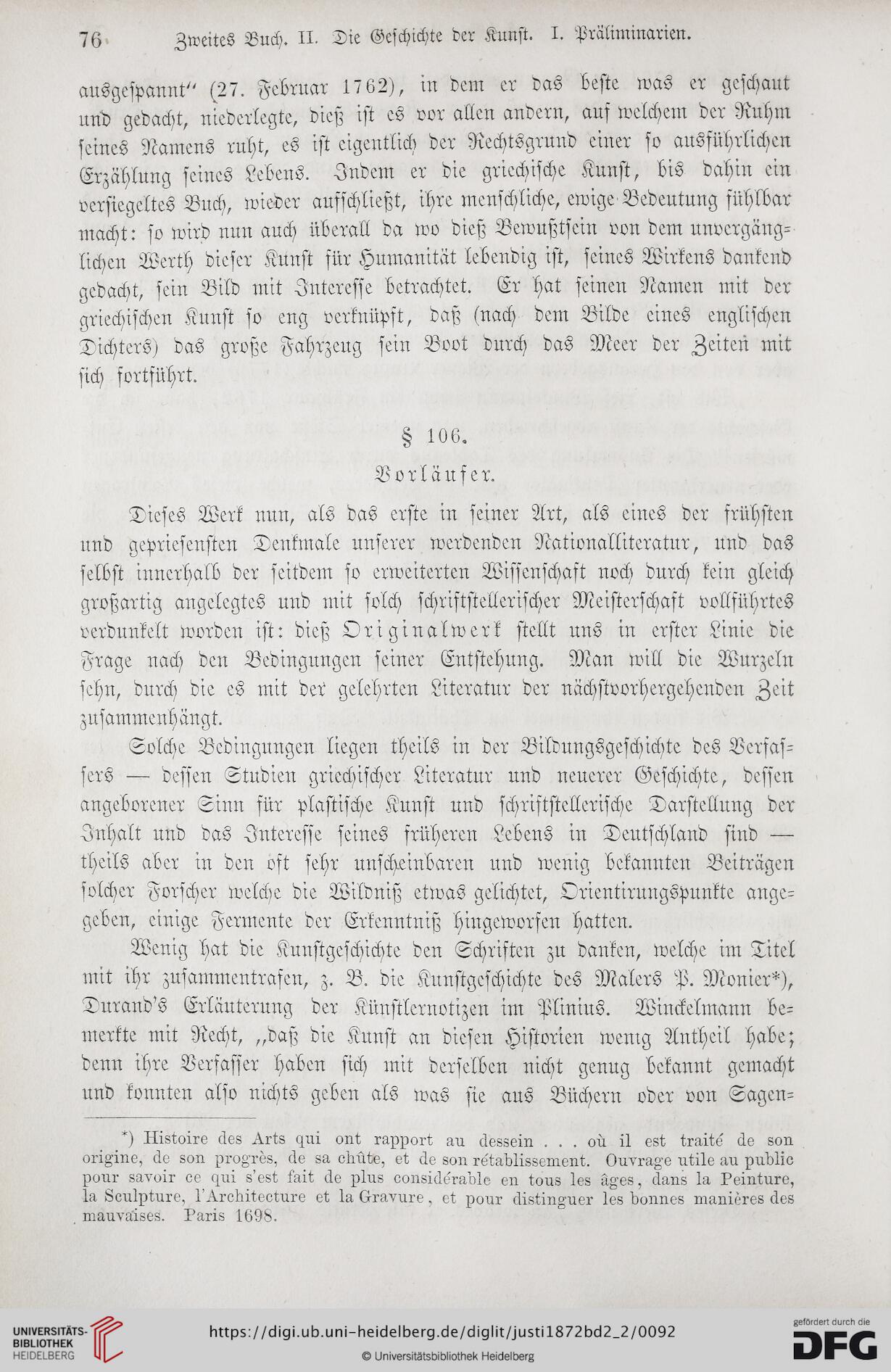76 Zweites Buch. II. Die Geschichte der Kunst. I. Präliminarien.
ausgespannt^ (27. Februar 17 62), in dem er das beste was er geschaut
und gedacht, niederlegte, dieß ist es vor allen andern, auf welchem der Ruhm
seines Namens ruht, es ist eigentlich der Rechtsgruud einer so ausführlichen
Erzählung feines Lebens. Indem er die griechische Kunst, Lis dahin ein
versiegeltes Buch, wieder auffchließt, ihre menschliche, ewige Bedeutung sü^
macht: so wird nun auch überall da wo dieß Bewußtsein von dem unvergäng-
lichen Werth dieser Kunst für Humanität lebendig ist, seines Wirkens dankend
gedacht, sein Bild mit Interesse betrachtet. Er hat seinen Namen mit der
griechischen Kunst so eng verknüpft, daß (nach dem Bilde eines englischen
Dichters) das große Fahrzeug sein Boot durch das Meer der Zeiten mit
sich fortführt.
§ 106.
Vorläufer.
Dieses Werk nun, als das erste in seiner Art, als eines der frühsten
und gestrichensten Denkmale unserer werdenden Nationalliteratur, und das
selbst innerhalb der seitdem so erweiterten Wissenschaft noch durch kein gleich
großartig angelegtes und mit solch schriftstellerischer Meisterschaft vollsührtes
verdunkelt worden ist: dieß Originalwerk stellt uns in erster Linie die
Frage nach den Bedingungen seiner Entstehung. Man will die Wurzeln
sehn, durch die es mit dev gelehrten Literatur der nächstvorhergehenden Zeit
zusammenhängt.
Solche Bedingungen liegen theils in der Bildungsgeschichte des Verfas-
sers — dessen Studien griechischer Literatur und neuerer Geschichte, dessen
angeborener Sinn für plastische Kunst und schriftstellerische Darstellung der
Inhalt und das Interesse seines früheren Lebens in Deutschland sind —
theils aber in den oft sehr unscheinbaren und wenig bekannten Beiträgen
solcher Forscher welche die Wildniß etwas gelichtet, Orientirungspunkte ange-
geben, einige Fermente der Erkenntniß hingeworsen hatten.
Wenig hat die Kunstgeschichte den Schriften zu danken, welche im Titel
mit ihr zusammentrafen, z. B. die Kunstgeschichte des Malers P. Monier*),
Durand's Erläuterung der Künstlernotizen im Plinius. Winckelmann be-
merkte mit Recht, „daß die Kunst an diesen Historien wenig Antheil habe;
denn ihre Verfasser haben sich mit derselben nicht genug bekannt gemacht
nnd konnten also nichts geben als was sie aus Büchern oder von Sagen-
si) Histows äss wrts hui out rgMvrt gu ässssiu . . . oü II ost tralts äs sou
äs sou ^rotz'rss, äs ss, oüiits, st äs sou rstgülisseuisut. OuvrLAS utils gu Piwlio
?oui' savoii se hui s sst ürit äs plus sousiäsrgols su tous Iss s,§ss, äaus Ig keiuturs,
Ig Lsulnture, I WroUitsoturs st Ig, Oi'gvure, st äistiiiAusr Iss üouues uiguisres äss
mauvglsss. ?gris 1698.
ausgespannt^ (27. Februar 17 62), in dem er das beste was er geschaut
und gedacht, niederlegte, dieß ist es vor allen andern, auf welchem der Ruhm
seines Namens ruht, es ist eigentlich der Rechtsgruud einer so ausführlichen
Erzählung feines Lebens. Indem er die griechische Kunst, Lis dahin ein
versiegeltes Buch, wieder auffchließt, ihre menschliche, ewige Bedeutung sü^
macht: so wird nun auch überall da wo dieß Bewußtsein von dem unvergäng-
lichen Werth dieser Kunst für Humanität lebendig ist, seines Wirkens dankend
gedacht, sein Bild mit Interesse betrachtet. Er hat seinen Namen mit der
griechischen Kunst so eng verknüpft, daß (nach dem Bilde eines englischen
Dichters) das große Fahrzeug sein Boot durch das Meer der Zeiten mit
sich fortführt.
§ 106.
Vorläufer.
Dieses Werk nun, als das erste in seiner Art, als eines der frühsten
und gestrichensten Denkmale unserer werdenden Nationalliteratur, und das
selbst innerhalb der seitdem so erweiterten Wissenschaft noch durch kein gleich
großartig angelegtes und mit solch schriftstellerischer Meisterschaft vollsührtes
verdunkelt worden ist: dieß Originalwerk stellt uns in erster Linie die
Frage nach den Bedingungen seiner Entstehung. Man will die Wurzeln
sehn, durch die es mit dev gelehrten Literatur der nächstvorhergehenden Zeit
zusammenhängt.
Solche Bedingungen liegen theils in der Bildungsgeschichte des Verfas-
sers — dessen Studien griechischer Literatur und neuerer Geschichte, dessen
angeborener Sinn für plastische Kunst und schriftstellerische Darstellung der
Inhalt und das Interesse seines früheren Lebens in Deutschland sind —
theils aber in den oft sehr unscheinbaren und wenig bekannten Beiträgen
solcher Forscher welche die Wildniß etwas gelichtet, Orientirungspunkte ange-
geben, einige Fermente der Erkenntniß hingeworsen hatten.
Wenig hat die Kunstgeschichte den Schriften zu danken, welche im Titel
mit ihr zusammentrafen, z. B. die Kunstgeschichte des Malers P. Monier*),
Durand's Erläuterung der Künstlernotizen im Plinius. Winckelmann be-
merkte mit Recht, „daß die Kunst an diesen Historien wenig Antheil habe;
denn ihre Verfasser haben sich mit derselben nicht genug bekannt gemacht
nnd konnten also nichts geben als was sie aus Büchern oder von Sagen-
si) Histows äss wrts hui out rgMvrt gu ässssiu . . . oü II ost tralts äs sou
äs sou ^rotz'rss, äs ss, oüiits, st äs sou rstgülisseuisut. OuvrLAS utils gu Piwlio
?oui' savoii se hui s sst ürit äs plus sousiäsrgols su tous Iss s,§ss, äaus Ig keiuturs,
Ig Lsulnture, I WroUitsoturs st Ig, Oi'gvure, st äistiiiAusr Iss üouues uiguisres äss
mauvglsss. ?gris 1698.