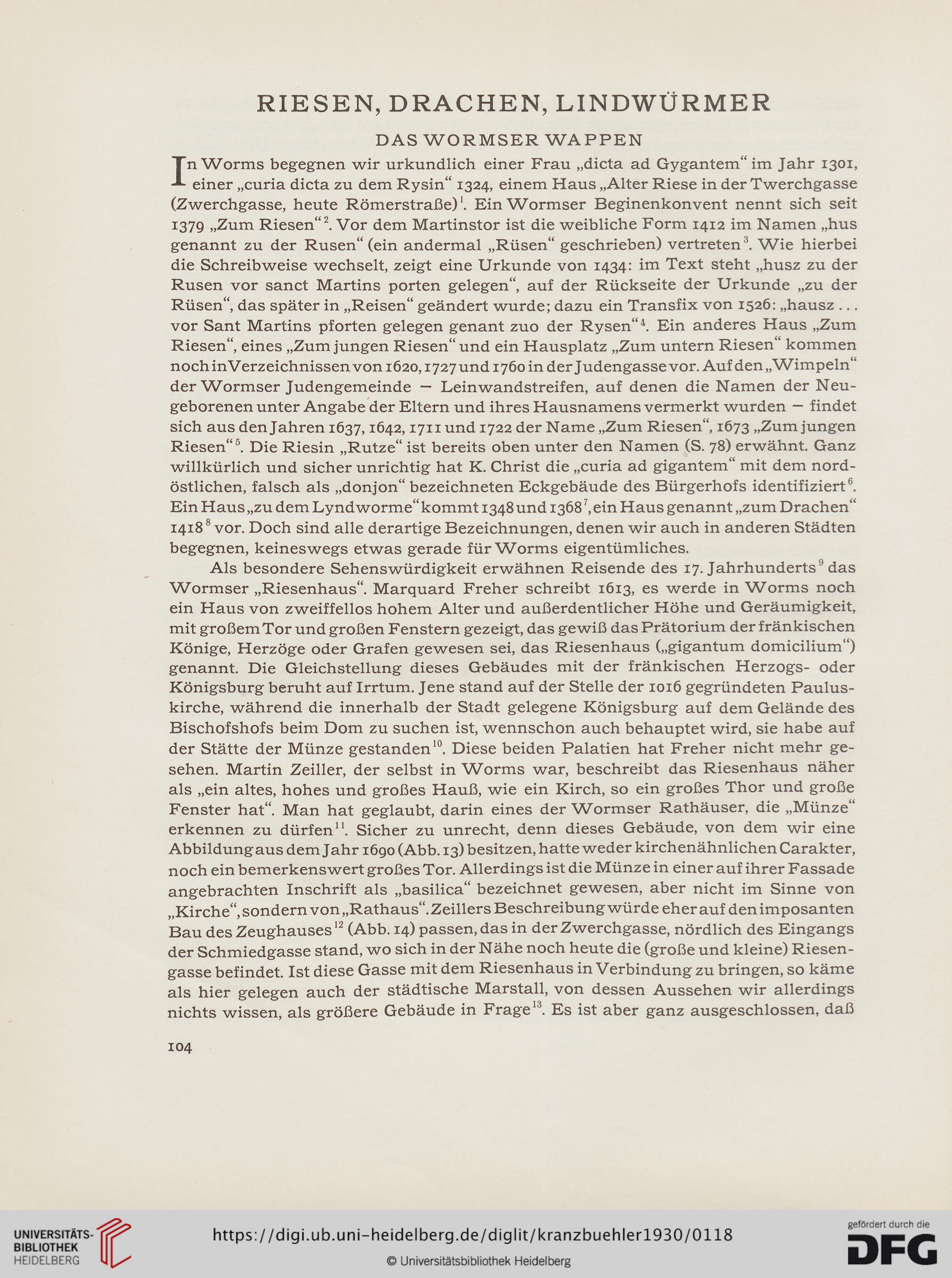RIESEN, DRACHEN, LINDWÜRMER
DAS WORMSER WAPPEN
Tn Worms begegnen wir urkundlich einer Frau „dicta ad Gygantem“ im Jahr 1301,
einer „curia dicta zu dem Rysin“ 1324, einem Haus „Alter Riese in der Twerchgasse
(Zwerchgasse, heute Römerstraße)1. Ein Wormser Beginenkonvent nennt sich seit
1379 „Zum Riesen“2. Vor dem Martinstor ist die weibliche Form 1412 im Namen „hus
genannt zu der Rusen“ (ein andermal „Rüsen“ geschrieben) vertreten3. Wie hierbei
die Schreibweise wechselt, zeigt eine Urkunde von 1434: im Text steht „husz zu der
Rusen vor sanct Martins porten gelegen“, auf der Rückseite der Urkunde „zu der
Rüsen“, das später in „Reisen“ geändert wurde; dazu ein Transfix von 1526: „hausz ...
vor Sant Martins pforten gelegen genant zuo der Rysen“4. Ein anderes Haus „Zum
Riesen“, eines „Zum jungen Riesen“ und ein Hausplatz „Zum untern Riesen“ kommen
nochinVerzeichnissenvon 1620, i727und 1760 in der Judengasse vor. Auf den „Wimpeln“
der Wormser Judengemeinde — Leinwandstreifen, auf denen die Namen der Neu-
geborenen unter Angabe der Eltern und ihres Hausnamens vermerkt wurden — findet
sich aus den Jahren 1637,1642,1711 und 1722 der Name „Zum Riesen“, 1673 „Zum jungen
Riesen“5. Die Riesin „Rutze“ ist bereits oben unter den Namen (S. 78) erwähnt. Ganz
willkürlich und sicher unrichtig hat K. Christ die „curia ad gigantem“ mit dem nord-
östlichen, falsch als „donjon“ bezeichneten Eckgebäude des Bürgerhofs identifiziert6.
Ein Haus „zu dem Lynd worme“kommt 1348 und 13687, ein Haus genannt „zum Drachen“
14188 vor. Doch sind alle derartige Bezeichnungen, denen wir auch in anderen Städten
begegnen, keineswegs etwas gerade für Worms eigentümliches.
Als besondere Sehenswürdigkeit erwähnen Reisende des 17. Jahrhunderts9 das
Wormser „Riesenhaus“. Marquard Freher schreibt 1613, es werde in Worms noch
ein Haus von zweiffellos hohem Alter und außerdentlicher Höhe und Geräumigkeit,
mit großem Tor und großen Fenstern gezeigt, das gewiß das Prätorium der fränkischen
Könige, Herzöge oder Grafen gewesen sei, das Riesenhaus („gigantum domicilium“)
genannt. Die Gleichstellung dieses Gebäudes mit der fränkischen Herzogs- oder
Königsburg beruht auf Irrtum. Jene stand auf der Stelle der 1016 gegründeten Paulus-
kirche, während die innerhalb der Stadt gelegene Königsburg auf dem Gelände des
Bischofshofs beim Dom zu suchen ist, wennschon auch behauptet wird, sie habe auf
der Stätte der Münze gestanden10. Diese beiden Palatien hat Freher nicht mehr ge-
sehen. Martin Zeiller, der selbst in Worms war, beschreibt das Riesenhaus näher
als „ein altes, hohes und großes Hauß, wie ein Kirch, so ein großes Thor und große
Fenster hat“. Man hat geglaubt, darin eines der Wormser Rathäuser, die „Münze“
erkennen zu dürfen11. Sicher zu unrecht, denn dieses Gebäude, von dem wir eine
Abbildungaus dem Jahr 1690 (Abb. 13) besitzen, hatte weder kirchenähnlichen Carakter,
noch ein bemerkenswert großes Tor. Allerdings ist die Münze in einer auf ihrer Fassade
angebrachten Inschrift als „basilica“ bezeichnet gewesen, aber nicht im Sinne von
„Kirche“, sondern von „Rathaus“. Zeillers Beschreibung würde eher auf den imposanten
Bau des Zeughauses12 (Abb. 14) passen, das in der Zwerchgasse, nördlich des Eingangs
der Schmiedgasse stand, wo sich in der Nähe noch heute die (große und kleine) Riesen-
gasse befindet. Ist diese Gasse mit dem Riesenhaus in Verbindung zu bringen, so käme
als hier gelegen auch der städtische Marstall, von dessen Aussehen wir allerdings
nichts wissen, als größere Gebäude in Frage13. Es ist aber ganz ausgeschlossen, daß
104
DAS WORMSER WAPPEN
Tn Worms begegnen wir urkundlich einer Frau „dicta ad Gygantem“ im Jahr 1301,
einer „curia dicta zu dem Rysin“ 1324, einem Haus „Alter Riese in der Twerchgasse
(Zwerchgasse, heute Römerstraße)1. Ein Wormser Beginenkonvent nennt sich seit
1379 „Zum Riesen“2. Vor dem Martinstor ist die weibliche Form 1412 im Namen „hus
genannt zu der Rusen“ (ein andermal „Rüsen“ geschrieben) vertreten3. Wie hierbei
die Schreibweise wechselt, zeigt eine Urkunde von 1434: im Text steht „husz zu der
Rusen vor sanct Martins porten gelegen“, auf der Rückseite der Urkunde „zu der
Rüsen“, das später in „Reisen“ geändert wurde; dazu ein Transfix von 1526: „hausz ...
vor Sant Martins pforten gelegen genant zuo der Rysen“4. Ein anderes Haus „Zum
Riesen“, eines „Zum jungen Riesen“ und ein Hausplatz „Zum untern Riesen“ kommen
nochinVerzeichnissenvon 1620, i727und 1760 in der Judengasse vor. Auf den „Wimpeln“
der Wormser Judengemeinde — Leinwandstreifen, auf denen die Namen der Neu-
geborenen unter Angabe der Eltern und ihres Hausnamens vermerkt wurden — findet
sich aus den Jahren 1637,1642,1711 und 1722 der Name „Zum Riesen“, 1673 „Zum jungen
Riesen“5. Die Riesin „Rutze“ ist bereits oben unter den Namen (S. 78) erwähnt. Ganz
willkürlich und sicher unrichtig hat K. Christ die „curia ad gigantem“ mit dem nord-
östlichen, falsch als „donjon“ bezeichneten Eckgebäude des Bürgerhofs identifiziert6.
Ein Haus „zu dem Lynd worme“kommt 1348 und 13687, ein Haus genannt „zum Drachen“
14188 vor. Doch sind alle derartige Bezeichnungen, denen wir auch in anderen Städten
begegnen, keineswegs etwas gerade für Worms eigentümliches.
Als besondere Sehenswürdigkeit erwähnen Reisende des 17. Jahrhunderts9 das
Wormser „Riesenhaus“. Marquard Freher schreibt 1613, es werde in Worms noch
ein Haus von zweiffellos hohem Alter und außerdentlicher Höhe und Geräumigkeit,
mit großem Tor und großen Fenstern gezeigt, das gewiß das Prätorium der fränkischen
Könige, Herzöge oder Grafen gewesen sei, das Riesenhaus („gigantum domicilium“)
genannt. Die Gleichstellung dieses Gebäudes mit der fränkischen Herzogs- oder
Königsburg beruht auf Irrtum. Jene stand auf der Stelle der 1016 gegründeten Paulus-
kirche, während die innerhalb der Stadt gelegene Königsburg auf dem Gelände des
Bischofshofs beim Dom zu suchen ist, wennschon auch behauptet wird, sie habe auf
der Stätte der Münze gestanden10. Diese beiden Palatien hat Freher nicht mehr ge-
sehen. Martin Zeiller, der selbst in Worms war, beschreibt das Riesenhaus näher
als „ein altes, hohes und großes Hauß, wie ein Kirch, so ein großes Thor und große
Fenster hat“. Man hat geglaubt, darin eines der Wormser Rathäuser, die „Münze“
erkennen zu dürfen11. Sicher zu unrecht, denn dieses Gebäude, von dem wir eine
Abbildungaus dem Jahr 1690 (Abb. 13) besitzen, hatte weder kirchenähnlichen Carakter,
noch ein bemerkenswert großes Tor. Allerdings ist die Münze in einer auf ihrer Fassade
angebrachten Inschrift als „basilica“ bezeichnet gewesen, aber nicht im Sinne von
„Kirche“, sondern von „Rathaus“. Zeillers Beschreibung würde eher auf den imposanten
Bau des Zeughauses12 (Abb. 14) passen, das in der Zwerchgasse, nördlich des Eingangs
der Schmiedgasse stand, wo sich in der Nähe noch heute die (große und kleine) Riesen-
gasse befindet. Ist diese Gasse mit dem Riesenhaus in Verbindung zu bringen, so käme
als hier gelegen auch der städtische Marstall, von dessen Aussehen wir allerdings
nichts wissen, als größere Gebäude in Frage13. Es ist aber ganz ausgeschlossen, daß
104