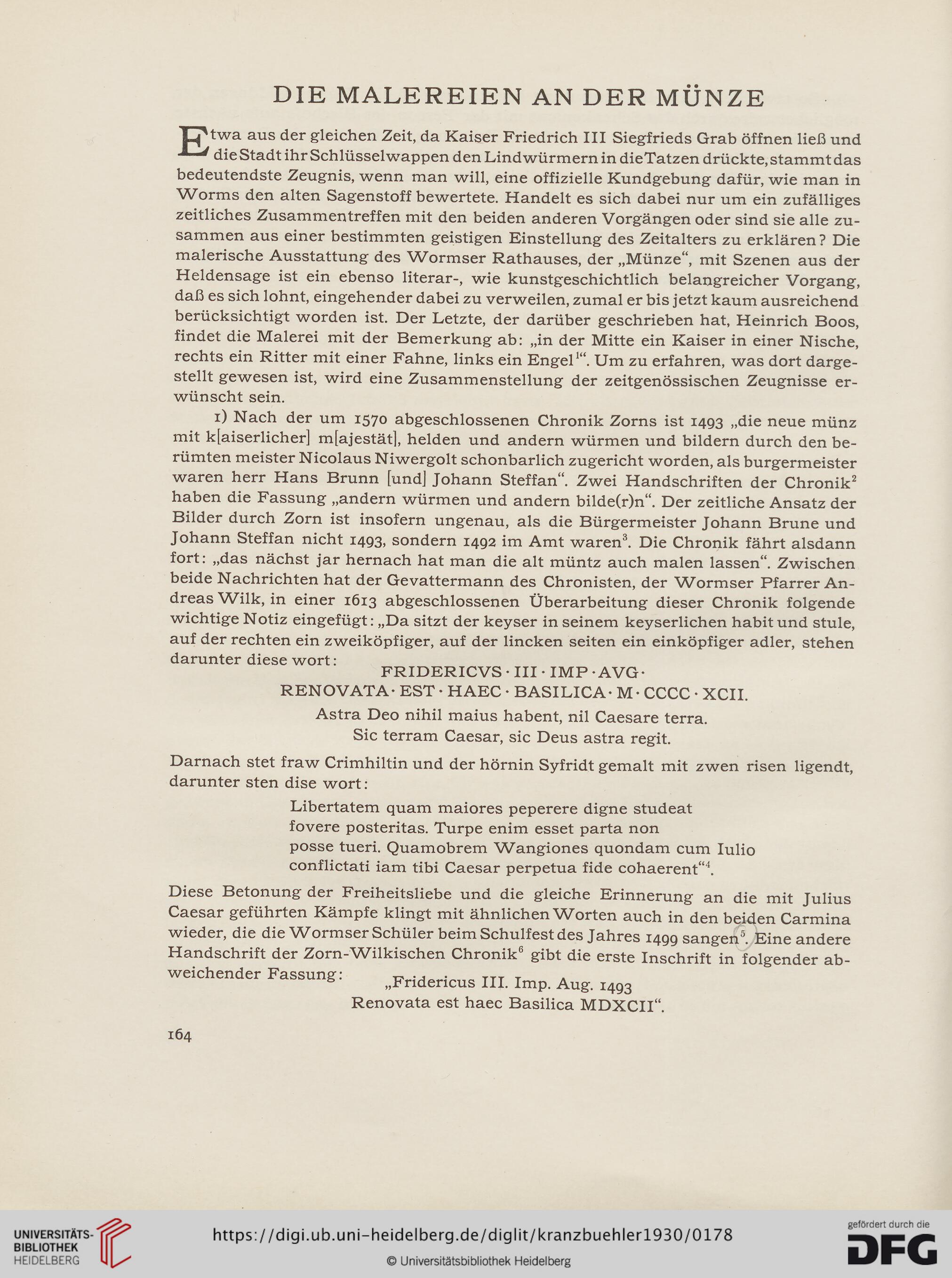DIE MALEREIEN AN DER MÜNZE
Etwa aus der gleichen Zeit, da Kaiser Friedrich III Siegfrieds Grab öffnen ließ und
die Stadt ihr Schlüsselwappen den Lindwürmern in dieTatzen drückte, stammt das
bedeutendste Zeugnis, wenn man will, eine offizielle Kundgebung dafür, wie man in
Worms den alten Sagenstoff bewertete. Handelt es sich dabei nur um ein zufälliges
zeitliches Zusammentreffen mit den beiden anderen Vorgängen oder sind sie alle zu-
sammen aus einer bestimmten geistigen Einstellung des Zeitalters zu erklären? Die
malerische Ausstattung des Wormser Rathauses, der „Münze“, mit Szenen aus der
Heldensage ist ein ebenso literar-, wie kunstgeschichtlich belangreicher Vorgang,
daß es sich lohnt, eingehender dabei zu verweilen, zumal er bis jetzt kaum ausreichend
berücksichtigt worden ist. Der Letzte, der darüber geschrieben hat, Heinrich Boos,
findet die Malerei mit der Bemerkung ab: „in der Mitte ein Kaiser in einer Nische,
rechts ein Ritter mit einer Fahne, links ein Engel1“. Um zu erfahren, was dort darge-
stellt gewesen ist, wird eine Zusammenstellung der zeitgenössischen Zeugnisse er-
wünscht sein.
i) Nach der um 1570 abgeschlossenen Chronik Zorns ist 1493 „die neue münz
mit kaiserlicher] m[ajestät], helden und andern würmen und bildern durch den be-
rümten meister Nicolaus Niwergolt schonbarlich zugericht worden, als burgermeister
waren herr Hans Brunn [und] Johann Steffan“. Zwei Handschriften der Chronik2
haben die Fassung „andern würmen und andern bilde(r)n“. Der zeitliche Ansatz der
Bilder durch Zorn ist insofern ungenau, als die Bürgermeister Johann Brune und
Johann Steffan nicht 1493, sondern 1492 im Amt waren3. Die Chronik fährt alsdann
fort: „das nächst jar hernach hat man die alt müntz auch malen lassen“. Zwischen
beide Nachrichten hat der Gevattermann des Chronisten, der Wormser Pfarrer An-
dreas Wilk, in einer 1613 abgeschlossenen Überarbeitung dieser Chronik folgende
wichtige Notiz eingefügt: „Da sitzt der keyser in seinem keyserlichen habitund stule,
auf der rechten ein zweiköpfiger, auf der lincken Seiten ein einköpfiger adler, stehen
darunter diese wort:
FRIDERICVS • III • IMP - AVG-
RENOVATA- EST • HAEC • BASILICA- M- CCCC • XCII.
Astra Deo nihil maius habent, nil Caesare terra.
Sic terram Caesar, sic Deus astra regit.
Darnach stet fraw Crimhiltin und der hörnin Syfridt gemalt mit zwen risen ligendt,
darunter sten dise wort:
Libertatem quam maiores peperere digne studeat
fovere posteritas. Turpe enim esset parta non
posse tueri. Quamobrem Wangiones quondam cum lulio
conflictati iam tibi Caesar perpetua fide cohaerent“4.
Diese Betonung der Freiheitsliebe und die gleiche Erinnerung an die mit Julius
Caesar geführten Kämpfe klingt mit ähnlichen Worten auch in den beiden Carmina
wieder, die die Wormser Schüler beim Schulfest des Jahres 1499 sangen5. Eine andere
Handschrift der Zorn-Wilkischen Chronik6 gibt die erste Inschrift in folgender ab-
weichender Fassung: ,iFridericus III. Imp. Aug. i493
Renovata est haec Basilica MDXCII“.
164
Etwa aus der gleichen Zeit, da Kaiser Friedrich III Siegfrieds Grab öffnen ließ und
die Stadt ihr Schlüsselwappen den Lindwürmern in dieTatzen drückte, stammt das
bedeutendste Zeugnis, wenn man will, eine offizielle Kundgebung dafür, wie man in
Worms den alten Sagenstoff bewertete. Handelt es sich dabei nur um ein zufälliges
zeitliches Zusammentreffen mit den beiden anderen Vorgängen oder sind sie alle zu-
sammen aus einer bestimmten geistigen Einstellung des Zeitalters zu erklären? Die
malerische Ausstattung des Wormser Rathauses, der „Münze“, mit Szenen aus der
Heldensage ist ein ebenso literar-, wie kunstgeschichtlich belangreicher Vorgang,
daß es sich lohnt, eingehender dabei zu verweilen, zumal er bis jetzt kaum ausreichend
berücksichtigt worden ist. Der Letzte, der darüber geschrieben hat, Heinrich Boos,
findet die Malerei mit der Bemerkung ab: „in der Mitte ein Kaiser in einer Nische,
rechts ein Ritter mit einer Fahne, links ein Engel1“. Um zu erfahren, was dort darge-
stellt gewesen ist, wird eine Zusammenstellung der zeitgenössischen Zeugnisse er-
wünscht sein.
i) Nach der um 1570 abgeschlossenen Chronik Zorns ist 1493 „die neue münz
mit kaiserlicher] m[ajestät], helden und andern würmen und bildern durch den be-
rümten meister Nicolaus Niwergolt schonbarlich zugericht worden, als burgermeister
waren herr Hans Brunn [und] Johann Steffan“. Zwei Handschriften der Chronik2
haben die Fassung „andern würmen und andern bilde(r)n“. Der zeitliche Ansatz der
Bilder durch Zorn ist insofern ungenau, als die Bürgermeister Johann Brune und
Johann Steffan nicht 1493, sondern 1492 im Amt waren3. Die Chronik fährt alsdann
fort: „das nächst jar hernach hat man die alt müntz auch malen lassen“. Zwischen
beide Nachrichten hat der Gevattermann des Chronisten, der Wormser Pfarrer An-
dreas Wilk, in einer 1613 abgeschlossenen Überarbeitung dieser Chronik folgende
wichtige Notiz eingefügt: „Da sitzt der keyser in seinem keyserlichen habitund stule,
auf der rechten ein zweiköpfiger, auf der lincken Seiten ein einköpfiger adler, stehen
darunter diese wort:
FRIDERICVS • III • IMP - AVG-
RENOVATA- EST • HAEC • BASILICA- M- CCCC • XCII.
Astra Deo nihil maius habent, nil Caesare terra.
Sic terram Caesar, sic Deus astra regit.
Darnach stet fraw Crimhiltin und der hörnin Syfridt gemalt mit zwen risen ligendt,
darunter sten dise wort:
Libertatem quam maiores peperere digne studeat
fovere posteritas. Turpe enim esset parta non
posse tueri. Quamobrem Wangiones quondam cum lulio
conflictati iam tibi Caesar perpetua fide cohaerent“4.
Diese Betonung der Freiheitsliebe und die gleiche Erinnerung an die mit Julius
Caesar geführten Kämpfe klingt mit ähnlichen Worten auch in den beiden Carmina
wieder, die die Wormser Schüler beim Schulfest des Jahres 1499 sangen5. Eine andere
Handschrift der Zorn-Wilkischen Chronik6 gibt die erste Inschrift in folgender ab-
weichender Fassung: ,iFridericus III. Imp. Aug. i493
Renovata est haec Basilica MDXCII“.
164