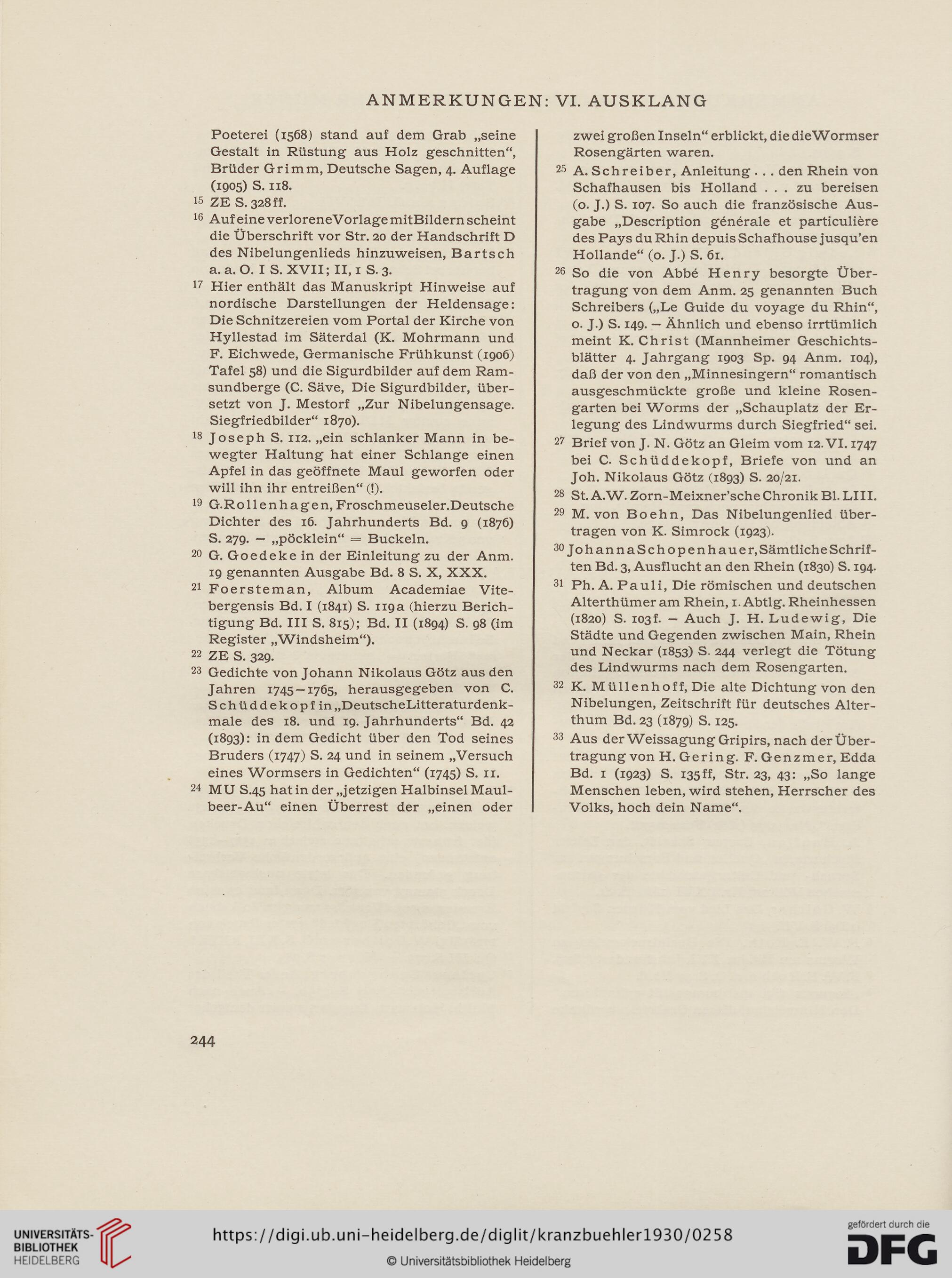ANMERKUNGEN: VI. AUSKLANG
Poeterei (1568) stand auf dem Grab „seine
Gestalt in Rüstung aus Holz geschnitten“,
Brüder Grimm, Deutsche Sagen, 4. Auflage
(1905) S. 118.
15 ZE S. 328 ff.
16 Auf eine verloreneVorlagemitBildern scheint
die Überschrift vor Str. 20 der Handschrift D
des Nibelungenlieds hinzuweisen, Bartsch
a. a. O. I S. XVII; II, 1 S. 3.
17 Hier enthält das Manuskript Hinweise auf
nordische Darstellungen der Heldensage:
Die Schnitzereien vom Portal der Kirche von
Hyllestad im Säterdal (K. Mohrmann und
F. Eichwede, Germanische Frühkunst (1906)
Tafel 58) und die Sigurdbilder auf dem Ram-
sundberge (C. Säve, Die Sigurdbilder, über-
setzt von J. Mestorf „Zur Nibelungensage.
Siegfriedbilder“ 1870).
18 Joseph S. 112. „ein schlanker Mann in be-
wegter Haltung hat einer Schlange einen
Apfel in das geöffnete Maul geworfen oder
will ihn ihr entreißen“ (!).
19 G.Rollenhagen,Froschmeuseler.Deutsche
Dichter des 16. Jahrhunderts Bd. 9 (1876)
S. 279. — „pöcklein“ = Buckeln.
20 G. Goedeke in der Einleitung zu der Anm.
19 genannten Ausgabe Bd. 8 S. X, XXX.
21 Foersteman, Album Academiae Vite-
bergensis Bd. I (1841) S. 119 a (hierzu Berich-
tigung Bd. III S. 815); Bd. II (1894) S. 98 (im
Register „Windsheim“).
22 ZE S. 329.
23 Gedichte von Johann Nikolaus Götz aus den
Jahren 1745 — 1765, herausgegeben von C.
Schüddekopfin „DeutscheLitteraturdenk-
male des 18. und 19. Jahrhunderts“ Bd. 42
(1893): in dem Gedicht über den Tod seines
Bruders (1747) S. 24 und in seinem „Versuch
eines Wormsers in Gedichten“ (1745) S. 11.
24 MU S.45 hat in der „jetzigen Halbinsel Maul-
beer-Au“ einen Überrest der „einen oder
zwei großen Inseln“ erblickt, die dieWormser
Rosengärten waren.
25 A. Schreiber, Anleitung . . . den Rhein von
Schafhausen bis Holland ... zu bereisen
(o. J.) S. 107. So auch die französische Aus-
gabe „Description gdnerale et particuliere
des Pays du Rhin depuis Schafhouse jusqu’en
Hollande“ (o. J.) S. 61.
26 So die von Abbe Henry besorgte Über-
tragung von dem Anm. 25 genannten Buch
Schreibers („Le Guide du voyage du Rhin“,
o. J.) S. 149. — Ähnlich und ebenso irrtümlich
meint K. Christ (Mannheimer Geschichts-
blätter 4. Jahrgang 1903 Sp. 94 Anm. 104),
daß der von den „Minnesingern“ romantisch
ausgeschmückte große und kleine Rosen-
garten bei Worms der „Schauplatz der Er-
legung des Lindwurms durch Siegfried“ sei.
27 Brief von J. N. Götz an Gleim vom 12. VI. 1747
bei C. Schüddekopf, Briefe von und an
Joh. Nikolaus Götz (1893) S. 20/21.
28 St. A.W. Zorn-Meixner’sche Chronik Bl. LIII.
29 M. von Boehn, Das Nibelungenlied über-
tragen von K. Simrock (1923).
30 Jo h an naSch open hau er, Sämtliche Schrif-
ten Bd. 3, Ausflucht an den Rhein (1830) S. 194.
31 Ph. A. Pauli, Die römischen und deutschen
Alterthümer am Rhein, 1. Abtlg. Rheinhessen
(1820) S. 103f. — Auch J. H. Ludewig, Die
Städte und Gegenden zwischen Main, Rhein
und Neckar (1853) S. 244 verlegt die Tötung
des Lindwurms nach dem Rosengarten.
32 K. Müllenhoff, Die alte Dichtung von den
Nibelungen, Zeitschrift für deutsches Alter-
thum Bd. 23 (1879) S. 125.
33 Aus der Weissagung Gripirs, nach der Über-
tragung von H. Gering. F. Genzmer, Edda
Bd. 1 (1923) S. 135Str. 23, 43: „So lange
Menschen leben, wird stehen, Herrscher des
Volks, hoch dein Name“.
244
Poeterei (1568) stand auf dem Grab „seine
Gestalt in Rüstung aus Holz geschnitten“,
Brüder Grimm, Deutsche Sagen, 4. Auflage
(1905) S. 118.
15 ZE S. 328 ff.
16 Auf eine verloreneVorlagemitBildern scheint
die Überschrift vor Str. 20 der Handschrift D
des Nibelungenlieds hinzuweisen, Bartsch
a. a. O. I S. XVII; II, 1 S. 3.
17 Hier enthält das Manuskript Hinweise auf
nordische Darstellungen der Heldensage:
Die Schnitzereien vom Portal der Kirche von
Hyllestad im Säterdal (K. Mohrmann und
F. Eichwede, Germanische Frühkunst (1906)
Tafel 58) und die Sigurdbilder auf dem Ram-
sundberge (C. Säve, Die Sigurdbilder, über-
setzt von J. Mestorf „Zur Nibelungensage.
Siegfriedbilder“ 1870).
18 Joseph S. 112. „ein schlanker Mann in be-
wegter Haltung hat einer Schlange einen
Apfel in das geöffnete Maul geworfen oder
will ihn ihr entreißen“ (!).
19 G.Rollenhagen,Froschmeuseler.Deutsche
Dichter des 16. Jahrhunderts Bd. 9 (1876)
S. 279. — „pöcklein“ = Buckeln.
20 G. Goedeke in der Einleitung zu der Anm.
19 genannten Ausgabe Bd. 8 S. X, XXX.
21 Foersteman, Album Academiae Vite-
bergensis Bd. I (1841) S. 119 a (hierzu Berich-
tigung Bd. III S. 815); Bd. II (1894) S. 98 (im
Register „Windsheim“).
22 ZE S. 329.
23 Gedichte von Johann Nikolaus Götz aus den
Jahren 1745 — 1765, herausgegeben von C.
Schüddekopfin „DeutscheLitteraturdenk-
male des 18. und 19. Jahrhunderts“ Bd. 42
(1893): in dem Gedicht über den Tod seines
Bruders (1747) S. 24 und in seinem „Versuch
eines Wormsers in Gedichten“ (1745) S. 11.
24 MU S.45 hat in der „jetzigen Halbinsel Maul-
beer-Au“ einen Überrest der „einen oder
zwei großen Inseln“ erblickt, die dieWormser
Rosengärten waren.
25 A. Schreiber, Anleitung . . . den Rhein von
Schafhausen bis Holland ... zu bereisen
(o. J.) S. 107. So auch die französische Aus-
gabe „Description gdnerale et particuliere
des Pays du Rhin depuis Schafhouse jusqu’en
Hollande“ (o. J.) S. 61.
26 So die von Abbe Henry besorgte Über-
tragung von dem Anm. 25 genannten Buch
Schreibers („Le Guide du voyage du Rhin“,
o. J.) S. 149. — Ähnlich und ebenso irrtümlich
meint K. Christ (Mannheimer Geschichts-
blätter 4. Jahrgang 1903 Sp. 94 Anm. 104),
daß der von den „Minnesingern“ romantisch
ausgeschmückte große und kleine Rosen-
garten bei Worms der „Schauplatz der Er-
legung des Lindwurms durch Siegfried“ sei.
27 Brief von J. N. Götz an Gleim vom 12. VI. 1747
bei C. Schüddekopf, Briefe von und an
Joh. Nikolaus Götz (1893) S. 20/21.
28 St. A.W. Zorn-Meixner’sche Chronik Bl. LIII.
29 M. von Boehn, Das Nibelungenlied über-
tragen von K. Simrock (1923).
30 Jo h an naSch open hau er, Sämtliche Schrif-
ten Bd. 3, Ausflucht an den Rhein (1830) S. 194.
31 Ph. A. Pauli, Die römischen und deutschen
Alterthümer am Rhein, 1. Abtlg. Rheinhessen
(1820) S. 103f. — Auch J. H. Ludewig, Die
Städte und Gegenden zwischen Main, Rhein
und Neckar (1853) S. 244 verlegt die Tötung
des Lindwurms nach dem Rosengarten.
32 K. Müllenhoff, Die alte Dichtung von den
Nibelungen, Zeitschrift für deutsches Alter-
thum Bd. 23 (1879) S. 125.
33 Aus der Weissagung Gripirs, nach der Über-
tragung von H. Gering. F. Genzmer, Edda
Bd. 1 (1923) S. 135Str. 23, 43: „So lange
Menschen leben, wird stehen, Herrscher des
Volks, hoch dein Name“.
244