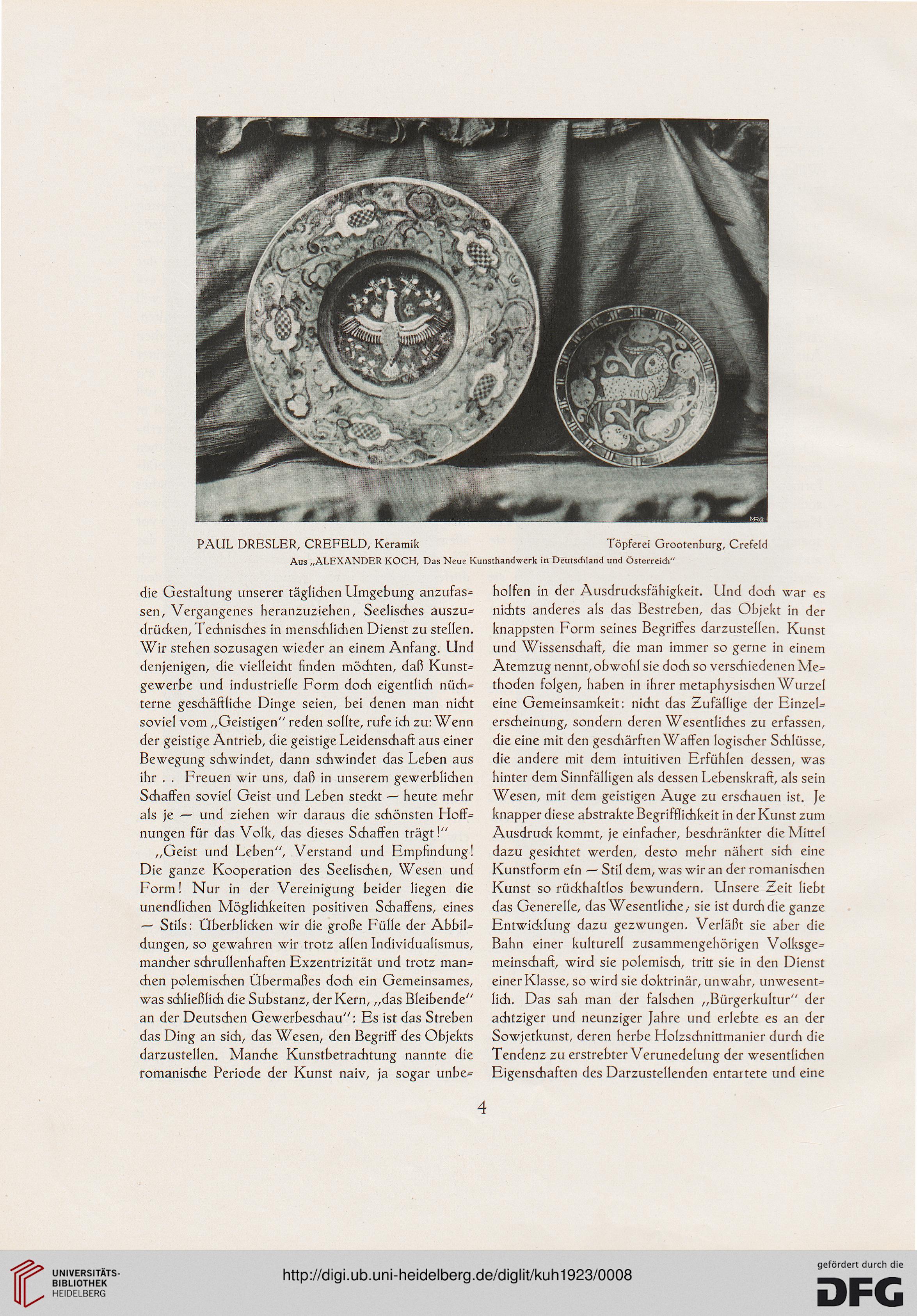PAUL DRESLER, CREFELD, Keramik Töpferei Grootenburg, Crefeld
Aus „ALEXANDER KOCH, Das Neue Kunsthandwerk in Deutsdiland und Österreich"
die Gestaltung unserer täglichen Umgebung anzufas»
sen, Vergangenes heranzuziehen, Seelisches auszu»
drücken, Technisches in menschlichen Dienst zu stellen.
Wir stehen sozusagen wieder an einem Anfang. Und
denjenigen, die vielleidit finden möchten, daß Kunst-
gewerbe und industrielle Form doch eigentlich nüch-
terne geschäftliche Dinge seien, bei denen man nicht
soviel vom „Geistigen" reden sollte, rufe ich zu: Wenn
der geistige Antrieb, die geistige Leidenschaft aus einer
Bewegung schwindet, dann schwindet das Leben aus
ihr . . Freuen wir uns, daß in unserem gewerblichen
Schaffen soviel Geist und Leben stecht — heute mehr
als je — und ziehen wir daraus die schönsten Hoff-
nungen für das Volk, das dieses Schaffen trägt \"
„Geist und Leben", Verstand und Empfindung!
Die ganze Kooperation des Seelischen, Wesen und
Form! Nur in der Vereinigung beider liegen die
unendlichen Möglichkeiten positiven Schaffens, eines
— Stils: Überblicken wir die große Fülle der Abbil-
düngen, so gewahren wir trotz allen Individualismus,
mancher schrullenhaften Exzentrizität und trotz man»
chen polemischen Übermaßes doch ein Gemeinsames,
was schließlich die Substanz, der Kern, „das Bleibende"
an der Deutschen Gewerbeschau": Es ist das Streben
das Ding an sich, das Wesen, den Begriff des Objekts
darzustellen. Manche Kunstbetrachtung nannte die
romanische Periode der Kunst naiv, ja sogar unbe-
holfen in der Ausdrudcsfähigkeit. Und doch war es
nichts anderes als das Bestreben, das Objekt in der
knappsten Form seines Begriffes darzustellen. Kunst
und Wissenschaft, die man immer so gerne in einem
Atemzug nennt, obwohl sie doch so verschiedenen Me-
thoden folgen, haben in ihrer metaphysischen Wurzel
eine Gemeinsamkeit: nicht das Zufällige der EinzeU
erscheinung, sondern deren Wesentliches zu erfassen,
die eine mit den gesdiärften Waffen logischer Schlüsse,
die andere mit dem intuitiven Erfühlen dessen, was
hinter dem Sinnfälligen als dessen Lebenskraft, als sein
Wesen, mit dem geistigen Auge zu erschauen ist. Je
knapper diese abstrakte Begrifflichkeit in der Kunst zum
Ausdruck kommt, je einfacher, beschränkter die Mittel
dazu gesichtet werden, desto mehr nähert sich eine
Kunstform ein — Stil dem, was wir an der romanischen
Kunst so rüchhaltlos bewundern. Unsere Zeit liebt
das Generelle, das Wesentliche,- sie ist durch die ganze
Entwicklung dazu gezwungen. Verläßt sie aber die
Bahn einer kulturell zusammengehörigen Volksge-
meinschaft, wird sie polemisch, tritt sie in den Dienst
einer Klasse, so wird sie doktrinär, unwahr, unwesent-
lieh. Das sah man der falschen „Bürgerkultur" der
achtziger und neunziger Jahre und erlebte es an der
Sowjetkunst, deren herbe Holzschnittmanier durch die
Tendenz zu erstrebter Verunedelung der wesentlichen
Eigenschaften des Darzustellenden entartete und eine
4
Aus „ALEXANDER KOCH, Das Neue Kunsthandwerk in Deutsdiland und Österreich"
die Gestaltung unserer täglichen Umgebung anzufas»
sen, Vergangenes heranzuziehen, Seelisches auszu»
drücken, Technisches in menschlichen Dienst zu stellen.
Wir stehen sozusagen wieder an einem Anfang. Und
denjenigen, die vielleidit finden möchten, daß Kunst-
gewerbe und industrielle Form doch eigentlich nüch-
terne geschäftliche Dinge seien, bei denen man nicht
soviel vom „Geistigen" reden sollte, rufe ich zu: Wenn
der geistige Antrieb, die geistige Leidenschaft aus einer
Bewegung schwindet, dann schwindet das Leben aus
ihr . . Freuen wir uns, daß in unserem gewerblichen
Schaffen soviel Geist und Leben stecht — heute mehr
als je — und ziehen wir daraus die schönsten Hoff-
nungen für das Volk, das dieses Schaffen trägt \"
„Geist und Leben", Verstand und Empfindung!
Die ganze Kooperation des Seelischen, Wesen und
Form! Nur in der Vereinigung beider liegen die
unendlichen Möglichkeiten positiven Schaffens, eines
— Stils: Überblicken wir die große Fülle der Abbil-
düngen, so gewahren wir trotz allen Individualismus,
mancher schrullenhaften Exzentrizität und trotz man»
chen polemischen Übermaßes doch ein Gemeinsames,
was schließlich die Substanz, der Kern, „das Bleibende"
an der Deutschen Gewerbeschau": Es ist das Streben
das Ding an sich, das Wesen, den Begriff des Objekts
darzustellen. Manche Kunstbetrachtung nannte die
romanische Periode der Kunst naiv, ja sogar unbe-
holfen in der Ausdrudcsfähigkeit. Und doch war es
nichts anderes als das Bestreben, das Objekt in der
knappsten Form seines Begriffes darzustellen. Kunst
und Wissenschaft, die man immer so gerne in einem
Atemzug nennt, obwohl sie doch so verschiedenen Me-
thoden folgen, haben in ihrer metaphysischen Wurzel
eine Gemeinsamkeit: nicht das Zufällige der EinzeU
erscheinung, sondern deren Wesentliches zu erfassen,
die eine mit den gesdiärften Waffen logischer Schlüsse,
die andere mit dem intuitiven Erfühlen dessen, was
hinter dem Sinnfälligen als dessen Lebenskraft, als sein
Wesen, mit dem geistigen Auge zu erschauen ist. Je
knapper diese abstrakte Begrifflichkeit in der Kunst zum
Ausdruck kommt, je einfacher, beschränkter die Mittel
dazu gesichtet werden, desto mehr nähert sich eine
Kunstform ein — Stil dem, was wir an der romanischen
Kunst so rüchhaltlos bewundern. Unsere Zeit liebt
das Generelle, das Wesentliche,- sie ist durch die ganze
Entwicklung dazu gezwungen. Verläßt sie aber die
Bahn einer kulturell zusammengehörigen Volksge-
meinschaft, wird sie polemisch, tritt sie in den Dienst
einer Klasse, so wird sie doktrinär, unwahr, unwesent-
lieh. Das sah man der falschen „Bürgerkultur" der
achtziger und neunziger Jahre und erlebte es an der
Sowjetkunst, deren herbe Holzschnittmanier durch die
Tendenz zu erstrebter Verunedelung der wesentlichen
Eigenschaften des Darzustellenden entartete und eine
4