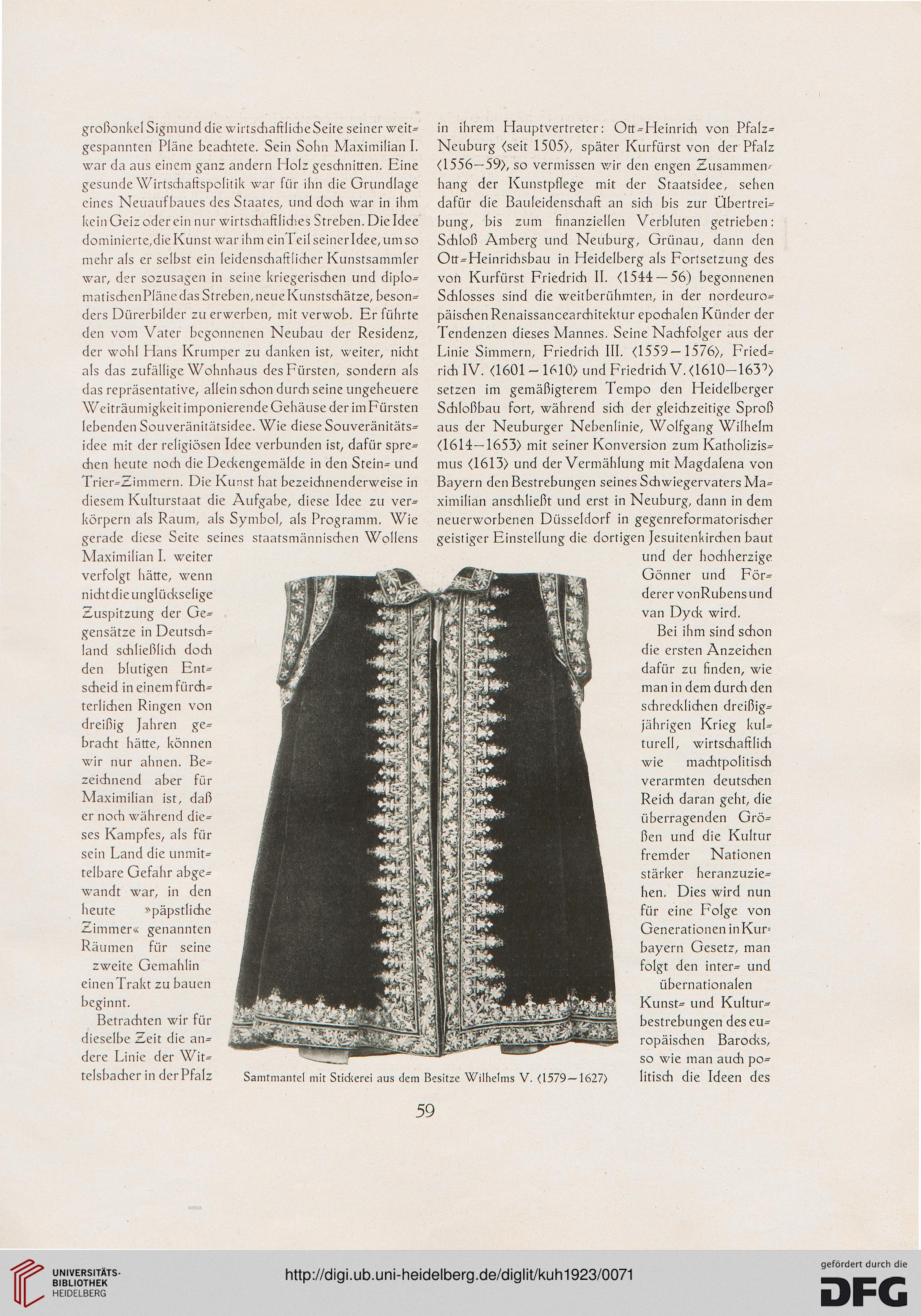großonkel Sigmund die wirtsdiaftlidieSeite seiner weit-
gespannten Pläne beachtete. Sein Sohn Maximilian I.
war da aus einem ganz andern Holz geschnitten. Eine
gesunde Wirtschaftspolitik war für ihn die Grundlage
eines Neuaufbaues des Staates, und doch war in ihm
kcinGeizoderein nur wirtschafilidies Streben. Dieldee
dominierte,die Kunst war ihm einTeil seiner Idee, um so
mehr als er selbst ein leidensdiaftlidicr Kunstsammler
war, der sozusagen in seine kriegerischen und diplo*
matischenPlänc das Streben, neue Kunstschätze, beson»
ders Dürerbilder zu erwerben, mit verwob. Er führte
den vom Vater begonnenen Neubau der Residenz,
der wohl Hans Krumper zu danken ist, weiter, nicht
als das zufällige Wohnhaus des Fürsten, sondern als
das repräsentative, allein schon durch seine ungeheuere
Weiträumigkeit imponierende Gehäuse der imFürsten
lebenden Souveränitätsidee. Wie diese Souveränitäts*
idee mit der religiösen Idee verbunden ist, dafür spre-
chen heute noch die Deckengemälde in den Steina und
Trier=Zimmern. Die Kunst hat bezeichnenderweise in
diesem Kulturstaat die Aufgabe, diese Idee zu ver-
körpern als Raum, als Symbol, als Programm. Wie
gerade diese Seite seines staatsmännischen Wollens
Maximilian I. weiter
verfolgt hätte, wenn
nicht die unglüd<selige
Zuspitzung der Ge*
gensätze in Deutsch*
land schließlich doch
den blutigen Ent»
scheid in einem fürch*
terlichen Ringen von
dreißig Jahren ge-
bracht hätte, können
wir nur ahnen. Be-
zeichnend aber für
Maximilian ist, daß
er noch während die-
ses Kampfes, als für
sein Land die unmit-
telbare Gefahr abge-
wandt war, in den
heute »päpstliche
Zimmer« genannten
Rä umen für seine
zweite Gemahlin
einenTrakt zu bauen
beginnt.
Betrachten wir für
dieselbe Zeit die an*
dere Linie der Wit-
telsbacher in der Pfalz
Samtmantel mit Stickerei aus dem Besitze Wilhelms V. <1579—1627)
in ihrem Hauptvertreter: Oa>Heinrich von Pfalz*
Neuburg <seit 1505), später Kurfürst von der Pfalz
(1556—59), so vermissen wir den engen Zusammen-
hang der Kunstpflege mit der Staatsidee, sehen
dafür die Bauleidenschaft an sich bis zur ÜbertreU
bung, bis zum finanziellen Verbluten getrieben:
Schloß Amberg und Neuburg, Grünau, dann den
Ott=Heinrichsbau in Heidelberg als Fortsetzung des
von Kurfürst Friedrich II. (1544 — 56) begonnenen
Schlosses sind die weitberühmten, in der nordeuro*
päischen Renaissancearchitektur epochalen Künder der
Tendenzen dieses Mannes. Seine Nachfolger aus der
Linie Simmern, Friedrich III. (1559—1576), Fried*
rieh IV. (1601-1610) und Friedrich V. (1610-163^)
setzen im gemäßigterem Tempo den Heidelberger
Schloßbau fort, während sich der gleichzeitige Sproß
aus der Neuburger Nebenlinie, Wolfgang Wilhelm
(1614—1653) mit seiner Konversion zum Katholizis*
mus (1613) und der Vermählung mit Magdalena von
Bayern den Bestrebungen seines Schwiegervaters Ma-
ximilian anschließt und erst in Neuburg, dann in dem
neuerworbenen Düsseldorf in gegenreformatorischer
geistiger Einstellung die dortigen Jesuitenkirchen baut
und der hochherzige
Gönner und För*
derer vonRubensund
van Dydc wird.
Bei ihm sind schon
die ersten Anzeichen
dafür zu finden, wie
man in dem durch den
schredelichen dreißig*
jährigen Krieg kul-
turell, wirtschaftlich
wie machtpolitisch
verarmten deutschen
Reich daran geht, die
überragenden Grö*
ßen und die Kultur
fremder Nationen
stärker heranzuzie*
hen. Dies wird nun
für eine Folge von
Generationen inKur-
bayern Gesetz, man
folgt den inter* und
übernationalen
Kunst* und Kultur*
bestrebungen des eu*
ropäischen Barocks,
so wie man auch po*
litisch die Ideen des
59
gespannten Pläne beachtete. Sein Sohn Maximilian I.
war da aus einem ganz andern Holz geschnitten. Eine
gesunde Wirtschaftspolitik war für ihn die Grundlage
eines Neuaufbaues des Staates, und doch war in ihm
kcinGeizoderein nur wirtschafilidies Streben. Dieldee
dominierte,die Kunst war ihm einTeil seiner Idee, um so
mehr als er selbst ein leidensdiaftlidicr Kunstsammler
war, der sozusagen in seine kriegerischen und diplo*
matischenPlänc das Streben, neue Kunstschätze, beson»
ders Dürerbilder zu erwerben, mit verwob. Er führte
den vom Vater begonnenen Neubau der Residenz,
der wohl Hans Krumper zu danken ist, weiter, nicht
als das zufällige Wohnhaus des Fürsten, sondern als
das repräsentative, allein schon durch seine ungeheuere
Weiträumigkeit imponierende Gehäuse der imFürsten
lebenden Souveränitätsidee. Wie diese Souveränitäts*
idee mit der religiösen Idee verbunden ist, dafür spre-
chen heute noch die Deckengemälde in den Steina und
Trier=Zimmern. Die Kunst hat bezeichnenderweise in
diesem Kulturstaat die Aufgabe, diese Idee zu ver-
körpern als Raum, als Symbol, als Programm. Wie
gerade diese Seite seines staatsmännischen Wollens
Maximilian I. weiter
verfolgt hätte, wenn
nicht die unglüd<selige
Zuspitzung der Ge*
gensätze in Deutsch*
land schließlich doch
den blutigen Ent»
scheid in einem fürch*
terlichen Ringen von
dreißig Jahren ge-
bracht hätte, können
wir nur ahnen. Be-
zeichnend aber für
Maximilian ist, daß
er noch während die-
ses Kampfes, als für
sein Land die unmit-
telbare Gefahr abge-
wandt war, in den
heute »päpstliche
Zimmer« genannten
Rä umen für seine
zweite Gemahlin
einenTrakt zu bauen
beginnt.
Betrachten wir für
dieselbe Zeit die an*
dere Linie der Wit-
telsbacher in der Pfalz
Samtmantel mit Stickerei aus dem Besitze Wilhelms V. <1579—1627)
in ihrem Hauptvertreter: Oa>Heinrich von Pfalz*
Neuburg <seit 1505), später Kurfürst von der Pfalz
(1556—59), so vermissen wir den engen Zusammen-
hang der Kunstpflege mit der Staatsidee, sehen
dafür die Bauleidenschaft an sich bis zur ÜbertreU
bung, bis zum finanziellen Verbluten getrieben:
Schloß Amberg und Neuburg, Grünau, dann den
Ott=Heinrichsbau in Heidelberg als Fortsetzung des
von Kurfürst Friedrich II. (1544 — 56) begonnenen
Schlosses sind die weitberühmten, in der nordeuro*
päischen Renaissancearchitektur epochalen Künder der
Tendenzen dieses Mannes. Seine Nachfolger aus der
Linie Simmern, Friedrich III. (1559—1576), Fried*
rieh IV. (1601-1610) und Friedrich V. (1610-163^)
setzen im gemäßigterem Tempo den Heidelberger
Schloßbau fort, während sich der gleichzeitige Sproß
aus der Neuburger Nebenlinie, Wolfgang Wilhelm
(1614—1653) mit seiner Konversion zum Katholizis*
mus (1613) und der Vermählung mit Magdalena von
Bayern den Bestrebungen seines Schwiegervaters Ma-
ximilian anschließt und erst in Neuburg, dann in dem
neuerworbenen Düsseldorf in gegenreformatorischer
geistiger Einstellung die dortigen Jesuitenkirchen baut
und der hochherzige
Gönner und För*
derer vonRubensund
van Dydc wird.
Bei ihm sind schon
die ersten Anzeichen
dafür zu finden, wie
man in dem durch den
schredelichen dreißig*
jährigen Krieg kul-
turell, wirtschaftlich
wie machtpolitisch
verarmten deutschen
Reich daran geht, die
überragenden Grö*
ßen und die Kultur
fremder Nationen
stärker heranzuzie*
hen. Dies wird nun
für eine Folge von
Generationen inKur-
bayern Gesetz, man
folgt den inter* und
übernationalen
Kunst* und Kultur*
bestrebungen des eu*
ropäischen Barocks,
so wie man auch po*
litisch die Ideen des
59