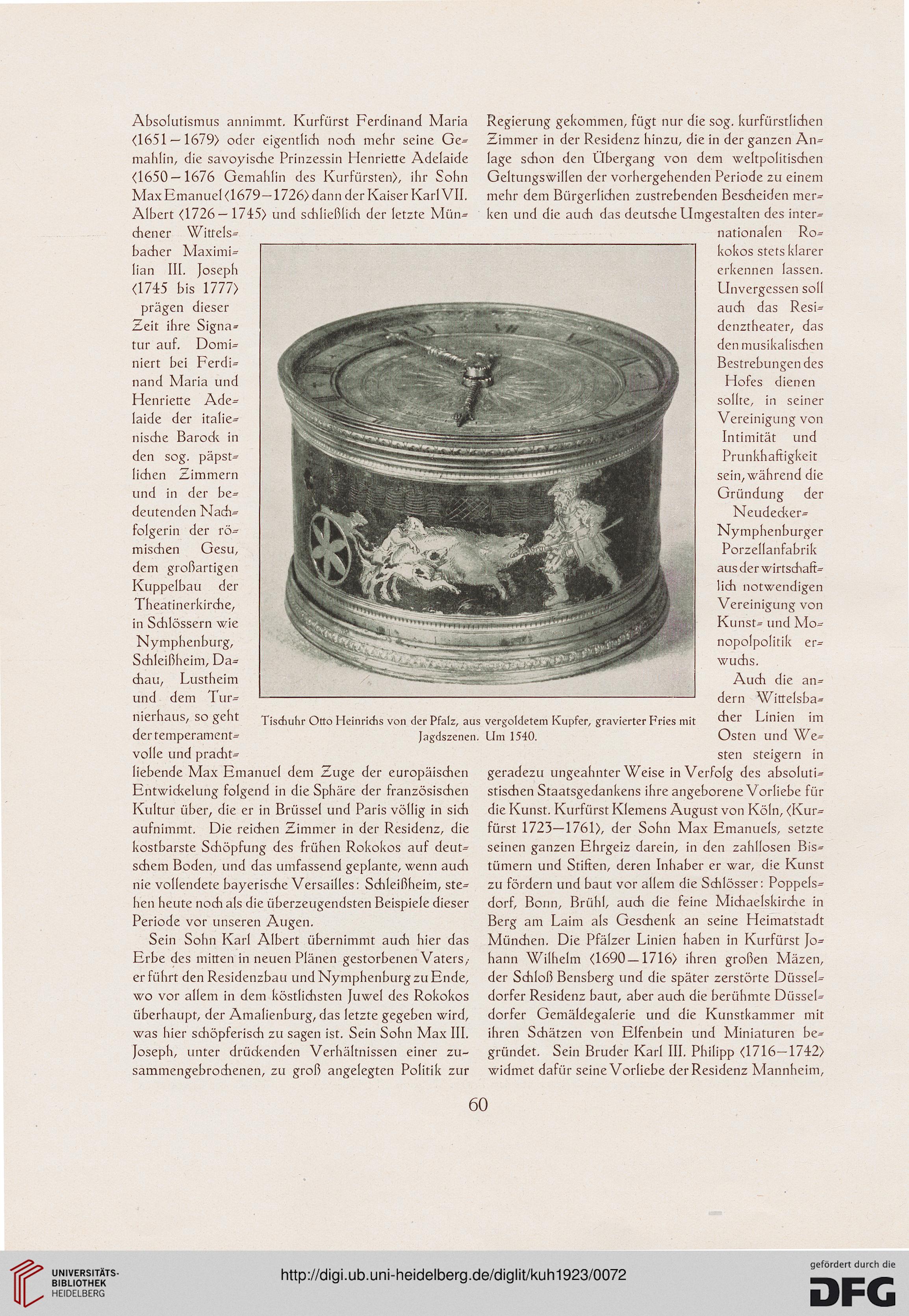Absolutismus annimmt. Kurfürst Ferdinand Maria
<1651 —1679) oder eigentlich nocfi mehr seine Ge-
mahlin, die savoyische Prinzessin Henriette Adelaide
<1650—1676 Gemahlin des Kurfürsten), ihr Sohn
Max Emanuel <1679—1726) dann der Kaiser Karl VII.
Albert <1726 — 1745) und schließlidi der letzte Mün-
ebener Wittels»
bacher Maximi-
lian III. Joseph
<1745 bis 1777)
prägen dieser
Zeit ihre Signa»
tur auf. Domi-
niert bei Ferdi»
nand Maria und
Henriette Ade-
laide der italie»
nisdie Barock in
den sog. päpst-
lichen Zimmern
und in der be-
deutenden Nach-
folgerin der rö*
mischen Gesu,
dem großartigen
Kuppelbau der
Theatinerkirdie,
in Schlössern wie
Nymphenburg,
Schleißheim, Da-
chau, Lustheim
und dem Tur-
nierhaus, so geht
der temperament»
volle und pracht-
liebende Max Emanuel dem Zuge der europäischen
Entwickelung folgend in die Sphäre der französischen
Kultur über, die er in Brüssel und Paris völlig in sich
aufnimmt. Die reidien Zimmer in der Residenz, die
kostbarste Schöpfung des frühen Rokokos auf deut»
sdiem Boden, und das umfassend geplante, wenn auch
nie vollendete bayerische Versailles: Schleißheim, ste»
hen heute noch als die überzeugendsten Beispiele dieser
Periode vor unseren Augen.
Sein Sohn Karl Albert übernimmt audi hier das
Erbe des mitten in neuen Plänen gestorbenen Vaters,•
erführt den Residenzbau und Nymphenburg zu Ende,
wo vor allem in dem köstlichsten Juwel des Rokokos
überhaupt, der Amalienburg, das letzte gegeben wird,
was hier schöpferisch zu sagen ist. Sein Sohn Max III.
Joseph, unter drückenden Verhältnissen einer zu-
sammengebrochenen, zu groß angelegten Politik zur
Tisdiuhr Otto Heinrichs von der Pfalz, aus vergoldetem Kupfer, gravierter Fries mit
Jagdszenen. Um 1540.
Regierung gekommen, fügt nur die sog. kurfürstlichen
Zimmer in der Residenz hinzu, die in der ganzen An-
läge schon den Übergang von dem weltpolitischen
Geltungswillen der vorhergehenden Periode zu einem
mehr dem Bürgerlichen zustrebenden Bescheiden mer-
ken und die audi das deutsche Umgestalten des inter»
nationalen Ro-
kokos stets klarer
erkennen lassen.
Unvergessen soll
auch das Resi-
denztheater, das
den musikalischen
Bestrebungendes
Hofes dienen
sollre, in seiner
Vereinigung von
Intimität und
Prunkhaftigkeit
sein, während die
Gründung der
Neudecker»
Nymphenburger
Porzellanfabrik
aus der wirtschafte
lidi notwendigen
Vereinigung von
Kunst= und Mo-
nopolpolitik er»
wuchs.
Audi die an»
dern Wittelsba»
eher Linien im
Osten und We»
sten steigern in
geradezu ungeahnter Weise in Verfolg des absolutio
stischen Staatsgedankens ihre angeborene Vorliebe für
die Kunst. Kurfürst Klemens August von Köln, <Kur»
fürst 1723—1761), der Sohn Max Emanuels, setzte
seinen ganzen Ehrgeiz darein, in den zahllosen Bis»
tümern und Stiften, deren Inhaber er war, die Kunst
zu fördern und baut vor allem die Sdilösser: Poppeis»
dorf, Bonn, Brühl, auch die feine Michaelskirche in
Berg am Laim als Geschenk an seine Heimatstadt
München. Die Pfälzer Linien haben in Kurfürst Jo-
hann Wilhelm (1690—1716) ihren großen Mäzen,
der Schloß Bensberg und die später zerstörte Düssel»
dorfer Residenz baut, aber auch die berühmte Düssel»
dorfer Gemäldegalerie und die Kunstkammer mit
ihren Schätzen von Elfenbein und Miniaturen be»
gründet. Sein Bruder Karl III. Philipp <1716-1742>
widmet dafür seine Vorliebe der Residenz Mannheim,
60
<1651 —1679) oder eigentlich nocfi mehr seine Ge-
mahlin, die savoyische Prinzessin Henriette Adelaide
<1650—1676 Gemahlin des Kurfürsten), ihr Sohn
Max Emanuel <1679—1726) dann der Kaiser Karl VII.
Albert <1726 — 1745) und schließlidi der letzte Mün-
ebener Wittels»
bacher Maximi-
lian III. Joseph
<1745 bis 1777)
prägen dieser
Zeit ihre Signa»
tur auf. Domi-
niert bei Ferdi»
nand Maria und
Henriette Ade-
laide der italie»
nisdie Barock in
den sog. päpst-
lichen Zimmern
und in der be-
deutenden Nach-
folgerin der rö*
mischen Gesu,
dem großartigen
Kuppelbau der
Theatinerkirdie,
in Schlössern wie
Nymphenburg,
Schleißheim, Da-
chau, Lustheim
und dem Tur-
nierhaus, so geht
der temperament»
volle und pracht-
liebende Max Emanuel dem Zuge der europäischen
Entwickelung folgend in die Sphäre der französischen
Kultur über, die er in Brüssel und Paris völlig in sich
aufnimmt. Die reidien Zimmer in der Residenz, die
kostbarste Schöpfung des frühen Rokokos auf deut»
sdiem Boden, und das umfassend geplante, wenn auch
nie vollendete bayerische Versailles: Schleißheim, ste»
hen heute noch als die überzeugendsten Beispiele dieser
Periode vor unseren Augen.
Sein Sohn Karl Albert übernimmt audi hier das
Erbe des mitten in neuen Plänen gestorbenen Vaters,•
erführt den Residenzbau und Nymphenburg zu Ende,
wo vor allem in dem köstlichsten Juwel des Rokokos
überhaupt, der Amalienburg, das letzte gegeben wird,
was hier schöpferisch zu sagen ist. Sein Sohn Max III.
Joseph, unter drückenden Verhältnissen einer zu-
sammengebrochenen, zu groß angelegten Politik zur
Tisdiuhr Otto Heinrichs von der Pfalz, aus vergoldetem Kupfer, gravierter Fries mit
Jagdszenen. Um 1540.
Regierung gekommen, fügt nur die sog. kurfürstlichen
Zimmer in der Residenz hinzu, die in der ganzen An-
läge schon den Übergang von dem weltpolitischen
Geltungswillen der vorhergehenden Periode zu einem
mehr dem Bürgerlichen zustrebenden Bescheiden mer-
ken und die audi das deutsche Umgestalten des inter»
nationalen Ro-
kokos stets klarer
erkennen lassen.
Unvergessen soll
auch das Resi-
denztheater, das
den musikalischen
Bestrebungendes
Hofes dienen
sollre, in seiner
Vereinigung von
Intimität und
Prunkhaftigkeit
sein, während die
Gründung der
Neudecker»
Nymphenburger
Porzellanfabrik
aus der wirtschafte
lidi notwendigen
Vereinigung von
Kunst= und Mo-
nopolpolitik er»
wuchs.
Audi die an»
dern Wittelsba»
eher Linien im
Osten und We»
sten steigern in
geradezu ungeahnter Weise in Verfolg des absolutio
stischen Staatsgedankens ihre angeborene Vorliebe für
die Kunst. Kurfürst Klemens August von Köln, <Kur»
fürst 1723—1761), der Sohn Max Emanuels, setzte
seinen ganzen Ehrgeiz darein, in den zahllosen Bis»
tümern und Stiften, deren Inhaber er war, die Kunst
zu fördern und baut vor allem die Sdilösser: Poppeis»
dorf, Bonn, Brühl, auch die feine Michaelskirche in
Berg am Laim als Geschenk an seine Heimatstadt
München. Die Pfälzer Linien haben in Kurfürst Jo-
hann Wilhelm (1690—1716) ihren großen Mäzen,
der Schloß Bensberg und die später zerstörte Düssel»
dorfer Residenz baut, aber auch die berühmte Düssel»
dorfer Gemäldegalerie und die Kunstkammer mit
ihren Schätzen von Elfenbein und Miniaturen be»
gründet. Sein Bruder Karl III. Philipp <1716-1742>
widmet dafür seine Vorliebe der Residenz Mannheim,
60