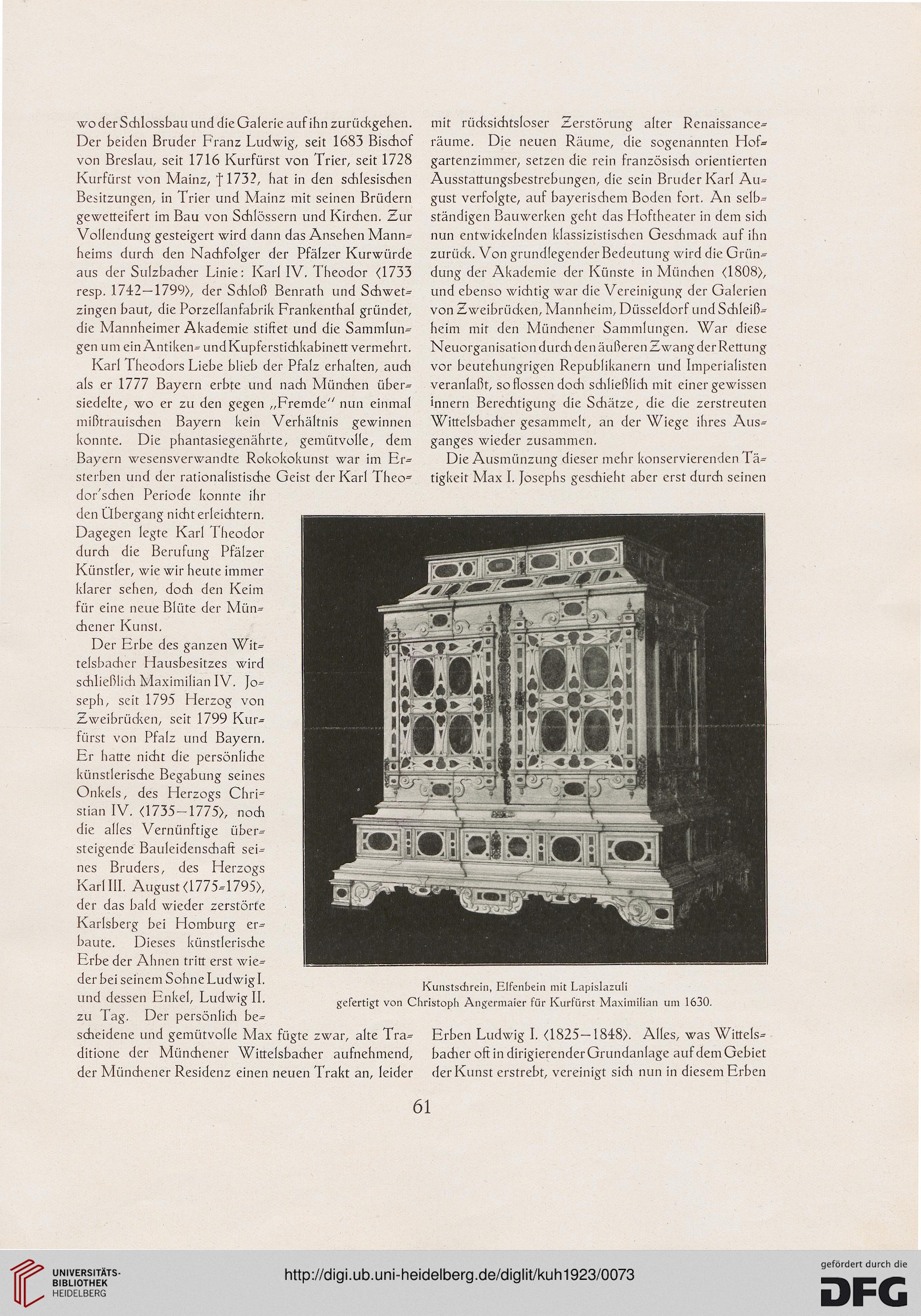wo der Schlossbau und die Galerie auf ihn zurückgehen.
Der beiden Bruder Franz Ludwig, seit 1683 Bischof
von Breslau, seit 1716 Kurfürst von Trier, seit 1728
Kurfürst von Mainz, M73?, hat in den sdilesisdien
Besitzungen, in Trier und Mainz mit seinen Brüdern
gewetteifert im Bau von Schlössern und Kirchen. Zur
Vollendung gesteigert wird dann das Ansehen Mann-
heims durch den Nachfolger der Pfälzer Kurwürde
aus der Sulzbacher Linie: Karl IV. Theodor (1733
resp. 1742—1799), der Schloß Benrath und Schwefe
zingen baut, die Porzellanfabrik Frankenthal gründet,
die Mannheimer Akademie stiftet und die Sammlun-
gen um ein Antiken- undKupferstichkabinett vermehrt.
Karl Theodors Liebe blieb der Pfalz erhalten, auch
als er 1777 Bayern erbte und nach München über-
siedelte, wo er zu den gegen „Fremde" nun einmal
mißtrauischen Bayern kein Verhältnis gewinnen
konnte. Die phantasiegenährte, gemütvolle, dem
Bayern wesensverwandte Rokokokunst war im Er-
sterben und der rationalistische Geist der Karl Theo-
dor'schen Periode konnte ihr
den Übergang nicht erleichtern.
Dagegen legte Karl Theodor
durch die Berufung Pfälzer
Künstler, wie wir heute immer
klarer sehen, doch den Keim
für eine neue Blüte der Mün-
ebener Kunst.
Der Erbe des ganzen Wit-
telsbadier Hausbesitzes wird
schließlidi Maximilian IV. Jo-
seph, seit 1795 Herzog von
Zweibrüd^en, seit 1799 Kur-
fürst von Pfalz und Bayern.
Er hatte nicht die persönliche
künstlerische Begabung seines
Onkels, des Herzogs Chri-
stian IV. <1735-1775>, noch
die alles Vernünftige über-
steigende Bauleidenschaft sei-
nes Bruders, des Herzogs
Karl III. August <1775-1795>,
der das bald wieder zerstörte
Karlsberg bei Homburg er-
baute. Dieses künstlerische
Erbe der Ahnen tritt erst wie-
der bei seinem Sohne Ludwig I.
und dessen Enkel, Ludwig II.
zu Tag. Der persönlich be-
scheidene und gemütvolle Max fügte zwar, alte Tra-
ditione der Münchener Wittelsbacher aufnehmend,
der Mündiener Residenz einen neuen Trakt an, leider
mit rüdtsichtsloser Zerstörung alter Renaissance-
räume. Die neuen Räume, die sogenannten Hof*
gartenzimmer, setzen die rein französisch orientierten
Ausstattungsbestrebungen, die sein Bruder Karl Au-
gust verfolgte, auf bayerisdiem Boden fort. An selb-
ständigen Bauwerken geht das Hoftheater in dem sich
nun entwickelnden klassizistischen Geschmadi auf ihn
zurüdt. Von grundlegender Bedeutung wird die Grün-
dung der Akademie der Künste in München <1808>,
und ebenso wichtig war die Vereinigung der Galerien
von Zweibrüdcen, Mannheim, Düsseldorf und Schleiße
heim mit den Münchener Sammlungen. War diese
Neuorganisation durch den äußeren Zwang der Rettung
vor beutehungrigen Republikanern und Imperialisten
veranlaßt, so flössen doch schließlich mit einer gewissen
Innern Berechtigung die Schätze, die die zerstreuten
Wittelsbacher gesammelt, an der Wiege ihres Aus-
ganges wieder zusammen.
Die Ausmünzung dieser mehr konservierenden Tä-
tigkeit Max I. Josephs geschieht aber erst durch seinen
Kunstsdirein, Elfenbein mit Lapislazuli
gefertigt von Christoph Angermaier für Kurfürst Maximilian um 1630.
Erben Ludwig I. (1825-1848). Alles, was Wittels-
bacher oft in dirigierender Grundanlage auf dem Gebiet
der Kunst erstrebt, vereinigt sich nun in diesem Erben
61
Der beiden Bruder Franz Ludwig, seit 1683 Bischof
von Breslau, seit 1716 Kurfürst von Trier, seit 1728
Kurfürst von Mainz, M73?, hat in den sdilesisdien
Besitzungen, in Trier und Mainz mit seinen Brüdern
gewetteifert im Bau von Schlössern und Kirchen. Zur
Vollendung gesteigert wird dann das Ansehen Mann-
heims durch den Nachfolger der Pfälzer Kurwürde
aus der Sulzbacher Linie: Karl IV. Theodor (1733
resp. 1742—1799), der Schloß Benrath und Schwefe
zingen baut, die Porzellanfabrik Frankenthal gründet,
die Mannheimer Akademie stiftet und die Sammlun-
gen um ein Antiken- undKupferstichkabinett vermehrt.
Karl Theodors Liebe blieb der Pfalz erhalten, auch
als er 1777 Bayern erbte und nach München über-
siedelte, wo er zu den gegen „Fremde" nun einmal
mißtrauischen Bayern kein Verhältnis gewinnen
konnte. Die phantasiegenährte, gemütvolle, dem
Bayern wesensverwandte Rokokokunst war im Er-
sterben und der rationalistische Geist der Karl Theo-
dor'schen Periode konnte ihr
den Übergang nicht erleichtern.
Dagegen legte Karl Theodor
durch die Berufung Pfälzer
Künstler, wie wir heute immer
klarer sehen, doch den Keim
für eine neue Blüte der Mün-
ebener Kunst.
Der Erbe des ganzen Wit-
telsbadier Hausbesitzes wird
schließlidi Maximilian IV. Jo-
seph, seit 1795 Herzog von
Zweibrüd^en, seit 1799 Kur-
fürst von Pfalz und Bayern.
Er hatte nicht die persönliche
künstlerische Begabung seines
Onkels, des Herzogs Chri-
stian IV. <1735-1775>, noch
die alles Vernünftige über-
steigende Bauleidenschaft sei-
nes Bruders, des Herzogs
Karl III. August <1775-1795>,
der das bald wieder zerstörte
Karlsberg bei Homburg er-
baute. Dieses künstlerische
Erbe der Ahnen tritt erst wie-
der bei seinem Sohne Ludwig I.
und dessen Enkel, Ludwig II.
zu Tag. Der persönlich be-
scheidene und gemütvolle Max fügte zwar, alte Tra-
ditione der Münchener Wittelsbacher aufnehmend,
der Mündiener Residenz einen neuen Trakt an, leider
mit rüdtsichtsloser Zerstörung alter Renaissance-
räume. Die neuen Räume, die sogenannten Hof*
gartenzimmer, setzen die rein französisch orientierten
Ausstattungsbestrebungen, die sein Bruder Karl Au-
gust verfolgte, auf bayerisdiem Boden fort. An selb-
ständigen Bauwerken geht das Hoftheater in dem sich
nun entwickelnden klassizistischen Geschmadi auf ihn
zurüdt. Von grundlegender Bedeutung wird die Grün-
dung der Akademie der Künste in München <1808>,
und ebenso wichtig war die Vereinigung der Galerien
von Zweibrüdcen, Mannheim, Düsseldorf und Schleiße
heim mit den Münchener Sammlungen. War diese
Neuorganisation durch den äußeren Zwang der Rettung
vor beutehungrigen Republikanern und Imperialisten
veranlaßt, so flössen doch schließlich mit einer gewissen
Innern Berechtigung die Schätze, die die zerstreuten
Wittelsbacher gesammelt, an der Wiege ihres Aus-
ganges wieder zusammen.
Die Ausmünzung dieser mehr konservierenden Tä-
tigkeit Max I. Josephs geschieht aber erst durch seinen
Kunstsdirein, Elfenbein mit Lapislazuli
gefertigt von Christoph Angermaier für Kurfürst Maximilian um 1630.
Erben Ludwig I. (1825-1848). Alles, was Wittels-
bacher oft in dirigierender Grundanlage auf dem Gebiet
der Kunst erstrebt, vereinigt sich nun in diesem Erben
61