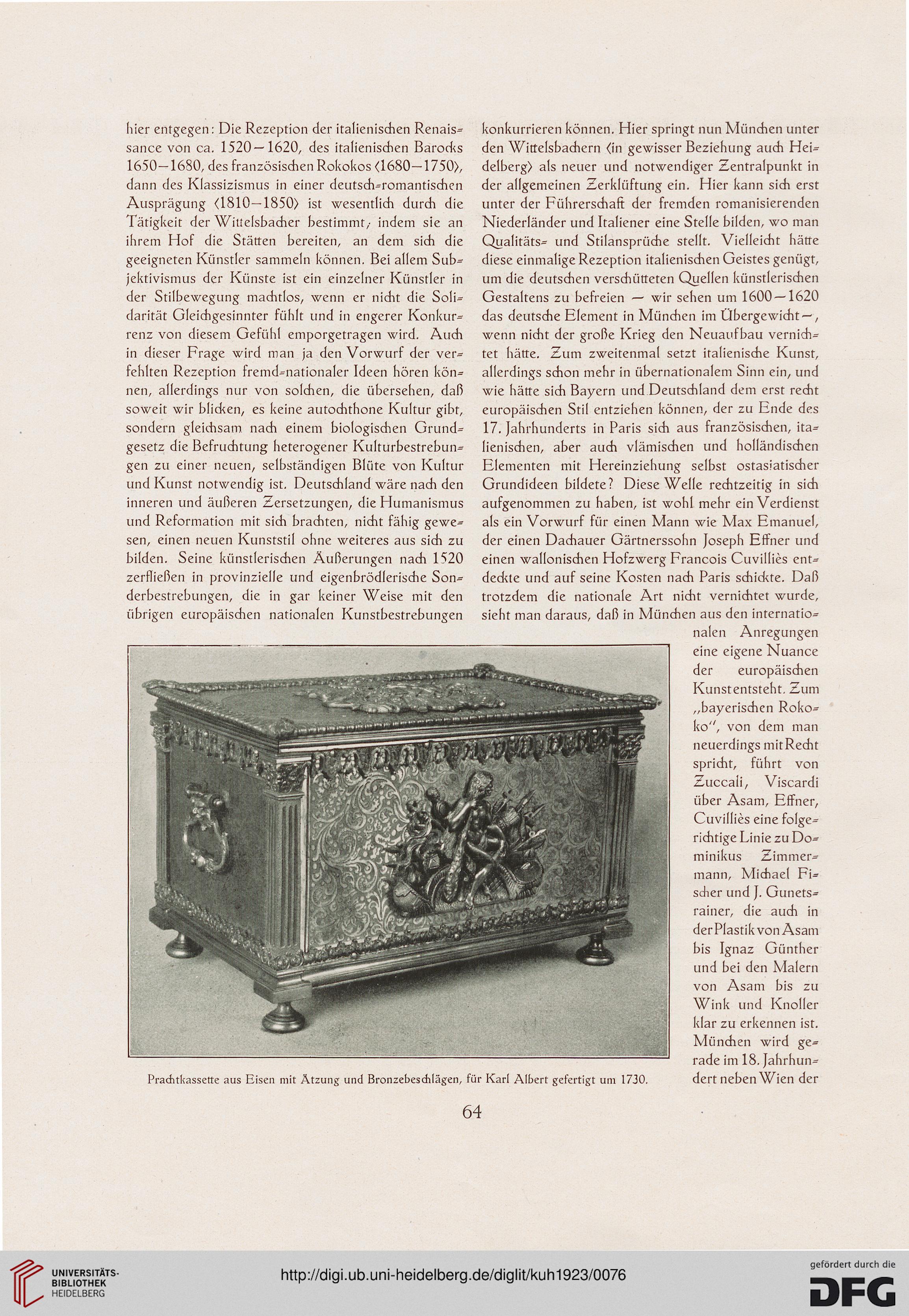hier entgegen: Die Rezeption der italienischen Renais*
sance von ca. 1520—1620, des italienischen Barocks
1650-1680, des französischen Rokokos (1680-1750),
dann des Klassizismus in einer deutsch=romantiscficn
Ausprägung (1810—1850) ist wesentlich durch die
Tätigkeit der Witlelsbacher bestimmt,- indem sie an
ihrem Hof die Stätten bereiten, an dem sich die
geeigneten Künstler sammeln können. Bei allem Sub*
jektivismus der Künste ist ein einzelner Künstler in
der Stilbewegung machtlos, wenn er nicht die Soli*
darität Gleichgesinnter fühlt und in engerer Konkur*
renz von diesem Gefühl emporgetragen wird. Auch
in dieser Frage wird man ja den Vorwurf der ver*
fehlten Rezeption fremd=nationaler Ideen hören kön*
nen, allerdings nur von solchen, die übersehen, daß
soweit wir blicken, es keine autochthone Kultur gibt,
sondern gleichsam nach einem biologischen Grund*
gesetz die Befruchtung heterogener Kulturbestrebun*
gen zu einer neuen, selbständigen Blüte von Kultur
und Kunst notwendig ist. Deutschland wäre nach den
inneren und äußeren Zersetzungen, die Humanismus
und Reformation mit sich brachten, nicht fähig gewe*
sen, einen neuen Kunststil ohne weiteres aus sich zu
bilden. Seine künstlerischen Äußerungen nach 1520
zerfließen in provinzielle und eigenbrödlerische Son*
derbestrebungen, die in gar keiner Weise mit den
übrigen europäischen nationalen Kunstbestrebungen
Prachtkassette aus Eisen mit Ätzung und Bronzebeschlägen, für Karl Albert gefertigt ur
konkurrieren können. Hier springt nun München unter
den Wittelsbachern (in gewisser Beziehung auch Hei*
delberg) als neuer und notwendiger Zentralpunkt in
der allgemeinen Zerklüftung ein. Hier kann sich erst
unter der Führerschaft der fremden romanisierenden
Niederländer und Italiener eine Stelle bilden, wo man
Qualitäts* und Stilansprüche stellt. Vielleicht hätte
diese einmalige Rezeption italienischen Geistes genügt,
um die deutschen verschütteten Quellen künstlerischen
Gestaltens zu befreien — wir sehen um 1600 — 1620
das deutsche Element in München im Übergewicht — ,
wenn nicht der große Krieg den Neuaufbau Vernich*
tet hätte. Zum zweitenmal setzt italienische Kunst,
allerdings schon mehr in übernationalem Sinn ein, und
wie hätte sich Bayern und Deutschland dem erst recht
europäischen Stil entziehen können, der zu Ende des
17. Jahrhunderts in Paris sich aus französischen, ita*
lienischen, aber auch vlämischen und holländischen
Elementen mit Hereinziehung selbst ostasiatischer
Grundideen bildete? Diese Welle rechtzeitig in sich
aufgenommen zu haben, ist wohl mehr ein Verdienst
als ein Vorwurf für einen Mann wie Max Emanuel,
der einen Dachauer Gärtnerssohn Joseph Effner und
einen wallonischen Hofzwerg Francois Cuvillies ent*
deckte und auf seine Kosten nach Paris schickte. Daß
trotzdem die nationale Art nicht vernichtet wurde,
sieht man daraus, daß in München aus den internatio*
nalen Anregungen
eine eigene Nuance
der europäischen
Kunstentsteht. Zum
„bayerischen Roko*
ko", von dem man
neuerdings mitRecht
spricht, führt von
Zuccali, Viscardi
über Asam, Effner,
Cuvillies eine folge*
richtige Linie zu Do*
minikus Zimmer*
mann, Michael Fi*
scher und J. Gunets*
rainer, die auch in
der Plastik von Asam
bis Ignaz Günther
und bei den Malern
von Asam bis zu
Wink und Knoller
klar zu erkennen ist.
München wird ge*
rade im 18. Jahrhun*
730. dert neben Wien der
64
sance von ca. 1520—1620, des italienischen Barocks
1650-1680, des französischen Rokokos (1680-1750),
dann des Klassizismus in einer deutsch=romantiscficn
Ausprägung (1810—1850) ist wesentlich durch die
Tätigkeit der Witlelsbacher bestimmt,- indem sie an
ihrem Hof die Stätten bereiten, an dem sich die
geeigneten Künstler sammeln können. Bei allem Sub*
jektivismus der Künste ist ein einzelner Künstler in
der Stilbewegung machtlos, wenn er nicht die Soli*
darität Gleichgesinnter fühlt und in engerer Konkur*
renz von diesem Gefühl emporgetragen wird. Auch
in dieser Frage wird man ja den Vorwurf der ver*
fehlten Rezeption fremd=nationaler Ideen hören kön*
nen, allerdings nur von solchen, die übersehen, daß
soweit wir blicken, es keine autochthone Kultur gibt,
sondern gleichsam nach einem biologischen Grund*
gesetz die Befruchtung heterogener Kulturbestrebun*
gen zu einer neuen, selbständigen Blüte von Kultur
und Kunst notwendig ist. Deutschland wäre nach den
inneren und äußeren Zersetzungen, die Humanismus
und Reformation mit sich brachten, nicht fähig gewe*
sen, einen neuen Kunststil ohne weiteres aus sich zu
bilden. Seine künstlerischen Äußerungen nach 1520
zerfließen in provinzielle und eigenbrödlerische Son*
derbestrebungen, die in gar keiner Weise mit den
übrigen europäischen nationalen Kunstbestrebungen
Prachtkassette aus Eisen mit Ätzung und Bronzebeschlägen, für Karl Albert gefertigt ur
konkurrieren können. Hier springt nun München unter
den Wittelsbachern (in gewisser Beziehung auch Hei*
delberg) als neuer und notwendiger Zentralpunkt in
der allgemeinen Zerklüftung ein. Hier kann sich erst
unter der Führerschaft der fremden romanisierenden
Niederländer und Italiener eine Stelle bilden, wo man
Qualitäts* und Stilansprüche stellt. Vielleicht hätte
diese einmalige Rezeption italienischen Geistes genügt,
um die deutschen verschütteten Quellen künstlerischen
Gestaltens zu befreien — wir sehen um 1600 — 1620
das deutsche Element in München im Übergewicht — ,
wenn nicht der große Krieg den Neuaufbau Vernich*
tet hätte. Zum zweitenmal setzt italienische Kunst,
allerdings schon mehr in übernationalem Sinn ein, und
wie hätte sich Bayern und Deutschland dem erst recht
europäischen Stil entziehen können, der zu Ende des
17. Jahrhunderts in Paris sich aus französischen, ita*
lienischen, aber auch vlämischen und holländischen
Elementen mit Hereinziehung selbst ostasiatischer
Grundideen bildete? Diese Welle rechtzeitig in sich
aufgenommen zu haben, ist wohl mehr ein Verdienst
als ein Vorwurf für einen Mann wie Max Emanuel,
der einen Dachauer Gärtnerssohn Joseph Effner und
einen wallonischen Hofzwerg Francois Cuvillies ent*
deckte und auf seine Kosten nach Paris schickte. Daß
trotzdem die nationale Art nicht vernichtet wurde,
sieht man daraus, daß in München aus den internatio*
nalen Anregungen
eine eigene Nuance
der europäischen
Kunstentsteht. Zum
„bayerischen Roko*
ko", von dem man
neuerdings mitRecht
spricht, führt von
Zuccali, Viscardi
über Asam, Effner,
Cuvillies eine folge*
richtige Linie zu Do*
minikus Zimmer*
mann, Michael Fi*
scher und J. Gunets*
rainer, die auch in
der Plastik von Asam
bis Ignaz Günther
und bei den Malern
von Asam bis zu
Wink und Knoller
klar zu erkennen ist.
München wird ge*
rade im 18. Jahrhun*
730. dert neben Wien der
64