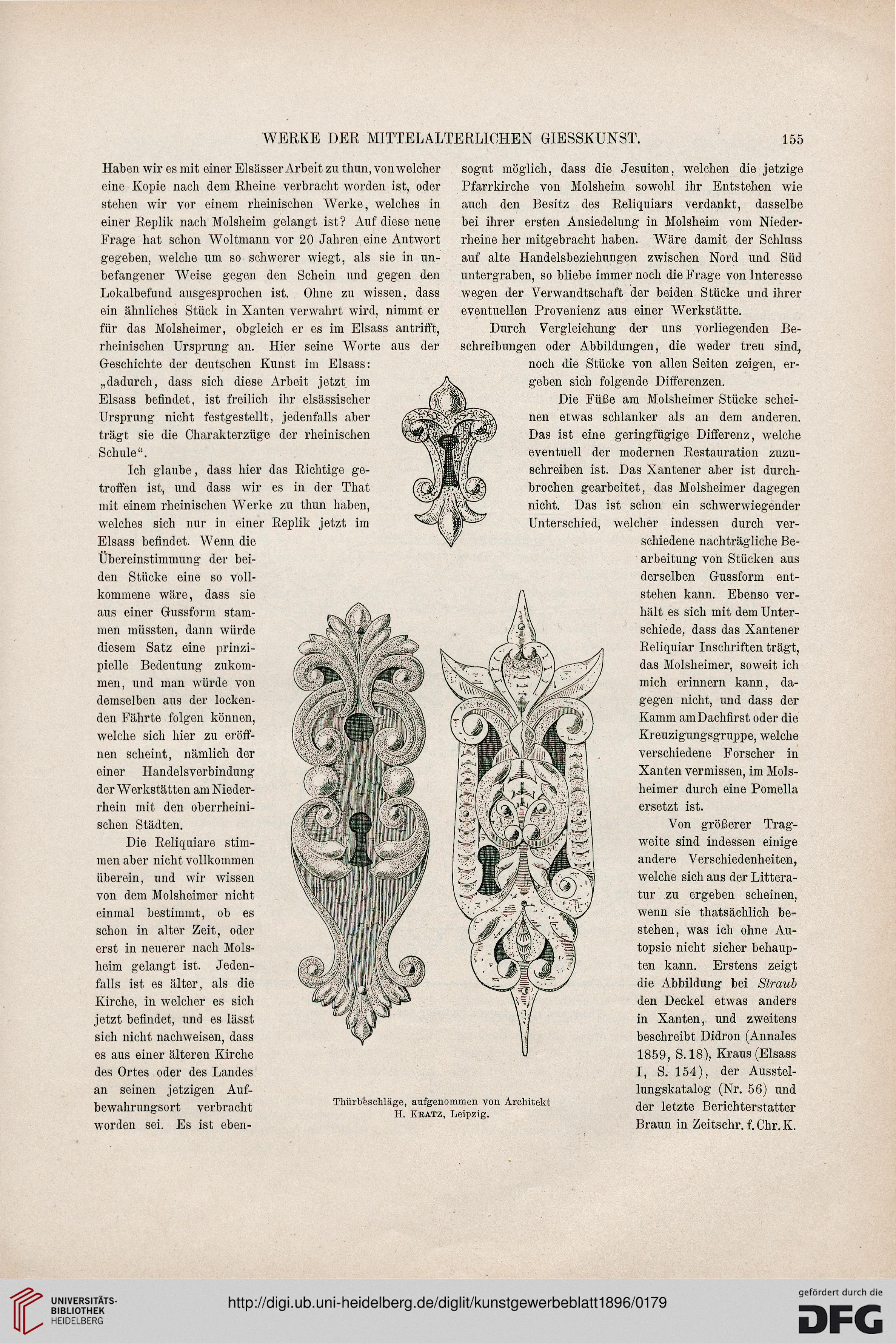WERKE DER MITTELALTERLICHEN GIESSKUNST.
155
Haben wir es mit einer Elsässer Arbeit zu thun, von welcher
eine Kopie nach dem Eheine verbracht worden ist, oder
stehen wir vor einem rheinischen Werke, welches in
einer Replik nach Molsheim gelangt ist? Auf diese neue
Frage hat schon Woltmann vor 20 Jahren eine Antwort
gegeben, welche um so schwerer wiegt, als sie in un-
befangener Weise gegen den Schein und gegen den
Lokalbefund ausgesprochen ist. Ohne zu wissen, dass
ein ähnliches Stück in Xanten verwahrt wird, nimmt er
für das Molsheimer, obgleich er es im Elsass antrifft,
rheinischen Ursprung an. Hier seine Worte aus der
Geschichte der deutschen Kunst im Elsass:
„dadurch, dass sich diese Arbeit jetzt im
Elsass befindet, ist freilich ihr elsässischer
Ursprung nicht festgestellt, jedenfalls aber
trägt sie die Charakterzüge der rheinischen
Schule".
Ich glaube, dass hier das Richtige ge-
troffen ist, und dass wir es in der Thal.
mit einem rheinischen Werke zu thun haben,
welches sich nur in einer Replik jetzt im
Elsass befindet. Wenn die
Übereinstimmung der bei-
den Stücke eine so voll-
kommene wäre, dass sie
aus einer Gussform stam-
men müssten, dann würde
diesem Satz eine prinzi-
pielle Bedeutung zukom-
men, und man würde von
demselben aus der locken-
den Fährte folgen können,
welche sich hier zu eröff-
nen scheint, nämlich der
einer Handelsverbindung
der Werkstätten am Nieder-
rhein mit den oberrheini-
schen Städten.
Die Reliquiare stim-
men aber nicht vollkommen
über ein, und wir wissen
von dem Molsheimer nicht
einmal bestimmt, ob es
schon in alter Zeit, oder
erst in neuerer nach Mols-
heim gelangt ist. Jeden-
falls ist es älter, als die
Kirche, in welcher es sich
jetzt befindet, und es lässt
sicli nicht nachweisen, dass
es aus einer älteren Kirche
des Ortes oder des Landes
an seinen jetzigen Auf-
bewahrungsort verbracht
worden sei. Es ist eben-
Thürteschläge, aufgenommen von Architekt
H. Kkatz, Leipzig.
sogut möglich, dass die Jesuiten, welchen die jetzige
Pfarrkirche von Molsheim sowohl ihr Entstehen wie
auch den Besitz des Reliquiars verdankt, dasselbe
bei ihrer ersten Ansiedelung in Molsheim vom Nieder-
rheine her mitgebracht haben. Wäre damit der Schluss
auf alte Handelsbeziehungen zwischen Nord und Süd
untergraben, so bliebe immer noch die Frage von Interesse
wegen der Verwandtschaft der beiden Stücke und ihrer
eventuellen Provenienz aus einer Werkstätte.
Durch Vergleichung der uns vorliegenden Be-
schreibungen oder Abbildungen, die weder treu sind,
noch die Stücke von allen Seiten zeigen, er-
geben sich folgende Differenzen.
Die Füße am Molsheimer Stücke schei-
nen etwas schlanker als an dem anderen.
Das ist eine geringfügige Differenz, welche
eventuell der modernen Restauration zuzu-
schreiben ist. Das Xantener aber ist durch-
brochen gearbeitet, das Molsheimer dagegen
nicht. Das ist schon ein schwerwiegender
Unterschied, welcher indessen durch ver-
schiedene nachträgliche Be-
arbeitung von Stücken aus
derselben Gussform ent-
stehen kann. Ebenso ver-
hält es sich mit dem Unter-
schiede, dass das Xantener
Reliquiar Inschriften trägt,
das Molsheimer, soweit ich
mich erinnern kann, da-
gegen nicht, und dass der
Kamm am Dachfirst oder die
Kreuzigungsgruppe, welche
verschiedene Forscher in
Xanten vermissen, im Mols-
heimer durch eine Pomella
ersetzt ist.
Von größerer Trag-
weite sind indessen einige
andere Verschiedenheiten,
welche sich aus der Littera-
tur zu ergeben scheinen,
wenn sie thatsächlich be-
stehen, was ich ohne Au-
topsie nicht sicher behaup-
ten kann. Erstens zeigt
die Abbildung bei Straub
den Deckel etwas anders
in Xanten, und zweitens
beschreibt Didron (Annales
1859, S.18), Kraus (Elsass
I, S. 154), der Ausstel-
lungskatalog (Nr. 56) und
der letzte Berichterstatter
Braun in Zeitschr. f. Chr. K.
155
Haben wir es mit einer Elsässer Arbeit zu thun, von welcher
eine Kopie nach dem Eheine verbracht worden ist, oder
stehen wir vor einem rheinischen Werke, welches in
einer Replik nach Molsheim gelangt ist? Auf diese neue
Frage hat schon Woltmann vor 20 Jahren eine Antwort
gegeben, welche um so schwerer wiegt, als sie in un-
befangener Weise gegen den Schein und gegen den
Lokalbefund ausgesprochen ist. Ohne zu wissen, dass
ein ähnliches Stück in Xanten verwahrt wird, nimmt er
für das Molsheimer, obgleich er es im Elsass antrifft,
rheinischen Ursprung an. Hier seine Worte aus der
Geschichte der deutschen Kunst im Elsass:
„dadurch, dass sich diese Arbeit jetzt im
Elsass befindet, ist freilich ihr elsässischer
Ursprung nicht festgestellt, jedenfalls aber
trägt sie die Charakterzüge der rheinischen
Schule".
Ich glaube, dass hier das Richtige ge-
troffen ist, und dass wir es in der Thal.
mit einem rheinischen Werke zu thun haben,
welches sich nur in einer Replik jetzt im
Elsass befindet. Wenn die
Übereinstimmung der bei-
den Stücke eine so voll-
kommene wäre, dass sie
aus einer Gussform stam-
men müssten, dann würde
diesem Satz eine prinzi-
pielle Bedeutung zukom-
men, und man würde von
demselben aus der locken-
den Fährte folgen können,
welche sich hier zu eröff-
nen scheint, nämlich der
einer Handelsverbindung
der Werkstätten am Nieder-
rhein mit den oberrheini-
schen Städten.
Die Reliquiare stim-
men aber nicht vollkommen
über ein, und wir wissen
von dem Molsheimer nicht
einmal bestimmt, ob es
schon in alter Zeit, oder
erst in neuerer nach Mols-
heim gelangt ist. Jeden-
falls ist es älter, als die
Kirche, in welcher es sich
jetzt befindet, und es lässt
sicli nicht nachweisen, dass
es aus einer älteren Kirche
des Ortes oder des Landes
an seinen jetzigen Auf-
bewahrungsort verbracht
worden sei. Es ist eben-
Thürteschläge, aufgenommen von Architekt
H. Kkatz, Leipzig.
sogut möglich, dass die Jesuiten, welchen die jetzige
Pfarrkirche von Molsheim sowohl ihr Entstehen wie
auch den Besitz des Reliquiars verdankt, dasselbe
bei ihrer ersten Ansiedelung in Molsheim vom Nieder-
rheine her mitgebracht haben. Wäre damit der Schluss
auf alte Handelsbeziehungen zwischen Nord und Süd
untergraben, so bliebe immer noch die Frage von Interesse
wegen der Verwandtschaft der beiden Stücke und ihrer
eventuellen Provenienz aus einer Werkstätte.
Durch Vergleichung der uns vorliegenden Be-
schreibungen oder Abbildungen, die weder treu sind,
noch die Stücke von allen Seiten zeigen, er-
geben sich folgende Differenzen.
Die Füße am Molsheimer Stücke schei-
nen etwas schlanker als an dem anderen.
Das ist eine geringfügige Differenz, welche
eventuell der modernen Restauration zuzu-
schreiben ist. Das Xantener aber ist durch-
brochen gearbeitet, das Molsheimer dagegen
nicht. Das ist schon ein schwerwiegender
Unterschied, welcher indessen durch ver-
schiedene nachträgliche Be-
arbeitung von Stücken aus
derselben Gussform ent-
stehen kann. Ebenso ver-
hält es sich mit dem Unter-
schiede, dass das Xantener
Reliquiar Inschriften trägt,
das Molsheimer, soweit ich
mich erinnern kann, da-
gegen nicht, und dass der
Kamm am Dachfirst oder die
Kreuzigungsgruppe, welche
verschiedene Forscher in
Xanten vermissen, im Mols-
heimer durch eine Pomella
ersetzt ist.
Von größerer Trag-
weite sind indessen einige
andere Verschiedenheiten,
welche sich aus der Littera-
tur zu ergeben scheinen,
wenn sie thatsächlich be-
stehen, was ich ohne Au-
topsie nicht sicher behaup-
ten kann. Erstens zeigt
die Abbildung bei Straub
den Deckel etwas anders
in Xanten, und zweitens
beschreibt Didron (Annales
1859, S.18), Kraus (Elsass
I, S. 154), der Ausstel-
lungskatalog (Nr. 56) und
der letzte Berichterstatter
Braun in Zeitschr. f. Chr. K.