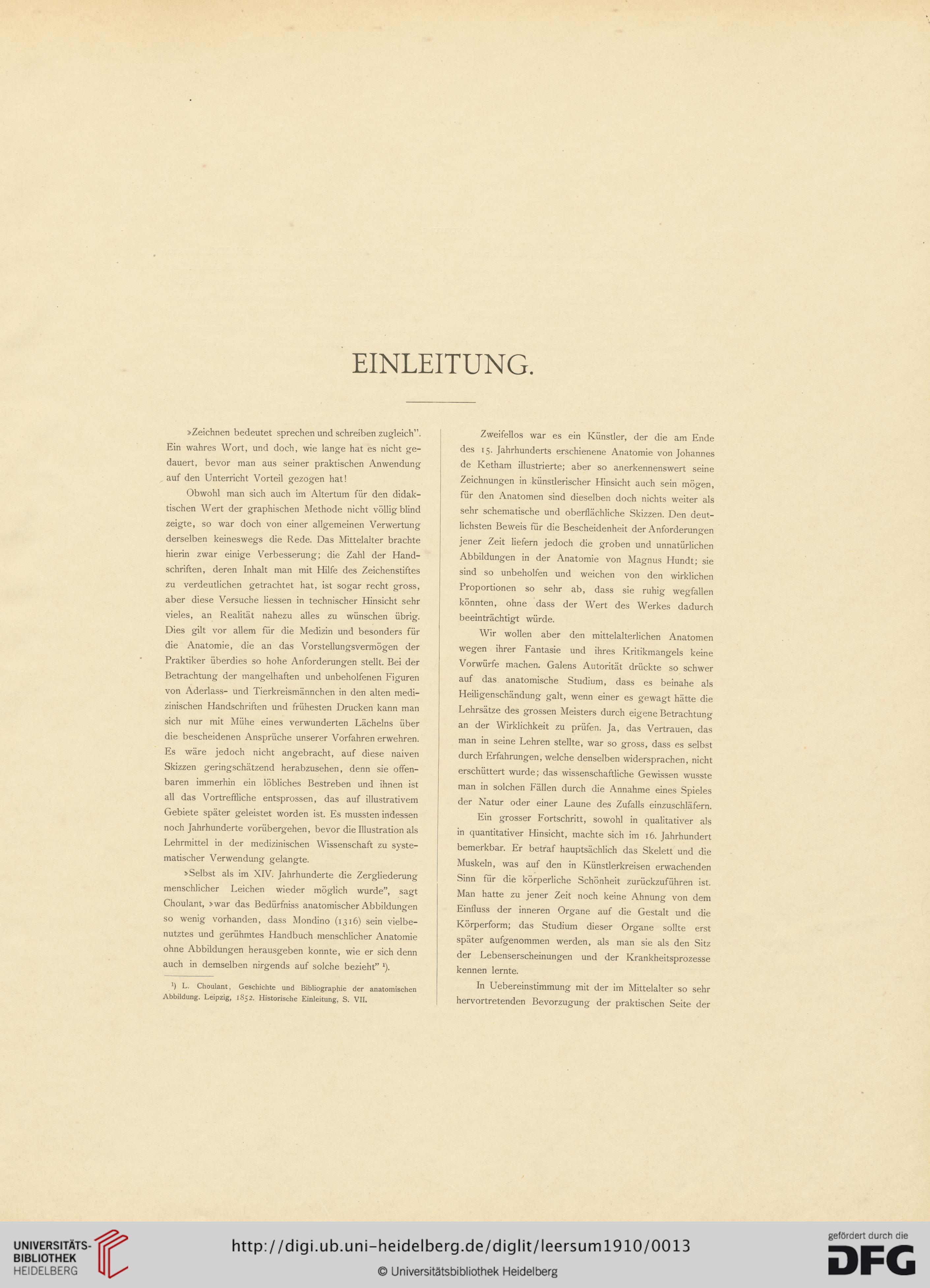EINLEITUNG
»Zeichnen bedeutet sprechen und schreiben zugleich”.
Ein wahres Wort, und doch, wie lange hat es nicht ge-
dauert, bevor man aus seiner praktischen Anwendung
auf den Unterricht Vorteil gezogen hat!
Obwohl man sich auch im Altertum für den didak-
tischen Wert der graphischen Methode nicht völligblind
zeigte, so war doch von einer allgemeinen Verwertung
derselben keineswegs die Rede. Das Mittelalter brachte
hierin zwar einige Verbesserung; die Zahl der Hand-
schriften, deren Inhalt man mit Hilfe des Zeichenstiftes
zu verdeutlichen getrachtet hat, ist sogar recht gross,
aber diese Versuche liessen in technischer Hinsicht sehr
vieles, an Realität nahezu alles zu wünschen übrig.
Dies gilt vor allem für die Medizin und besonders für
die Anatomie, die an das Vorstellungsvermögen der
Praktiker überdies so hohe Anforderungen stellt. Bei der
Betrachtung der mangelhaften und unbeholfenen Figuren
von Aderlass- und Tierkreismännchen in den alten medi-
zinischen Handschriften und frühesten Drucken kann man
sich nur mit Mühe eines verwunderten Lächelns über
die bescheidenen Ansprüche unserer Vorfahren erwehren.
Es wäre jedoch nicht angebracht, auf diese naiven
Skizzen geringschätzend herabzusehen, denn sie offen-
baren immerhin ein löbliches Bestreben und ihnen ist
all das Vortreffliche entsprossen, das auf illustrativem
Gebiete später geleistet worden ist. Es mussten indessen
noch Jahrhunderte vorübergehen, bevor die Illustration als
Lehrmittel in der medizinischen Wissenschaft zu syste-
matischer Verwendung gelangte.
»Selbst als im XIV. Jahrhunderte die Zergliederung
menschlicher Leichen wieder möglich wurde”, sagt
Choulant, »war das Bedürfniss anatomischer Abbildungen
so wenig vorhanden, dass Mondino (1316) sein vielbe-
nutztes und gerühmtes Handbuch menschlicher Anatomie
ohne Abbildungen herausgeben konnte, wie er sich denn
auch in demselben nirgends auf solche bezieht” x).
J) L. Choulant, Geschichte und Bibliographie der anatomischen
Abbildung. Leipzig, 1852. Historische Einleitung, S. VII.
Zweifellos war es ein Kiinstler, der die am Ende
des 15. Jahrhunderts erschienene Anatomie von Johannes
de Ketham illustrierte; aber so anerkennenswert seine
Zeichnungen in künstlerischer Hinsicht auch sein mögen,
für den Anatomen sind dieselben doch nichts weiter als
sehr schematische und oberflächliche Skizzen. Den deut-
lichsten Beweis für die Bescheidenheit der Anforderungen
jener Zeit liefern jedoch die groben und unnatürlichen
Abbildungen in der Anatomie von Magnus Hundt; sie
sind so unbeholfen und weichen von den wirklichen
Proportionen so sehr ab, dass sie ruhig wegfallen
könnten, ohne dass der Wert des Werkes dadurch
beeinträchtigt würde.
Wir wollen aber den mittelalterlichen Anatomen
wegen ihrer Fantasie und ihres Kritikmangels keine
Vorwürfe machen. Galens Autorität drückte so schwer
auf das anatomische Studium, dass es beinahe als
Heiligenschändung galt, wenn einer es gewagt hätte die
Lehrsätze des grossen Meisters durch eigene Betrachtung
an der Wirklichkeit zu prüfen. Ja, das Vertrauen, das
man in seine Lehren stellte, war so gross, dass es selbst
durch Erfahrungen, welche denselben widersprachen, nicht
erschüttert wurde; das wissenschaftliche Gewissen wusste
man in solchen Fällen durch die Annahme eines Spieles
der Natur oder einer Laune des Zufalls einzuschläfern.
Ein grosser Fortschritt, sowohl in qualitativer als
in quantitativer Hinsicht, machte sich im 16. Jahrhundert
bemerkbar. Er betraf hauptsächlich das Skelett und die
Muskeln, was auf den in Künstlerkreisen erwachenden
Sinn für die körperliche Schönheit zurückzuführen ist.
Man hatte zu jener Zeit noch keine Ahnung von dem
Einfluss der inneren Organe auf die Gestalt und die
Körperform; das Studium dieser Organe sollte erst
später aufgenommen werden, als man sie als den Sitz
der Lebenserscheinungen und der Krankheitsprozesse
kennen lernte.
In Uebereinstimmung mit der im Mittelalter so sehr
hervortretenden Bevorzugung der praktischen Seite der
»Zeichnen bedeutet sprechen und schreiben zugleich”.
Ein wahres Wort, und doch, wie lange hat es nicht ge-
dauert, bevor man aus seiner praktischen Anwendung
auf den Unterricht Vorteil gezogen hat!
Obwohl man sich auch im Altertum für den didak-
tischen Wert der graphischen Methode nicht völligblind
zeigte, so war doch von einer allgemeinen Verwertung
derselben keineswegs die Rede. Das Mittelalter brachte
hierin zwar einige Verbesserung; die Zahl der Hand-
schriften, deren Inhalt man mit Hilfe des Zeichenstiftes
zu verdeutlichen getrachtet hat, ist sogar recht gross,
aber diese Versuche liessen in technischer Hinsicht sehr
vieles, an Realität nahezu alles zu wünschen übrig.
Dies gilt vor allem für die Medizin und besonders für
die Anatomie, die an das Vorstellungsvermögen der
Praktiker überdies so hohe Anforderungen stellt. Bei der
Betrachtung der mangelhaften und unbeholfenen Figuren
von Aderlass- und Tierkreismännchen in den alten medi-
zinischen Handschriften und frühesten Drucken kann man
sich nur mit Mühe eines verwunderten Lächelns über
die bescheidenen Ansprüche unserer Vorfahren erwehren.
Es wäre jedoch nicht angebracht, auf diese naiven
Skizzen geringschätzend herabzusehen, denn sie offen-
baren immerhin ein löbliches Bestreben und ihnen ist
all das Vortreffliche entsprossen, das auf illustrativem
Gebiete später geleistet worden ist. Es mussten indessen
noch Jahrhunderte vorübergehen, bevor die Illustration als
Lehrmittel in der medizinischen Wissenschaft zu syste-
matischer Verwendung gelangte.
»Selbst als im XIV. Jahrhunderte die Zergliederung
menschlicher Leichen wieder möglich wurde”, sagt
Choulant, »war das Bedürfniss anatomischer Abbildungen
so wenig vorhanden, dass Mondino (1316) sein vielbe-
nutztes und gerühmtes Handbuch menschlicher Anatomie
ohne Abbildungen herausgeben konnte, wie er sich denn
auch in demselben nirgends auf solche bezieht” x).
J) L. Choulant, Geschichte und Bibliographie der anatomischen
Abbildung. Leipzig, 1852. Historische Einleitung, S. VII.
Zweifellos war es ein Kiinstler, der die am Ende
des 15. Jahrhunderts erschienene Anatomie von Johannes
de Ketham illustrierte; aber so anerkennenswert seine
Zeichnungen in künstlerischer Hinsicht auch sein mögen,
für den Anatomen sind dieselben doch nichts weiter als
sehr schematische und oberflächliche Skizzen. Den deut-
lichsten Beweis für die Bescheidenheit der Anforderungen
jener Zeit liefern jedoch die groben und unnatürlichen
Abbildungen in der Anatomie von Magnus Hundt; sie
sind so unbeholfen und weichen von den wirklichen
Proportionen so sehr ab, dass sie ruhig wegfallen
könnten, ohne dass der Wert des Werkes dadurch
beeinträchtigt würde.
Wir wollen aber den mittelalterlichen Anatomen
wegen ihrer Fantasie und ihres Kritikmangels keine
Vorwürfe machen. Galens Autorität drückte so schwer
auf das anatomische Studium, dass es beinahe als
Heiligenschändung galt, wenn einer es gewagt hätte die
Lehrsätze des grossen Meisters durch eigene Betrachtung
an der Wirklichkeit zu prüfen. Ja, das Vertrauen, das
man in seine Lehren stellte, war so gross, dass es selbst
durch Erfahrungen, welche denselben widersprachen, nicht
erschüttert wurde; das wissenschaftliche Gewissen wusste
man in solchen Fällen durch die Annahme eines Spieles
der Natur oder einer Laune des Zufalls einzuschläfern.
Ein grosser Fortschritt, sowohl in qualitativer als
in quantitativer Hinsicht, machte sich im 16. Jahrhundert
bemerkbar. Er betraf hauptsächlich das Skelett und die
Muskeln, was auf den in Künstlerkreisen erwachenden
Sinn für die körperliche Schönheit zurückzuführen ist.
Man hatte zu jener Zeit noch keine Ahnung von dem
Einfluss der inneren Organe auf die Gestalt und die
Körperform; das Studium dieser Organe sollte erst
später aufgenommen werden, als man sie als den Sitz
der Lebenserscheinungen und der Krankheitsprozesse
kennen lernte.
In Uebereinstimmung mit der im Mittelalter so sehr
hervortretenden Bevorzugung der praktischen Seite der