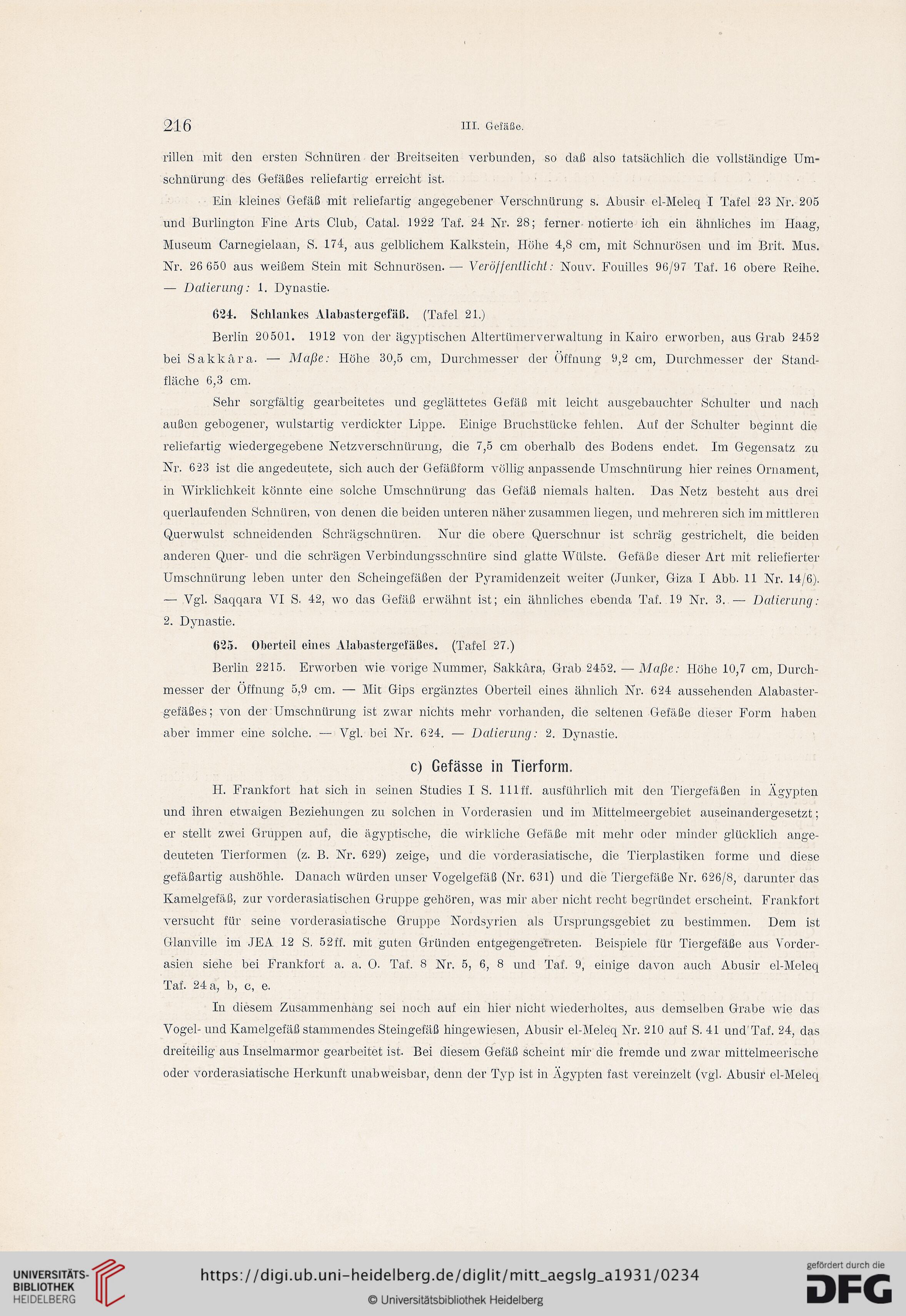216
III. Gefäße.
rillen mit den ersten Schnüren der Breitseiten verbunden, so daß also tatsächlich die vollständige Um-
schnürung des Gefäßes reliefartig erreicht ist.
Ein kleines Gefäß mit reliefartig angegebener Verschnürung s. Abusir el-Meleq I Tafel 23 Nr. 205
und Burlington Fine Arts Club, Catal. 1922 Taf. 24 Nr. 28; ferner notierte ich ein ähnliches im Haag,
Museum Carnegielaan, S. 174, aus gelblichem Kalkstein, Höhe 4,8 cm, mit Schnurösen und im Brit. Mus.
Nr. 26 650 aus weißem Stein mit Schnurösen. — V eroffentlieht: Nouv. Fouilles 96/97 Taf. 16 obere Reihe.
— Datierung: 1. Dynastie.
624. Schlankes Alabastergefäß. (Tafel 21.)
Berlin 20501. 1912 von der ägyptischen Altertümerverwaltung in Kairo erworben, aus Grab 2452
bei Sakkära. — Maße: Höhe 30,5 cm, Durchmesser der Öffnung 9,2 cm, Durchmesser der Stand-
fläche 6,3 cm.
Sehr sorgfältig gearbeitetes und geglättetes Gefäß mit leicht ausgebauchter Schulter und nach
außen gebogener, wulstartig verdickter Lippe. Einige Bruchstücke fehlen. Auf der Schulter beginnt die
reliefartig wiedergegebene Netzverschnürung, die 7,5 cm oberhalb des Bodens endet. Im Gegensatz zu
Nr. 623 ist die angedeutete, sich auch der Gefäßform völlig anpassende Umschnürung hier reines Ornament,
in Wirklichkeit könnte eine solche Umschnürung das Gefäß niemals halten. Das Netz besteht aus drei
querlaufenden Schnüren, von denen die beiden unteren näher zusammen liegen, und mehreren sich im mittleren
Querwulst schneidenden Schrägschnüren. Nur die obere Querschnur ist schräg gestrichelt, die beiden
anderen Quer- und die schrägen Verbindungsschnüre sind glatte Wülste. Gefäße dieser Art mit reliefierter
Umschnürung leben unter den Scheingefäßen der Pyramidenzeit weiter (Junker, Giza I Abb. 11 Nr. 14/6).
— Vgl. Saqqara VI S. 42, wo das Gefäß erwähnt ist; ein ähnliches ebenda Taf. 19 Nr. 3. — Datierung:
2. Dynastie.
625. Oberteil eines Alabastergefäßes. (Tafel 27.)
Berlin 2215. Erworben wie vorige Nummer, Sakkära, Grab 2452. — Maße: Höhe 10,7 cm, Durch-
messer der Öffnung 5,9 cm. — Mit Gips ergänztes Oberteil eines ähnlich Nr. 624 aussehenden Alabaster-
gefäßes; von der Umschnürung ist zwar nichts mehr vorhanden, die seltenen Gefäße dieser Form haben
aber immer eine solche. •— Vgl. bei Nr. 624. — Datierung: 2. Dynastie.
c) Gefässe in Tierform.
H. Frankfort hat sich in seinen Stadies I S. lllff. ausführlich mit den Tiergefäßen in Ägypten
und ihren etwaigen Beziehungen zu solchen in Vorderasien und im Mittelmeergebiet auseinandergesetzt;
er stellt zwei Gruppen auf, die ägyptische, die wirkliche Gefäße mit mehr oder minder glücklich ange-
deuteten Tierformen (z. B. Nr. 629) zeige, und die vorderasiatische, die Tierplastiken forme und diese
gefäßartig aushöhle. Danach würden unser Vogelgefäß (Nr. 631) und die Tiergefäße Nr. 626/8, darunter das
Kamelgefäß, zur vorderasiatischen Gruppe gehören, was mir aber nicht recht begründet erscheint. Frankfort
versucht für seine vorderasiatische Gruppe Nordsyrien als Ursprungsgebiet zu bestimmen. Dem ist
Glanville im JEA 12 S. 52ff. mit guten Gründen entgegengetreten. Beispiele für Tiergefäße aus Vorder-
asien siehe bei Frankfort a. a. 0. Taf. 8 Nr. 5, 6, 8 und Taf. 9, einige davon auch Abusir el-Meleq
Taf. 24 a, b, c, e.
In diesem Zusammenhang sei noch auf ein hier nicht wiederholtes, aus demselben Grabe wie das
Vogel- und Kamelgefäß stammendes Steingefäß hingewiesen, Abusir el-Meleq Nr. 210 auf S. 41 und'Taf. 24, das
dreiteilig aus Inselmarmor gearbeitet ist. Bei diesem Gefäß scheint mir die fremde und zwar mittelmeerische
oder vorderasiatische Herkunft unabweisbar, denn der Typ ist in Ägypten fast vereinzelt (vgl. Abusir el-Meleq
III. Gefäße.
rillen mit den ersten Schnüren der Breitseiten verbunden, so daß also tatsächlich die vollständige Um-
schnürung des Gefäßes reliefartig erreicht ist.
Ein kleines Gefäß mit reliefartig angegebener Verschnürung s. Abusir el-Meleq I Tafel 23 Nr. 205
und Burlington Fine Arts Club, Catal. 1922 Taf. 24 Nr. 28; ferner notierte ich ein ähnliches im Haag,
Museum Carnegielaan, S. 174, aus gelblichem Kalkstein, Höhe 4,8 cm, mit Schnurösen und im Brit. Mus.
Nr. 26 650 aus weißem Stein mit Schnurösen. — V eroffentlieht: Nouv. Fouilles 96/97 Taf. 16 obere Reihe.
— Datierung: 1. Dynastie.
624. Schlankes Alabastergefäß. (Tafel 21.)
Berlin 20501. 1912 von der ägyptischen Altertümerverwaltung in Kairo erworben, aus Grab 2452
bei Sakkära. — Maße: Höhe 30,5 cm, Durchmesser der Öffnung 9,2 cm, Durchmesser der Stand-
fläche 6,3 cm.
Sehr sorgfältig gearbeitetes und geglättetes Gefäß mit leicht ausgebauchter Schulter und nach
außen gebogener, wulstartig verdickter Lippe. Einige Bruchstücke fehlen. Auf der Schulter beginnt die
reliefartig wiedergegebene Netzverschnürung, die 7,5 cm oberhalb des Bodens endet. Im Gegensatz zu
Nr. 623 ist die angedeutete, sich auch der Gefäßform völlig anpassende Umschnürung hier reines Ornament,
in Wirklichkeit könnte eine solche Umschnürung das Gefäß niemals halten. Das Netz besteht aus drei
querlaufenden Schnüren, von denen die beiden unteren näher zusammen liegen, und mehreren sich im mittleren
Querwulst schneidenden Schrägschnüren. Nur die obere Querschnur ist schräg gestrichelt, die beiden
anderen Quer- und die schrägen Verbindungsschnüre sind glatte Wülste. Gefäße dieser Art mit reliefierter
Umschnürung leben unter den Scheingefäßen der Pyramidenzeit weiter (Junker, Giza I Abb. 11 Nr. 14/6).
— Vgl. Saqqara VI S. 42, wo das Gefäß erwähnt ist; ein ähnliches ebenda Taf. 19 Nr. 3. — Datierung:
2. Dynastie.
625. Oberteil eines Alabastergefäßes. (Tafel 27.)
Berlin 2215. Erworben wie vorige Nummer, Sakkära, Grab 2452. — Maße: Höhe 10,7 cm, Durch-
messer der Öffnung 5,9 cm. — Mit Gips ergänztes Oberteil eines ähnlich Nr. 624 aussehenden Alabaster-
gefäßes; von der Umschnürung ist zwar nichts mehr vorhanden, die seltenen Gefäße dieser Form haben
aber immer eine solche. •— Vgl. bei Nr. 624. — Datierung: 2. Dynastie.
c) Gefässe in Tierform.
H. Frankfort hat sich in seinen Stadies I S. lllff. ausführlich mit den Tiergefäßen in Ägypten
und ihren etwaigen Beziehungen zu solchen in Vorderasien und im Mittelmeergebiet auseinandergesetzt;
er stellt zwei Gruppen auf, die ägyptische, die wirkliche Gefäße mit mehr oder minder glücklich ange-
deuteten Tierformen (z. B. Nr. 629) zeige, und die vorderasiatische, die Tierplastiken forme und diese
gefäßartig aushöhle. Danach würden unser Vogelgefäß (Nr. 631) und die Tiergefäße Nr. 626/8, darunter das
Kamelgefäß, zur vorderasiatischen Gruppe gehören, was mir aber nicht recht begründet erscheint. Frankfort
versucht für seine vorderasiatische Gruppe Nordsyrien als Ursprungsgebiet zu bestimmen. Dem ist
Glanville im JEA 12 S. 52ff. mit guten Gründen entgegengetreten. Beispiele für Tiergefäße aus Vorder-
asien siehe bei Frankfort a. a. 0. Taf. 8 Nr. 5, 6, 8 und Taf. 9, einige davon auch Abusir el-Meleq
Taf. 24 a, b, c, e.
In diesem Zusammenhang sei noch auf ein hier nicht wiederholtes, aus demselben Grabe wie das
Vogel- und Kamelgefäß stammendes Steingefäß hingewiesen, Abusir el-Meleq Nr. 210 auf S. 41 und'Taf. 24, das
dreiteilig aus Inselmarmor gearbeitet ist. Bei diesem Gefäß scheint mir die fremde und zwar mittelmeerische
oder vorderasiatische Herkunft unabweisbar, denn der Typ ist in Ägypten fast vereinzelt (vgl. Abusir el-Meleq