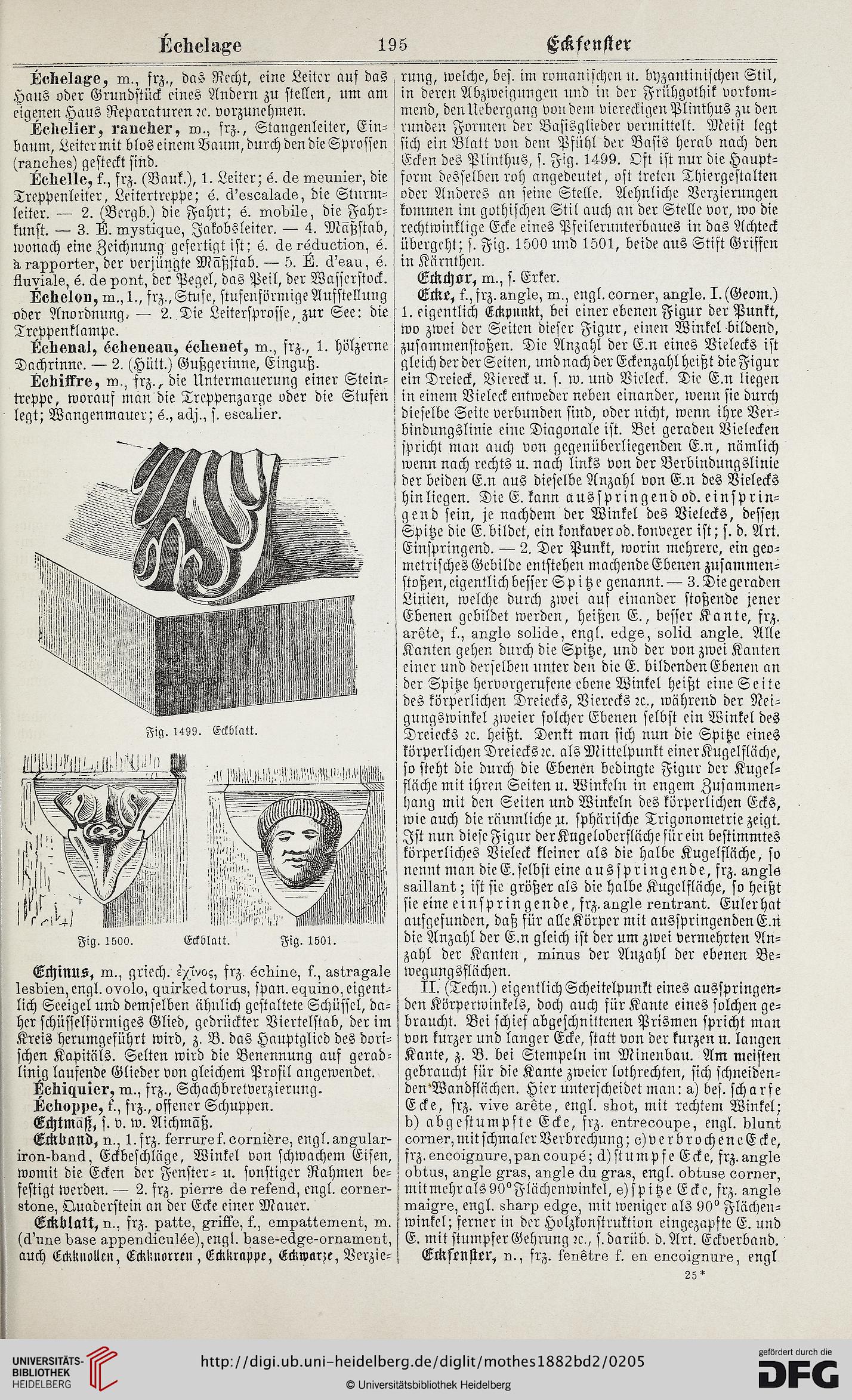195 Eckfenster
m., frz., das Recht, eine Leiter auf das
Haus oder Grundstück eines Andern zu stellen, um am
eigenen Haus Reparaturen re. vorzunehmen.
Lellvlitzr, imueder, m., frz., Stangenleiter, Ein-
baum, Leitermit blos einem Baum, durch den die Sprossen
(ranoliss) gesteckt sind.
Lobelie, k., frz. (Bauk.), 1. Leiter; s. äs meunisr, die
Treppenleiter, Leitertreppe; s. ä'sssalaäs, die Sturm-
leiter. — 2. (Bergb.) die Fahrt; s. mobils, die Fahr-
kunst. — 3. L. m^stigus, Jakobsleiter. — 4. Mäßstab,
wonach eine Zeichnung gefertigt ist; s. äsrsäustion^ s.
ä raxpoi-tsr, der verjüngte Mäßstab. — 5. Ä. ä'sau, 6.
tluvials, s. äs p>onk, der Pegel, das Peil, der Wasserstock.
Lebelou, m., 1., frz., Stufe, stufenförmige Aufstellung
oder Anordnung, — 2. Die Leitersprosse, zur See: dir
Treppenklampc.
Lebeual, sedeneau, eobeuet, m., frz., l. hölzerne
Dachrinne. — 2. (Hütt.) Gußgerinne, Einguß.
LediKre, m., frz., die Untermauerung einer Stein-
treppe, worauf man die Treppenzarge oder die Stufen
legt; Wangenmauer; s., aäj., s. sssalisr.
Fig. 1500. Eckblatt. Ug. 1501.
EchlNUS, m., griech. L'/Ivs;, frz. ssbins, I., astrsAuIs
lssbisn, engl.ovolo, guirlrsätorus, span, sipuino, eigent-
lich Seeigel und demselben ähnlich gestaltete Schüssel, da-
her schüsselförmiges Glied, gedrückter Viertelstab, der im
Kreis herumgeführt wird, z. B. das Hauptglied des dori-
schen Kapitals. Selten wird die Benennung auf gerad-
linig laufende Glieder von gleichem Profil angewendet.
Lebi^uier, m., frz., Schachbretverzierung.
Leboppe, k., frz., offener Schuppen.
Cchtmaß, s. v. w. Aichmäß.
Eckbund, u., I.frz. Isrrursl. sornitzrs, engl. anAular-
iron-banä, Eckbeschläge, Winkel von schwachem Eisen,
womit die Ecken der Fenster- u. sonstiger Rahmen be-
festigt werden. — 2. frz. pisrrs äs rstsnä, engl, sornsr-
stons, Quaderstein an der Ecke einer Mauer.
Eckblatt, n., frz. xntcks, ^rikks, ll, smxattsmsnt, na.
(ä'uns dass appsnäisulss), engl. bass-sä^s-ornamsut,
auch Eckkiiollcu, Eckkiiorren, Cckkrappc, Eckivarze, Verzie-
rung, welche, bes. im romanischen u. byzantinischen Stil,
in deren Abzweigungen und in der Frühgothik vorkom-
mend, deu Uebergang von dem viereckigen Plinthus zu den
runden Formen der Basisglieder vermittelt. Meist legt
sich ein Blatt von dem Pfühl der Basis herab nach den
Ecken des Plinthus, s. Fig. 1499. Oft ist nur die Haupt-
form desselben roh angedeutet, oft treten Thiergestalten
oder Anderes au seine Stelle. Aehnliche Verzierungen
kommen im gothischen Stil auch au der Stelle vor, wo die
rechtwinklige Ecke eines Pfeilerunterbaues in das Achteck
übergeht; s. Fig. 1500 und 1501, beide aus Stift Griffen
in Kärnthen.
Eckchor, m., s. Erker.
Ecke, f.,frz.Än§1s, m., engl.sorusr, an^ls. I.(Geoim)
1. eigentlich Eckpunkt, bei einer ebenen Figur der Punkt,
wo zwei der Seiten dieser Figur, einen Winkel bildend,
zusammenstoßen. Die Anzahl der E.n eines Vielecks ist
gleich derderSeiten, und nach der Eckenzahl heißt dieFigur
ein Dreieck, Viereck u. s. w. und Vieleck. Die E.n liegen
in einem Vieleck entweder neben einander, wenn sie durch
dieselbe Seite verbunden sind, oder nicht, wenn ihre Ver-
bindungslinie eine Diagonale ist. Bei geraden Vielecken
^ spricht mau auch von gegenüberliegenden E.n, nämlich
I wenn nach rechts u. nach links von der Verbindungslinie
! der beiden E.n aus dieselbe Anzahl von E.n des Vielecks
hinliegen. Die E. kann ausspringend od. einsprin-
gend sein, je nachdem der Winkel des Vielecks, dessen
! Spitze die E. bildet, ein konkaver od. konvexer ist; s. d. Art.
Einspringend. — 2. Der Punkt, worin mehrere, ein geo-
metrisches Gebilde entstehen machende Ebenen zusammen-
stoßen, eigentlich besser Spitze genannt. — 3. Die geraden
Linien, welche durch zwei auf einander stoßende jener
Ebenen gebildet werden, heißen E., besser Kante, frz.
arsts, k., snAls 8oliäs, engl, sä^s, soliä an^ls. Alle
Kanten gehen durch die Spitze, und der von zwei Kanten
einer und derselben unter den die E. bildenden Ebenen an
der Spitze hervorgerufene ebene Winkel heißt eine Seite
des körperlichen Dreiecks, Vierecks re., während der Nei-
gungswinkel zweier solcher Ebenen selbst ein Winkel des
Dreiecks w. heißt. Denkt man sich nun die Spitze eines
körperlichen Dreiecks rc. als Mittelpunkt einerKugelfläche,
so steht die durch die Ebenen bedingte Figur der Kugel-
fläche mit ihren Seiten u. Winkeln in engem Zusammen-
hang mit den Seiten und Winkeln des körperlichen Ecks,
wie auch die räumlichem sphärische Trigonometrie zeigt.
Ist nun diese Figur der Kugeloberfläche für ein bestimmtes
körperliches Vieleck kleiner als die halbe Kugelfläche, so
nennt man dieE.selbst eine ausspringende, frz. anAls
saillant ; ist sie größer als die halbe Kugelfläche, so heißt
sie eine einspringende, frz. unZle rsntrant. Euler hat
aufgefundeu, daß für allcKörper mit ausspringenden E.n
die Anzahl der E.n gleich ist der um zwei vermehrten An-
zahl der Kanten, minus der Anzahl der ebenen Be-
wegungsflächen.
II. (Techn.) eigentlich Scheitelpunkt eines ausspringen-
den Körperwinkels, doch auch für Kante eines solchen ge-
braucht. Bei schief abgeschnittenen Prismen spricht man
von kurzer und langer Ecke, statt von der kurzen u. langen
Kante, z. B. bei Stempeln im Minenbau. Am meisten
gebraucht für die Kante zweier lothrechten, sich schneiden-
den'Wandflächen. Hier unterscheidet man: a) bes. scharfe
Ecke, frz. vivs arsts, engl, sbot, mit rechtem Winkel;
b) abgestumpfte Ecke, frz. sntrssoups, engl, blank
sornsr, mit schmaler Verbrcchung ;s)verbrocheneEcke,
frz. snsolAnurs, pan soups; ä) stumpfe Ecke, frz.an§Is
obtns, an^ls Aras, an^ls äu §ras, engl, obtuss sornsn,
mitmchrals90°FIächenwinkel, sjspitze Ecke, frz. an^ls
mai^rs, engl, sbarp sä^s, mit weniger als 90° Flächen-
winkel; ferner in der Holzkonstruktion eingezapftc E. und
E. mit stumpfer Gehrung n., s. darüb. d.Art. Eckverband.
Eckfenster, n., frz. jsnstrs I. SN sneoi^nurs, engl
25*
m., frz., das Recht, eine Leiter auf das
Haus oder Grundstück eines Andern zu stellen, um am
eigenen Haus Reparaturen re. vorzunehmen.
Lellvlitzr, imueder, m., frz., Stangenleiter, Ein-
baum, Leitermit blos einem Baum, durch den die Sprossen
(ranoliss) gesteckt sind.
Lobelie, k., frz. (Bauk.), 1. Leiter; s. äs meunisr, die
Treppenleiter, Leitertreppe; s. ä'sssalaäs, die Sturm-
leiter. — 2. (Bergb.) die Fahrt; s. mobils, die Fahr-
kunst. — 3. L. m^stigus, Jakobsleiter. — 4. Mäßstab,
wonach eine Zeichnung gefertigt ist; s. äsrsäustion^ s.
ä raxpoi-tsr, der verjüngte Mäßstab. — 5. Ä. ä'sau, 6.
tluvials, s. äs p>onk, der Pegel, das Peil, der Wasserstock.
Lebelou, m., 1., frz., Stufe, stufenförmige Aufstellung
oder Anordnung, — 2. Die Leitersprosse, zur See: dir
Treppenklampc.
Lebeual, sedeneau, eobeuet, m., frz., l. hölzerne
Dachrinne. — 2. (Hütt.) Gußgerinne, Einguß.
LediKre, m., frz., die Untermauerung einer Stein-
treppe, worauf man die Treppenzarge oder die Stufen
legt; Wangenmauer; s., aäj., s. sssalisr.
Fig. 1500. Eckblatt. Ug. 1501.
EchlNUS, m., griech. L'/Ivs;, frz. ssbins, I., astrsAuIs
lssbisn, engl.ovolo, guirlrsätorus, span, sipuino, eigent-
lich Seeigel und demselben ähnlich gestaltete Schüssel, da-
her schüsselförmiges Glied, gedrückter Viertelstab, der im
Kreis herumgeführt wird, z. B. das Hauptglied des dori-
schen Kapitals. Selten wird die Benennung auf gerad-
linig laufende Glieder von gleichem Profil angewendet.
Lebi^uier, m., frz., Schachbretverzierung.
Leboppe, k., frz., offener Schuppen.
Cchtmaß, s. v. w. Aichmäß.
Eckbund, u., I.frz. Isrrursl. sornitzrs, engl. anAular-
iron-banä, Eckbeschläge, Winkel von schwachem Eisen,
womit die Ecken der Fenster- u. sonstiger Rahmen be-
festigt werden. — 2. frz. pisrrs äs rstsnä, engl, sornsr-
stons, Quaderstein an der Ecke einer Mauer.
Eckblatt, n., frz. xntcks, ^rikks, ll, smxattsmsnt, na.
(ä'uns dass appsnäisulss), engl. bass-sä^s-ornamsut,
auch Eckkiiollcu, Eckkiiorren, Cckkrappc, Eckivarze, Verzie-
rung, welche, bes. im romanischen u. byzantinischen Stil,
in deren Abzweigungen und in der Frühgothik vorkom-
mend, deu Uebergang von dem viereckigen Plinthus zu den
runden Formen der Basisglieder vermittelt. Meist legt
sich ein Blatt von dem Pfühl der Basis herab nach den
Ecken des Plinthus, s. Fig. 1499. Oft ist nur die Haupt-
form desselben roh angedeutet, oft treten Thiergestalten
oder Anderes au seine Stelle. Aehnliche Verzierungen
kommen im gothischen Stil auch au der Stelle vor, wo die
rechtwinklige Ecke eines Pfeilerunterbaues in das Achteck
übergeht; s. Fig. 1500 und 1501, beide aus Stift Griffen
in Kärnthen.
Eckchor, m., s. Erker.
Ecke, f.,frz.Än§1s, m., engl.sorusr, an^ls. I.(Geoim)
1. eigentlich Eckpunkt, bei einer ebenen Figur der Punkt,
wo zwei der Seiten dieser Figur, einen Winkel bildend,
zusammenstoßen. Die Anzahl der E.n eines Vielecks ist
gleich derderSeiten, und nach der Eckenzahl heißt dieFigur
ein Dreieck, Viereck u. s. w. und Vieleck. Die E.n liegen
in einem Vieleck entweder neben einander, wenn sie durch
dieselbe Seite verbunden sind, oder nicht, wenn ihre Ver-
bindungslinie eine Diagonale ist. Bei geraden Vielecken
^ spricht mau auch von gegenüberliegenden E.n, nämlich
I wenn nach rechts u. nach links von der Verbindungslinie
! der beiden E.n aus dieselbe Anzahl von E.n des Vielecks
hinliegen. Die E. kann ausspringend od. einsprin-
gend sein, je nachdem der Winkel des Vielecks, dessen
! Spitze die E. bildet, ein konkaver od. konvexer ist; s. d. Art.
Einspringend. — 2. Der Punkt, worin mehrere, ein geo-
metrisches Gebilde entstehen machende Ebenen zusammen-
stoßen, eigentlich besser Spitze genannt. — 3. Die geraden
Linien, welche durch zwei auf einander stoßende jener
Ebenen gebildet werden, heißen E., besser Kante, frz.
arsts, k., snAls 8oliäs, engl, sä^s, soliä an^ls. Alle
Kanten gehen durch die Spitze, und der von zwei Kanten
einer und derselben unter den die E. bildenden Ebenen an
der Spitze hervorgerufene ebene Winkel heißt eine Seite
des körperlichen Dreiecks, Vierecks re., während der Nei-
gungswinkel zweier solcher Ebenen selbst ein Winkel des
Dreiecks w. heißt. Denkt man sich nun die Spitze eines
körperlichen Dreiecks rc. als Mittelpunkt einerKugelfläche,
so steht die durch die Ebenen bedingte Figur der Kugel-
fläche mit ihren Seiten u. Winkeln in engem Zusammen-
hang mit den Seiten und Winkeln des körperlichen Ecks,
wie auch die räumlichem sphärische Trigonometrie zeigt.
Ist nun diese Figur der Kugeloberfläche für ein bestimmtes
körperliches Vieleck kleiner als die halbe Kugelfläche, so
nennt man dieE.selbst eine ausspringende, frz. anAls
saillant ; ist sie größer als die halbe Kugelfläche, so heißt
sie eine einspringende, frz. unZle rsntrant. Euler hat
aufgefundeu, daß für allcKörper mit ausspringenden E.n
die Anzahl der E.n gleich ist der um zwei vermehrten An-
zahl der Kanten, minus der Anzahl der ebenen Be-
wegungsflächen.
II. (Techn.) eigentlich Scheitelpunkt eines ausspringen-
den Körperwinkels, doch auch für Kante eines solchen ge-
braucht. Bei schief abgeschnittenen Prismen spricht man
von kurzer und langer Ecke, statt von der kurzen u. langen
Kante, z. B. bei Stempeln im Minenbau. Am meisten
gebraucht für die Kante zweier lothrechten, sich schneiden-
den'Wandflächen. Hier unterscheidet man: a) bes. scharfe
Ecke, frz. vivs arsts, engl, sbot, mit rechtem Winkel;
b) abgestumpfte Ecke, frz. sntrssoups, engl, blank
sornsr, mit schmaler Verbrcchung ;s)verbrocheneEcke,
frz. snsolAnurs, pan soups; ä) stumpfe Ecke, frz.an§Is
obtns, an^ls Aras, an^ls äu §ras, engl, obtuss sornsn,
mitmchrals90°FIächenwinkel, sjspitze Ecke, frz. an^ls
mai^rs, engl, sbarp sä^s, mit weniger als 90° Flächen-
winkel; ferner in der Holzkonstruktion eingezapftc E. und
E. mit stumpfer Gehrung n., s. darüb. d.Art. Eckverband.
Eckfenster, n., frz. jsnstrs I. SN sneoi^nurs, engl
25*