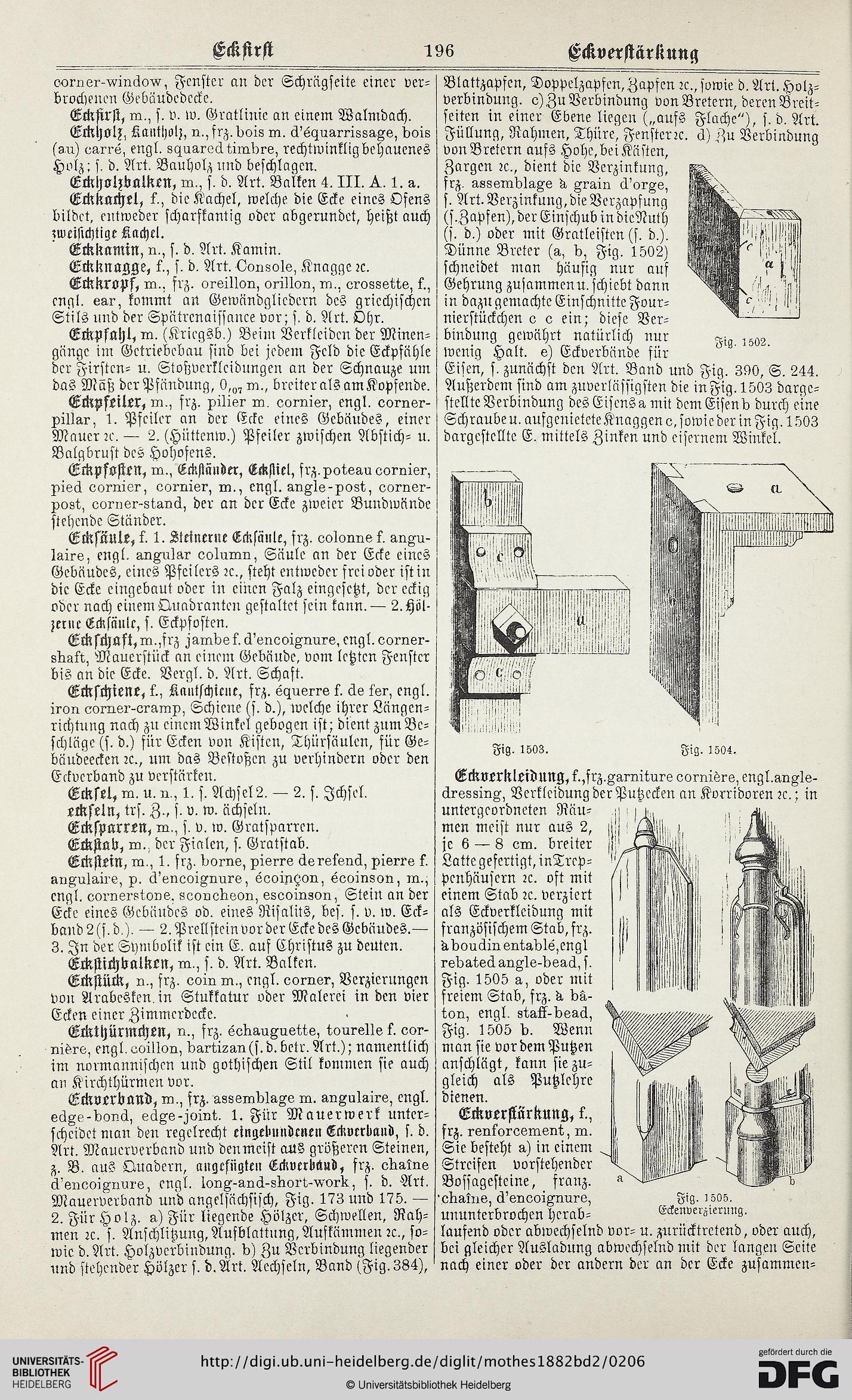Kckfirst ^96 Kckverstärkung
oornsr-ivinäoiv, Fenster an der Schrägseite einer ver-
brochenen Gebäudedecke.
Cckstrst, m., s. v. w. Gratlinie an einem Walmdach.
Eckhvlst kaatholz, n.strz.bois m. ä'6gnari-is8ags, bois
(au) sarrs, engl. Zgaareä tiinbrs, rechtwinklig behauenes
Holz; s. d. Art. Bauholz uud beschlagen.
Eckholzdalken, m., s. d. Art. Balken 4. III. 1. a.
Eckkachel, I., die Kachel, welche die Ecke eines Ofens
bildet, entweder scharfkantig oder abgerundet, heißt auch
rwcisichtigc Kachel.
Eckkamin, n., s. d. Art. Kamin.
Eckknagge, I., s. d. Art. Oonsol«, Knagge rc.
Eckkropf, IN., frz. orsillou, orillou, NI., or0886tt,6, I,
engl, sar, kommt an Gewändglicdern des griechischen
Stils und der Spätrcnaissance vor; s. d. Art. Ohr.
Eckpfahl, in. (Kriegsb.) Beim Verkleiden der Minen-
gängc im Getriebebau sind bei jedem Feld die Eckpfähle
der Firsten- u. Stoßverkleidungen an der Schnauze um
das Maß der Pfändung, 0,^nn, breiter als amKopfende.
Eckpfeiler, IN., frz. pilisr NN ooruisr, engl, cornsr-
xillar, l. Pfeiler an der Ecke eines Gebäudes, einer
Mauer re. — 2. (Hüttenw.) Pfeiler zwischen Abstich- u.
Balgbrust des Hohofens.
Eckpfosten, na., Eckstäiidn, Lckjliel, frz. potsau eorriiei-,
pisä oornier, eornisr, in., engl. anAls-post, sornsr-
post, sornsr-8tanä, der an der Ecke zweier Bundwände
stehende Ständer.
Eckfäule, 1.1. Steinerne Ecksänlc, frz. solonns I. an^u-
lairs, engl, angular solunan, Säule an der Ecke eines
Gebäudes, eines Pfeilers n., steht entweder frei oder ist in
die Ecke eingebaut oder in einen Falz eingesetzt, der eckig
oder nach einem Quadranten gestaltet sein kann.— ^Höl-
zerne Ecksäule, s. Eckpfosten.
Eckfchaft,iu.,frz saiuds1. ä'snooiAiuii-s, engl, ooimsr-
aliakt, Mauerstück an einem Gebäude, vom letzten Fenster
bis an die Ecke. Vergl. d. Art. Schaft.
Eckfchiene, I., knntschicne, frz. sgusrrs I. äs tsr, engl,
irou sorusr-sramp, Schiene (s. d.), welche ihrer Längen-
richtung nach zu einem Winkel gebogen ist; dient zum Be-
schläge (s. d.) für Ecken von Kisten, Thürsäulen, für Ge-
bäudeecken rc., um das Bestoßen zu verhindern oder den
Eckverband zu verstärken.
Eckfel, m. u. in, 1. s. Achsel2. — 2. s. Jchsel.
rckseln, trs. Z., s. v. w. ächfeln.
Eckfparrrn, IN., s. v. w. Gratsparren.
Eckstab, in., der Fialen, s. Gratstab.
Eckstein, ru., 1. frz. dorus, pisirs äsrslsuä, pisrrs I.
augulairs, p. ä'sneoignurs, ssoiutzon, sooin80u, in.,
engl, oornsretous, seousdsou, 68ooiii30n, Stein an der
Ecke eines Gebäudes od. eines Risalits, bes. s. v. w. Eck-
baud 2 (s.d,). — 2. Prellstein vor der Ecke des Gebäudes.—
3. In der Symbolik ist ein E. auf Christus zu deuten.
Eckstichbalkcn, m., s. d. Art. Balken.
Eckstück, n., frz. soiii in., engl, oornsr, Verzierungen
von Arabesken, in Stukkatur oder Malerei in den vier
Ecken einer Zimmerdecke.
Ecklhürmchen, m, frz. ssdaugustts, toui-slls I. oor-
nidrs, engl.üoülon, dartmauss.d.betr.Art.); namentlich
im normannischen und gothischen Stil kommen sie auch
an Kirchthürmen vor.
Eckvrrband, IN., frz. a886indlLZ6 NI. an^ulairs, engl,
sägs-donä, sässs-joint. 1. Für Mauerwerk unter-
scheidet man den regelrecht eingeluindcnen Lckverlmnd, s. d.
Art. Maucrverband und denmeist aus größeren Steinen,
z. B. aus Quadern, angcsiigtcii Eckvcrlutud, frz. odatus
äNiiooiAiiurs, engl. lonA-anä-8liort-ivoik, s. d. Art.
Mauerverband und angelsächsisch, Fig. 173 und 175. —
2. Für Holz, a) Für liegende Hölzer. Schwellen, Rah-
men rc. s. Anschlitzung, Aufblattung.Aufkämmeu rc., so-
wie d.Art. Holzverbindung, d) Zu Verbindung liegender
und stehender Hölzer s. d.Ärt. Wechseln, Band (Fig. 384),
Blattzapsen, Doppelzapfen, Zapfen rc., sowie d. Art. Holz-
verbindung. o) Zu Verbindung von Bietern, deren Breit-
seiten in einer Ebene liegen („aufs Flache"), s. d. Art.
Füllung, Rahmen, Thüre, Fenster rc. ä) Zu Verbindung
von Bretern aufs Hohe, bei Kästen,
Zargen rc., dient die Verzinkung,
frz, g,88snidla^s Zrain ä'oiAs,
s. Art. Verzinkung, die Verzapfung
(s.Zapfen), der Einschub in dieNuth
(s. d.) oder mit Gratleistcn (s. d.).
Dünne Bieter (a, d, Fig. 1502)
schneidet man häufig nur auf
Gehrung zufammenu. schiebt dann
in dazu gemachte Einschnitte Four-
nierstückchen o o ein; diese Ver-
bindung gewährt natürlich nur
wenig Halt, s) Eckverbände für
Eisen, s. zunächst den Art. Band und Fig. 390, S. 244.
Außerdem sind am zuverlässigsten die inFig.1503 dargc-
stellte Verbindung desEiscnsa mit dem Eisend durch eine
Schraubeu.aufgeuieteteKnaggen6,sowiederinFig.1503
dargestcllte E. mittels Zinken und eisernem Winkel.
Fig. I5Ü2.
Eckverkleidung, I.strz.AÄiniturs corriidrs, engl.an§Is-
ärs83in^, Verkleidung der Putzccken an Korridoren rc.; in
untergeordneten Räu-
men meist nur aus 2,
je 6 — 8 oiu. breiter
Latte gefertigt, inTrep-
penhäusern rc. oft mit
einem Stab rc. verziert
als Eckverklcidung mit
französischem Stab, frz.
L d ou äiu sutadls, en g l
redatsä an^ls-dsaä, s.
Fig. 1505 a, oder mit
freiem Stab, frz. dä-
ion, engl, stalk-dsaä,
Fig. 1505 d. Wenn
man sie vor dem Putzen
anschlägt, kann sie zu-
gleich als Putzlchre
dienen.
Eckverstarkung, I.,
frz. rsuloreemsut, ra.
Sie besteht a) in einem
Streifen vorstehender
Bossagesteine, franz.
'odaiiis, ä'sn6oiAnurs,
ununterbrochen herab-
laufend oder abwechselnd vor- u. zurücktretend, oder auch,
bei gleicher Ausladung abwechselnd mit der langen Seite
nach einer oder der andern der an der Ecke zusammen-
Fig. 1505.
Eckenverzierung.
oornsr-ivinäoiv, Fenster an der Schrägseite einer ver-
brochenen Gebäudedecke.
Cckstrst, m., s. v. w. Gratlinie an einem Walmdach.
Eckhvlst kaatholz, n.strz.bois m. ä'6gnari-is8ags, bois
(au) sarrs, engl. Zgaareä tiinbrs, rechtwinklig behauenes
Holz; s. d. Art. Bauholz uud beschlagen.
Eckholzdalken, m., s. d. Art. Balken 4. III. 1. a.
Eckkachel, I., die Kachel, welche die Ecke eines Ofens
bildet, entweder scharfkantig oder abgerundet, heißt auch
rwcisichtigc Kachel.
Eckkamin, n., s. d. Art. Kamin.
Eckknagge, I., s. d. Art. Oonsol«, Knagge rc.
Eckkropf, IN., frz. orsillou, orillou, NI., or0886tt,6, I,
engl, sar, kommt an Gewändglicdern des griechischen
Stils und der Spätrcnaissance vor; s. d. Art. Ohr.
Eckpfahl, in. (Kriegsb.) Beim Verkleiden der Minen-
gängc im Getriebebau sind bei jedem Feld die Eckpfähle
der Firsten- u. Stoßverkleidungen an der Schnauze um
das Maß der Pfändung, 0,^nn, breiter als amKopfende.
Eckpfeiler, IN., frz. pilisr NN ooruisr, engl, cornsr-
xillar, l. Pfeiler an der Ecke eines Gebäudes, einer
Mauer re. — 2. (Hüttenw.) Pfeiler zwischen Abstich- u.
Balgbrust des Hohofens.
Eckpfosten, na., Eckstäiidn, Lckjliel, frz. potsau eorriiei-,
pisä oornier, eornisr, in., engl. anAls-post, sornsr-
post, sornsr-8tanä, der an der Ecke zweier Bundwände
stehende Ständer.
Eckfäule, 1.1. Steinerne Ecksänlc, frz. solonns I. an^u-
lairs, engl, angular solunan, Säule an der Ecke eines
Gebäudes, eines Pfeilers n., steht entweder frei oder ist in
die Ecke eingebaut oder in einen Falz eingesetzt, der eckig
oder nach einem Quadranten gestaltet sein kann.— ^Höl-
zerne Ecksäule, s. Eckpfosten.
Eckfchaft,iu.,frz saiuds1. ä'snooiAiuii-s, engl, ooimsr-
aliakt, Mauerstück an einem Gebäude, vom letzten Fenster
bis an die Ecke. Vergl. d. Art. Schaft.
Eckfchiene, I., knntschicne, frz. sgusrrs I. äs tsr, engl,
irou sorusr-sramp, Schiene (s. d.), welche ihrer Längen-
richtung nach zu einem Winkel gebogen ist; dient zum Be-
schläge (s. d.) für Ecken von Kisten, Thürsäulen, für Ge-
bäudeecken rc., um das Bestoßen zu verhindern oder den
Eckverband zu verstärken.
Eckfel, m. u. in, 1. s. Achsel2. — 2. s. Jchsel.
rckseln, trs. Z., s. v. w. ächfeln.
Eckfparrrn, IN., s. v. w. Gratsparren.
Eckstab, in., der Fialen, s. Gratstab.
Eckstein, ru., 1. frz. dorus, pisirs äsrslsuä, pisrrs I.
augulairs, p. ä'sneoignurs, ssoiutzon, sooin80u, in.,
engl, oornsretous, seousdsou, 68ooiii30n, Stein an der
Ecke eines Gebäudes od. eines Risalits, bes. s. v. w. Eck-
baud 2 (s.d,). — 2. Prellstein vor der Ecke des Gebäudes.—
3. In der Symbolik ist ein E. auf Christus zu deuten.
Eckstichbalkcn, m., s. d. Art. Balken.
Eckstück, n., frz. soiii in., engl, oornsr, Verzierungen
von Arabesken, in Stukkatur oder Malerei in den vier
Ecken einer Zimmerdecke.
Ecklhürmchen, m, frz. ssdaugustts, toui-slls I. oor-
nidrs, engl.üoülon, dartmauss.d.betr.Art.); namentlich
im normannischen und gothischen Stil kommen sie auch
an Kirchthürmen vor.
Eckvrrband, IN., frz. a886indlLZ6 NI. an^ulairs, engl,
sägs-donä, sässs-joint. 1. Für Mauerwerk unter-
scheidet man den regelrecht eingeluindcnen Lckverlmnd, s. d.
Art. Maucrverband und denmeist aus größeren Steinen,
z. B. aus Quadern, angcsiigtcii Eckvcrlutud, frz. odatus
äNiiooiAiiurs, engl. lonA-anä-8liort-ivoik, s. d. Art.
Mauerverband und angelsächsisch, Fig. 173 und 175. —
2. Für Holz, a) Für liegende Hölzer. Schwellen, Rah-
men rc. s. Anschlitzung, Aufblattung.Aufkämmeu rc., so-
wie d.Art. Holzverbindung, d) Zu Verbindung liegender
und stehender Hölzer s. d.Ärt. Wechseln, Band (Fig. 384),
Blattzapsen, Doppelzapfen, Zapfen rc., sowie d. Art. Holz-
verbindung. o) Zu Verbindung von Bietern, deren Breit-
seiten in einer Ebene liegen („aufs Flache"), s. d. Art.
Füllung, Rahmen, Thüre, Fenster rc. ä) Zu Verbindung
von Bretern aufs Hohe, bei Kästen,
Zargen rc., dient die Verzinkung,
frz, g,88snidla^s Zrain ä'oiAs,
s. Art. Verzinkung, die Verzapfung
(s.Zapfen), der Einschub in dieNuth
(s. d.) oder mit Gratleistcn (s. d.).
Dünne Bieter (a, d, Fig. 1502)
schneidet man häufig nur auf
Gehrung zufammenu. schiebt dann
in dazu gemachte Einschnitte Four-
nierstückchen o o ein; diese Ver-
bindung gewährt natürlich nur
wenig Halt, s) Eckverbände für
Eisen, s. zunächst den Art. Band und Fig. 390, S. 244.
Außerdem sind am zuverlässigsten die inFig.1503 dargc-
stellte Verbindung desEiscnsa mit dem Eisend durch eine
Schraubeu.aufgeuieteteKnaggen6,sowiederinFig.1503
dargestcllte E. mittels Zinken und eisernem Winkel.
Fig. I5Ü2.
Eckverkleidung, I.strz.AÄiniturs corriidrs, engl.an§Is-
ärs83in^, Verkleidung der Putzccken an Korridoren rc.; in
untergeordneten Räu-
men meist nur aus 2,
je 6 — 8 oiu. breiter
Latte gefertigt, inTrep-
penhäusern rc. oft mit
einem Stab rc. verziert
als Eckverklcidung mit
französischem Stab, frz.
L d ou äiu sutadls, en g l
redatsä an^ls-dsaä, s.
Fig. 1505 a, oder mit
freiem Stab, frz. dä-
ion, engl, stalk-dsaä,
Fig. 1505 d. Wenn
man sie vor dem Putzen
anschlägt, kann sie zu-
gleich als Putzlchre
dienen.
Eckverstarkung, I.,
frz. rsuloreemsut, ra.
Sie besteht a) in einem
Streifen vorstehender
Bossagesteine, franz.
'odaiiis, ä'sn6oiAnurs,
ununterbrochen herab-
laufend oder abwechselnd vor- u. zurücktretend, oder auch,
bei gleicher Ausladung abwechselnd mit der langen Seite
nach einer oder der andern der an der Ecke zusammen-
Fig. 1505.
Eckenverzierung.