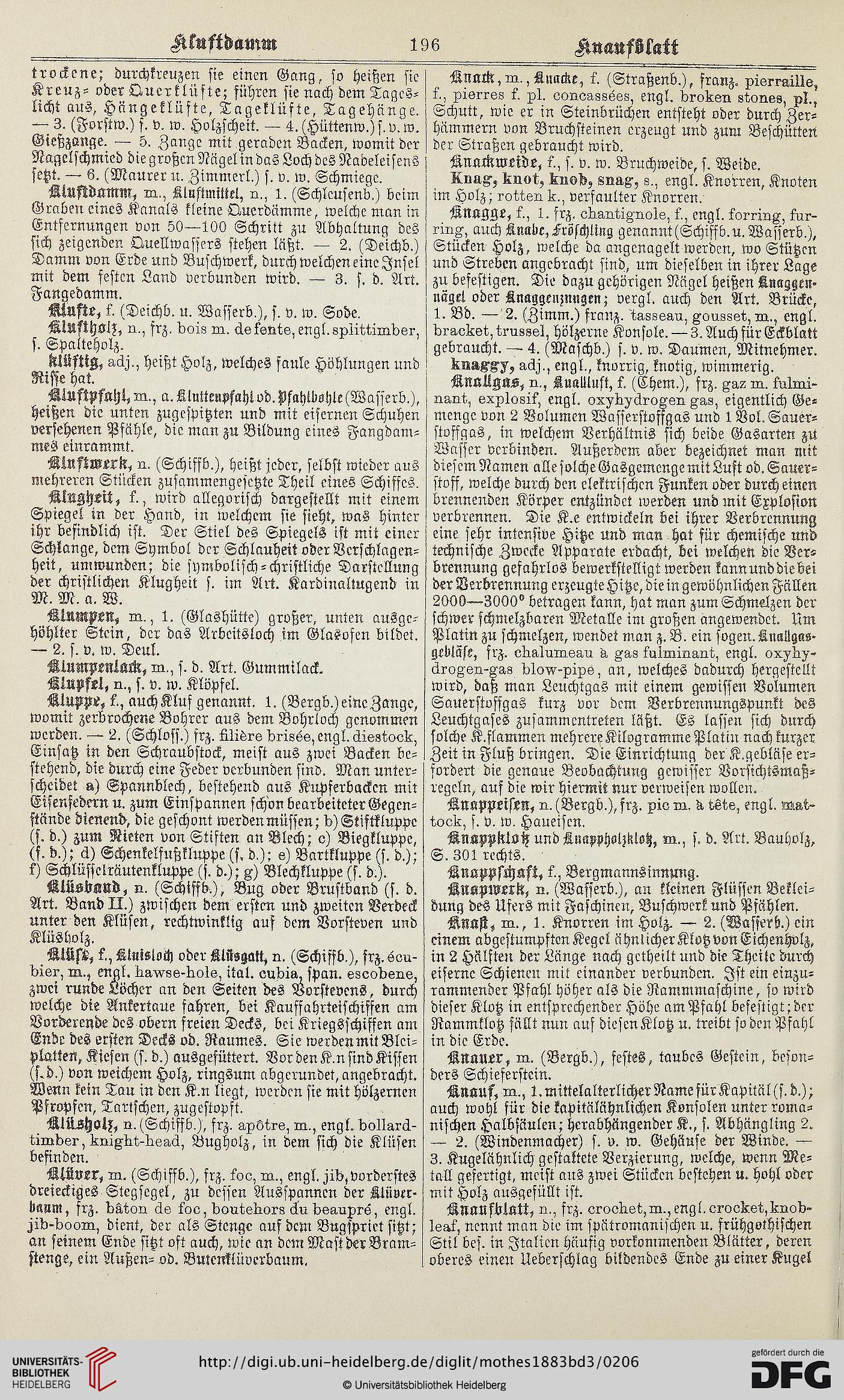trockene; durchkreuzen sie einen Gang, so heißen sie
Kreuz- oder Querklüste; führen sie nach dem Tages-
licht aus, Hängeklüfte, Tageklüfte, Tagehänge.
— 3. (Forstw.) f. v. w. Holzscheit. — 4.(Hüttenw.)s.v.w.
Gießzange. — 5. Zange mit geraden Backen, womit der
Nagelschmied die großen Nägel in das Loch des Naoeleisens
setzt. — 6. (Maurer u. Zimmerl.) s. v. w. Schmiege.
Kiuftdamm, ur., Llllstmittel, n., 1. (Schleusend.) beim
Graben eines Kanals kleine Querdämme, welche man in
Entfernungen von 50—100 Schritt zu Abhaltung des
sich zeigenden Quellwassers stehen läßt. — 2. (Deichb.)
Damm von Erde und Buschwerk, durch welchen eine Insel
mit dem festen Land verbunden wird. — 3. s. d. Art.
Fangedamm.
Wüste, k. (Deichb. u. Wasserb.), s. v. w. Sode.
Kiufthsft, u., frz. boi8 ru. cksüsnts^engl. spiittiradsr,
s. Spalteholz.
Klüftig, aäs., heißt Holz, welches faule Höhlungen und
Riste hat.
Kluftpftch!, ui., a. kluitenpsahi od. pfahibohle (Wasserb.),
heißen die unten zugespitzten und mit eisernen Schuhen
versehenen Pfahle, die man zu Bildung eines Fangdam-
mes einrammt.
ÄlustWrrK, u. (Schiffb.), heißt jeder, selbst wieder aus
mehreren Stücken zusammengesetzte Theil eines Schiffes.
Klugheit, ü, wird allegorisch dargestellt mit einem
Spiegel in der Hand, in welchem sie sieht, was hinter
ihr befindlich ist. Der Stiel des Spiegels ist mit einer
Schlange, dem Symbol der Schlauheit oder Verschlagen-
heit, umwunden; die symbolisch-christliche Darstellung
der christlichen Klugheit s. im Art. Kardinaltugend in
M. M. a. W.
RlLMKLN, rn., 1. (Glashütte) großer, unten ausge-
höhlter Stein, der das Arbcitsloch im Glasofen bildet.
— 2. s. v, w. Deul.
Ätumpenialk, Ul., s. d. Art. Gummilack.
Glupsrl, n., s. v. w. Klöpfel.
Kluppe, ü, auchKluf genannt. 1. (Bergb.)eincZange,
womit zerbrochene Bohrer aus dem Bohrloch genommen
werden. — 2. (Schloss.) frz. ülidrs bri8ss,engl. äisstooü,
Einsatz in den Schraubstock, meist aus zwei Backen be-
stehend, die durch eine Feder verbunden sind. Man unter-
scheidet u) Spannblech, bestehend aus Krrpferbackcu mit
Eisensedern u. zum Einspannen schon bearbeiteter Gegen-
stände dienend, die geschont werdenmüssen; d) Stistkluppe
(s. d.) zum Nieten von Stiften an Blech; o) Biegkluppe,
(f. d.); ä) Schenkelfutzkluppe (s. d.); s) Bartkluppe (s. d.);
I) Schlüssclräutenkluppe (s. d.); x) Blechkluppe (s. d.).
Klösdzmd, u. (Schiffb.), Bug oder Brustband (s. d.
Art. Band II.) zwischen dem ersten und zweiten Verdeck
unter den Klüsen, rechtwinklig aus dem Vorsteven und
Klüsholz.
Älüfr, 5, Llriisloch oder Llüsgatt, n. (Schiffb.), frz. son-
dier, rn., engl, üarvbs-bols, ital. oudia, span, ssoodsns,
zwei runde Löcher an den Seiten des Vorstevens, durch
welche dis Ankertaue fahren, bei Kauffahrteischiffen am
Vorderende des obern freien Decks, bei Kriegsschiffen am
Ende des ersten Decks od. Raumes. Sie werden mit Blei-
platten, Kiesen (s. d.) ausgefüttert. Vor den K.n sind Kissen
(s.d.) von weichem Holz, ringsum abgerundet, angebracht.
Wenn kein Tau in den K.n liegt, werden sie mit hölzernen
Pfropfen, Tartschen, zugestopft.
Klüshoft, n. (Schiffb.), frz. axotrs, m., engl, dollarä-
timdsr, üniAdt-dsaä, Bugholz, in dem sich die Klüsen
befinden.
Klüver, ur. (Schiffb.), frz. too, ur., engl, jid,vorderstes
dreieckiges Stegscgel, zu dessen Ausspannen der ÄUivrr-
banm, frz. balou 6s loo, doutsdors äu dsauxrs, engl,
zid-doorn, dient, der als Stenge aus dem Bugspriet sitzt;
an seinem Ende sitzt oft auch, wie an dem Mast der Bram-
stengs, ein Außen- od. Butcnklüvcrbaum.
KttrmfSlaLL
Knack,ru., Knacke, ü (Straßenb.), franz. xisr-ruüls,
ü, xisrrs8 ü xl. oouoa886S8, engl, droüsu stoues, xl,
Schutt, wie er in Steinbrüchen entsteht oder durch Zer-
Hämmern von Bruchsteinen erzeugt und zum Beschütten
der Straßen gebraucht wird.
Knackweide, ü, s. v. w. Bruchweide, s. Weide.
Lna^, lruot, knvb, saug-, 8., engl. Knorren, Knoten
im Holz; rottsu ü., verfaulter Knorren.
Knagge, ü, 1. frz. ottautiguols, ü, engl. lorriuK, tür-
riug, auch Knabe, Froschltug genannt(Schiffb.u. Wasserb.),
Stücken Holz, welche da angcnagelt werden, wo Stützen
und Streben angebracht sind, um dieselben in ihrer Lage
zu befestigen. Die dazu gehörigen Nägel heißen Anagtzeu-
nägei oder Knaggenpingen; vergl. auch den Art. Brücke,
1. Bd. — 2. (Zimm.) franz. tasssau, Aorist, ur., engl.
br-Loüst, tru88s1, hölzerne Konsole. — 3. Auch für Eckblatt
gebraucht. — 4. (Maschb.) s. v. w. Daumen, Mitnehmer,
uckj., engl., knorrig, knotig, wimmerig.
Knallgas, u., Auaiiiuft, I. (Chem.), frz. ga2 ur. luluri-
uaut, sxploeift engl. ox^b^cirousu ga8, eigentlich Ge-
menge von 2 Volumen Wasserstoffgas und 1 Vol. Sauer-
stoffgas, in welchem Verhältnis sich beide Gasarten zu
Wasser verbinden. Außerdem aber bezeichnet man mit
diesem Namen alle solche Gasgemcnge mit Luft od. Sauer-
stoff, welche durch den elektrischen Funken oder durch einen
brennenden Körper entzündet werden und mit Explosion
verbrennen. Die K.e entwickeln bei ihrer Verbrennung
eine sehr intensive Hitze und man hat für chemische und
technische Zwecke Apparate erdacht, bei welchen die Ver-
brennung gefahrlos bewerkstelligt werden kann und diebei
der Verbrennung erzeugte Hitze, die in gewöhnlichen Fällen
2000—3000° betragen kann, hat man zum Schmelzen der
schwer schmelzbaren Metalle im großen angewendct. Um
Platin zu schmelzen, wendet man z. B. ein sogen. Knallgas-
gkbläft, frz. okraluursau s. KL8 tuluriuLut, engl, ox^b)'-
äroAsn-uas blor^-pixs, an, welches dadurch hergestcllt
wird, daß man Leuchtgas mit einem gewissen Volumen
Sausrstvffgas kurz vor dem Verbrennungspunkt des
Leuchtgases zusammentreten läßt. Es lassen sich durch
solche K.flammen mehrereKilogramme Platin nach kurzer
Zeit in Fluß bringen. Die Einrichtung der K.gebläse er-
fordert die genaue Beobachtung gewisser Vorsichtsmaß-
regeln, auf die wir hiermit nur verweisen wollen.
KNKPpeiftm, u. (Bergb.),frz. xüo ur. d reis, engl. w.at-
tooü, s. v. w. Haueisen.
Knappklotz und Lnaxphichklotz, ur., s. d. Art. Bauholz,
S. 301 rechts.
Knappschaft, ü, Bergmannsinnung.
Gnspwerk, u. (Wasserb.), an kleinen Flüssen Beklei-
dung des Users mit Faschinen, Buschwerk und Pfählen.
Knast, ur., 1. Knorren im Holz. — 2. (Wasserb.) ein
einem abgestumpften Kegel ähnticherKlotzvon Eichenholz,
in 2 Hälften der Länge nach gctheilt und die Theilc durch
eiserne Schienen mit einander verbunden. Ist ein einzu-
rammender Pfahl höher als die Rammmaschine, so wird
dieser Klotz in entsprechender Höhe am Pfahl befestigt; der
Rammklotz fällt nun auf diesen Klotz u. treibt so den Pfahl
in die Erde.
Knauer, ur. (Bergb.), festes, taubes Gestein, beson-
ders Schieferstein.
Knauf, ui., 1.mittelalterlicher Name fürKapitäl(s.d.);
auch wohl für die kapitälähnlichen Konsolen unter roma-
nischen Halbsäulen; herabhängender K.» f. Abhängling 2.
— 2. (Windenmacher) s. v. w. Gehäuse der Winde. —
3. Kugelähnlich gestattete Verzierung, welche, wenn Me-
tall gefertigt, meist aus zwei Stücken bestehen u. hohl oder
mit Holz ausgestellt ist.
Knau Matt, u., frz. ooooüst,W.,engl.6i'06L6t,üuob.
Isst) nennt man die im spätromanischen u. srühgothischen
Stil bes. in Italien häufig vorkommendeu Blätter, deren
oberes einen Uebcrschlag bildendes Ende zu einer Kugel
KlNfLdaMM 196
Kreuz- oder Querklüste; führen sie nach dem Tages-
licht aus, Hängeklüfte, Tageklüfte, Tagehänge.
— 3. (Forstw.) f. v. w. Holzscheit. — 4.(Hüttenw.)s.v.w.
Gießzange. — 5. Zange mit geraden Backen, womit der
Nagelschmied die großen Nägel in das Loch des Naoeleisens
setzt. — 6. (Maurer u. Zimmerl.) s. v. w. Schmiege.
Kiuftdamm, ur., Llllstmittel, n., 1. (Schleusend.) beim
Graben eines Kanals kleine Querdämme, welche man in
Entfernungen von 50—100 Schritt zu Abhaltung des
sich zeigenden Quellwassers stehen läßt. — 2. (Deichb.)
Damm von Erde und Buschwerk, durch welchen eine Insel
mit dem festen Land verbunden wird. — 3. s. d. Art.
Fangedamm.
Wüste, k. (Deichb. u. Wasserb.), s. v. w. Sode.
Kiufthsft, u., frz. boi8 ru. cksüsnts^engl. spiittiradsr,
s. Spalteholz.
Klüftig, aäs., heißt Holz, welches faule Höhlungen und
Riste hat.
Kluftpftch!, ui., a. kluitenpsahi od. pfahibohle (Wasserb.),
heißen die unten zugespitzten und mit eisernen Schuhen
versehenen Pfahle, die man zu Bildung eines Fangdam-
mes einrammt.
ÄlustWrrK, u. (Schiffb.), heißt jeder, selbst wieder aus
mehreren Stücken zusammengesetzte Theil eines Schiffes.
Klugheit, ü, wird allegorisch dargestellt mit einem
Spiegel in der Hand, in welchem sie sieht, was hinter
ihr befindlich ist. Der Stiel des Spiegels ist mit einer
Schlange, dem Symbol der Schlauheit oder Verschlagen-
heit, umwunden; die symbolisch-christliche Darstellung
der christlichen Klugheit s. im Art. Kardinaltugend in
M. M. a. W.
RlLMKLN, rn., 1. (Glashütte) großer, unten ausge-
höhlter Stein, der das Arbcitsloch im Glasofen bildet.
— 2. s. v, w. Deul.
Ätumpenialk, Ul., s. d. Art. Gummilack.
Glupsrl, n., s. v. w. Klöpfel.
Kluppe, ü, auchKluf genannt. 1. (Bergb.)eincZange,
womit zerbrochene Bohrer aus dem Bohrloch genommen
werden. — 2. (Schloss.) frz. ülidrs bri8ss,engl. äisstooü,
Einsatz in den Schraubstock, meist aus zwei Backen be-
stehend, die durch eine Feder verbunden sind. Man unter-
scheidet u) Spannblech, bestehend aus Krrpferbackcu mit
Eisensedern u. zum Einspannen schon bearbeiteter Gegen-
stände dienend, die geschont werdenmüssen; d) Stistkluppe
(s. d.) zum Nieten von Stiften an Blech; o) Biegkluppe,
(f. d.); ä) Schenkelfutzkluppe (s. d.); s) Bartkluppe (s. d.);
I) Schlüssclräutenkluppe (s. d.); x) Blechkluppe (s. d.).
Klösdzmd, u. (Schiffb.), Bug oder Brustband (s. d.
Art. Band II.) zwischen dem ersten und zweiten Verdeck
unter den Klüsen, rechtwinklig aus dem Vorsteven und
Klüsholz.
Älüfr, 5, Llriisloch oder Llüsgatt, n. (Schiffb.), frz. son-
dier, rn., engl, üarvbs-bols, ital. oudia, span, ssoodsns,
zwei runde Löcher an den Seiten des Vorstevens, durch
welche dis Ankertaue fahren, bei Kauffahrteischiffen am
Vorderende des obern freien Decks, bei Kriegsschiffen am
Ende des ersten Decks od. Raumes. Sie werden mit Blei-
platten, Kiesen (s. d.) ausgefüttert. Vor den K.n sind Kissen
(s.d.) von weichem Holz, ringsum abgerundet, angebracht.
Wenn kein Tau in den K.n liegt, werden sie mit hölzernen
Pfropfen, Tartschen, zugestopft.
Klüshoft, n. (Schiffb.), frz. axotrs, m., engl, dollarä-
timdsr, üniAdt-dsaä, Bugholz, in dem sich die Klüsen
befinden.
Klüver, ur. (Schiffb.), frz. too, ur., engl, jid,vorderstes
dreieckiges Stegscgel, zu dessen Ausspannen der ÄUivrr-
banm, frz. balou 6s loo, doutsdors äu dsauxrs, engl,
zid-doorn, dient, der als Stenge aus dem Bugspriet sitzt;
an seinem Ende sitzt oft auch, wie an dem Mast der Bram-
stengs, ein Außen- od. Butcnklüvcrbaum.
KttrmfSlaLL
Knack,ru., Knacke, ü (Straßenb.), franz. xisr-ruüls,
ü, xisrrs8 ü xl. oouoa886S8, engl, droüsu stoues, xl,
Schutt, wie er in Steinbrüchen entsteht oder durch Zer-
Hämmern von Bruchsteinen erzeugt und zum Beschütten
der Straßen gebraucht wird.
Knackweide, ü, s. v. w. Bruchweide, s. Weide.
Lna^, lruot, knvb, saug-, 8., engl. Knorren, Knoten
im Holz; rottsu ü., verfaulter Knorren.
Knagge, ü, 1. frz. ottautiguols, ü, engl. lorriuK, tür-
riug, auch Knabe, Froschltug genannt(Schiffb.u. Wasserb.),
Stücken Holz, welche da angcnagelt werden, wo Stützen
und Streben angebracht sind, um dieselben in ihrer Lage
zu befestigen. Die dazu gehörigen Nägel heißen Anagtzeu-
nägei oder Knaggenpingen; vergl. auch den Art. Brücke,
1. Bd. — 2. (Zimm.) franz. tasssau, Aorist, ur., engl.
br-Loüst, tru88s1, hölzerne Konsole. — 3. Auch für Eckblatt
gebraucht. — 4. (Maschb.) s. v. w. Daumen, Mitnehmer,
uckj., engl., knorrig, knotig, wimmerig.
Knallgas, u., Auaiiiuft, I. (Chem.), frz. ga2 ur. luluri-
uaut, sxploeift engl. ox^b^cirousu ga8, eigentlich Ge-
menge von 2 Volumen Wasserstoffgas und 1 Vol. Sauer-
stoffgas, in welchem Verhältnis sich beide Gasarten zu
Wasser verbinden. Außerdem aber bezeichnet man mit
diesem Namen alle solche Gasgemcnge mit Luft od. Sauer-
stoff, welche durch den elektrischen Funken oder durch einen
brennenden Körper entzündet werden und mit Explosion
verbrennen. Die K.e entwickeln bei ihrer Verbrennung
eine sehr intensive Hitze und man hat für chemische und
technische Zwecke Apparate erdacht, bei welchen die Ver-
brennung gefahrlos bewerkstelligt werden kann und diebei
der Verbrennung erzeugte Hitze, die in gewöhnlichen Fällen
2000—3000° betragen kann, hat man zum Schmelzen der
schwer schmelzbaren Metalle im großen angewendct. Um
Platin zu schmelzen, wendet man z. B. ein sogen. Knallgas-
gkbläft, frz. okraluursau s. KL8 tuluriuLut, engl, ox^b)'-
äroAsn-uas blor^-pixs, an, welches dadurch hergestcllt
wird, daß man Leuchtgas mit einem gewissen Volumen
Sausrstvffgas kurz vor dem Verbrennungspunkt des
Leuchtgases zusammentreten läßt. Es lassen sich durch
solche K.flammen mehrereKilogramme Platin nach kurzer
Zeit in Fluß bringen. Die Einrichtung der K.gebläse er-
fordert die genaue Beobachtung gewisser Vorsichtsmaß-
regeln, auf die wir hiermit nur verweisen wollen.
KNKPpeiftm, u. (Bergb.),frz. xüo ur. d reis, engl. w.at-
tooü, s. v. w. Haueisen.
Knappklotz und Lnaxphichklotz, ur., s. d. Art. Bauholz,
S. 301 rechts.
Knappschaft, ü, Bergmannsinnung.
Gnspwerk, u. (Wasserb.), an kleinen Flüssen Beklei-
dung des Users mit Faschinen, Buschwerk und Pfählen.
Knast, ur., 1. Knorren im Holz. — 2. (Wasserb.) ein
einem abgestumpften Kegel ähnticherKlotzvon Eichenholz,
in 2 Hälften der Länge nach gctheilt und die Theilc durch
eiserne Schienen mit einander verbunden. Ist ein einzu-
rammender Pfahl höher als die Rammmaschine, so wird
dieser Klotz in entsprechender Höhe am Pfahl befestigt; der
Rammklotz fällt nun auf diesen Klotz u. treibt so den Pfahl
in die Erde.
Knauer, ur. (Bergb.), festes, taubes Gestein, beson-
ders Schieferstein.
Knauf, ui., 1.mittelalterlicher Name fürKapitäl(s.d.);
auch wohl für die kapitälähnlichen Konsolen unter roma-
nischen Halbsäulen; herabhängender K.» f. Abhängling 2.
— 2. (Windenmacher) s. v. w. Gehäuse der Winde. —
3. Kugelähnlich gestattete Verzierung, welche, wenn Me-
tall gefertigt, meist aus zwei Stücken bestehen u. hohl oder
mit Holz ausgestellt ist.
Knau Matt, u., frz. ooooüst,W.,engl.6i'06L6t,üuob.
Isst) nennt man die im spätromanischen u. srühgothischen
Stil bes. in Italien häufig vorkommendeu Blätter, deren
oberes einen Uebcrschlag bildendes Ende zu einer Kugel
KlNfLdaMM 196