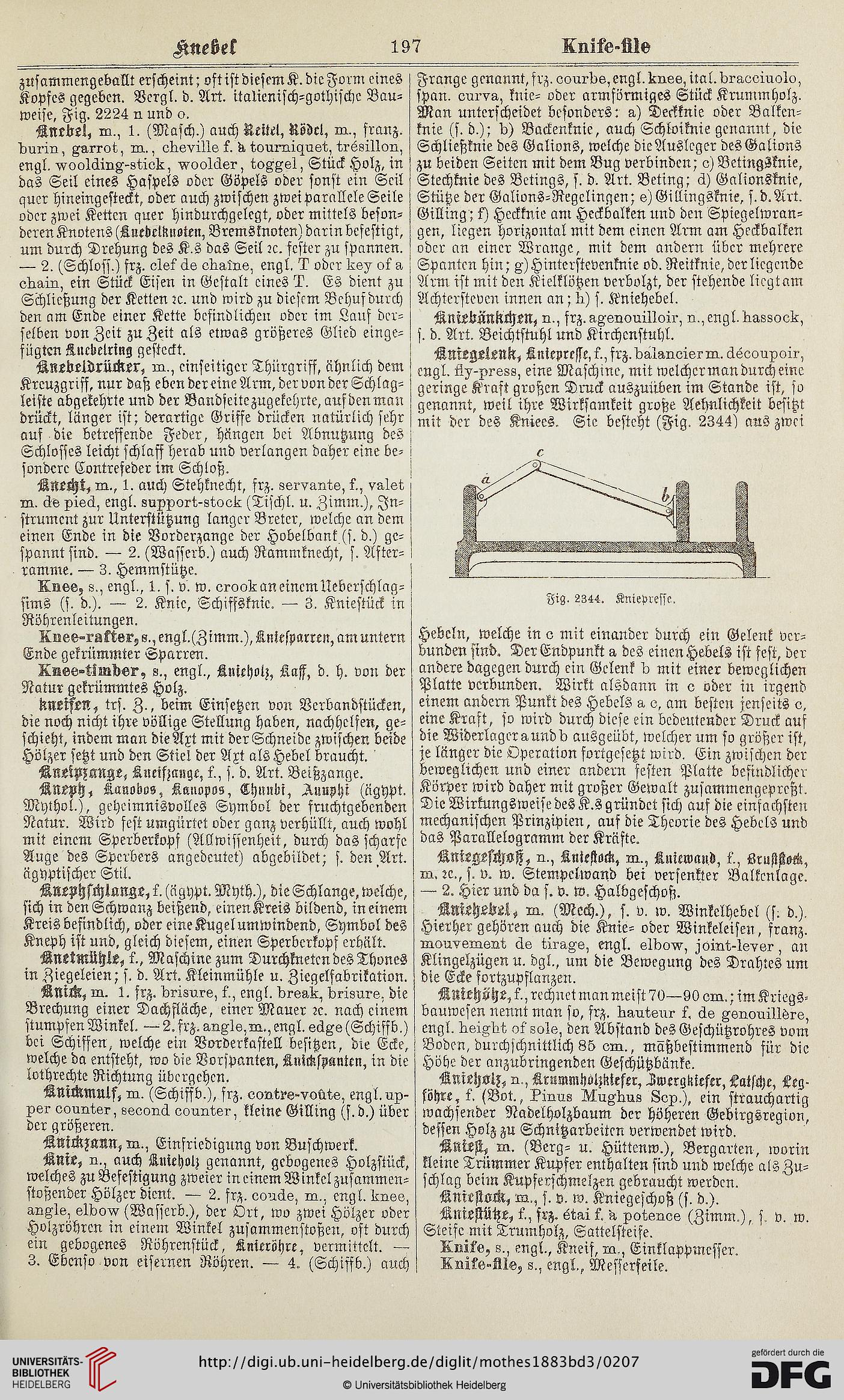Krreöek 197 LuikeMs
zusammengeballt erscheint; oftist diesem K. die Form eines
Kopfes gegeben. Vergl. d. Art. italienisch-gothische Bau-
weise, Fig. 2224 n und o.
Ambe!, m., 1. (Masch.) auch Neittt, Lödci, m., franz.
sturiu, ALrrot, in., olltzvitts st touruigutzt, trs8i11ou,
engl. ^oo1äinK-8tiob, rvoolätzr, toA^tzl, Stück Holz, in
das Seil eines Haspels oder Göpels oder sonst ein Seil
quer hineingesteckt, oder auch zwischen zwei parallele Seile
oder zwei Ketten quer hindurchgelegt, oder mittels beson-
deren Knotens (Luedclknoteii, Bremsknoten) darin befestigt,
um durch Drehung des K.s das Seil w. fester zu spannen.
— 2. (Schloss.) frz. olsk äs ellalus, engl. B oder stez- ot a ^
ollaiu, ein Stück Eisen in Gestalt eines B. Es dient zu
Schließung der Ketten rc. und wird zu diesem Behuf durch
den am Ende einer Kette befindlichen oder im Lauf der- >
selben von Zeit zu Zeit als etwas größeres Glied einge- !
fügten Kuebelring gesteckt.
Ambeldrückrr, m., einseitiger Thürgriff, ähnlich dem
Kreuzgriff, nur daß eben der eine Arm, der von der Schlag-
leiste abgekehrte und der Baudseitczugekehrte, aufdenman
drückt, länger ist; derartige Griffe drücken natürlich sehr
auf die betreffende Feder, hängen bei Abnutzung des ^
Schlosses leicht schlaff herab und verlangen daher eine be- >
sondere Contrefeder im Schloß.
Amcht, m., 1. auch Stehknecht, frz. ssrvants, st, valst
m. ätz xitzä, engl. 8u^>xort-sto6Ü (Tischl. u. Zimm.), In-
strument zur Unterstützung langer Breter, welche an dem
einen Ende in die Vorderzange der Hobelbank (s. d.) ge-
spannt sind. — 2. (Wasserb.) auch Rammknecht, s. After-
ramme. — 3. Hemmstütze.
Luve, s., engl., 1. s. v. w. oroob an einemUeberschlag-
sims (s. d.). — 2. Knie, Schiffsknie. — 3. Kniestück in
Rohrenleitungen.
Lvee-rsktvr'I 8., engl.(Zimm.), Lntesparren, am untern
Ende gekrümmter Sparren.
Lnstz-timdtzr', s., engl., Knieholz, Lass, d. h. von der
Natur gekrümmtes Holz.
Kneifen, trs. Z., beim Einsetzen von Verbandstücken,
die noch nicht ihre völlige Stellung haben, nachhclfen, ge-
schieht, indem man die Axt mit der Schneide zwischen beide
Hölzer setzt und den Stiel der Axt als Hebel braucht.
AnriUMtge, Lnciszaugc, ist f. d. Ars. Beißzange.
ÄMph, Lauoiws, Lanopos, Lhlnibi, Auuphi (ägypt.
Mythos), geheimnisvolles Symbol der fruchtgebenden
Natur. Wird fest umgürtet oder ganz verhüllt, auch wohl
mit einem Sperberkopf (Allwissenheit, durch das scharfe
Auge des Sperbers angedeutet) abgebildet; s. den ,Art.
ägyptischer Stil.
MrphschiüNZr, st (ägypt. Myth.), die Schlange, welche,
sich in den Schwanz beißend, einenKreis bildend, meinem
Kreis befindlich, oder eine Kugel umwindend, Symbol des
Kneph ist und, gleich diesem, einen Sperberkopf erhält.
Knetmühle, st, Maschine zum Durchknetcndes Thones
in Ziegeleien; s. d. Art. Kleinmühle u. Ziegelfabrikation.
KmrK, na. 1. frz. drisurtz,st, engl, drsak, drisurs, die
Brechung einer Dachfläche, einer Mauer re. nach einem
stumpfen Winkel. —2.frz. außls,na.,engl. sä^s (Schiffb.)
bei Schiffen, welche ein Vorderkastell besitzen, die Ecke,
welche da entsteht, wo die Vorspanten, Lnickspüntcn, in die
lothrechte Richtung übergehen.
Ämckmulf, ru. (Schiffb.), frz. ooutrtz-voüttz, engl.ux>-
xsr tzouuttzr, «tzoouä oouuttzr, kleine Gilling (s.d.) über
der größeren.
AnickZKNtt, m., Einfriedigung von Buschwerk.
Anie, u., auch Knieholz genannt, gebogenes Holzstück,
welches zu Befestigung zweier meinem Winkel zusammen-
stoßender Hölzer dient. — 2. frz. eouäs, m.. engl. llusL,
au^ltz, sldorv (Wasserb.), der Ort, wo zwei' Hölzer oder
Holzröhren in einem Winkel zusammenstoßen, oft durch
ein gebogenes Röhrenstück, Lnicrohre, vermittelt. —
3. Ebenso von eisernen Röhren. — 4. (Schiffb.) auch
Frange genannt, frz. tzourds, engl. Kuss, ital. draoeiuolo,
span, tzurva, knie- oder armförmiges Stück Krummholz.
Man unterscheidet besonders: a) Deckknie oder Balken-
knie (s. d.); d) Backenknie, auch Schloiknie genannt, die
Schließknie des Galions, welche dicAusleger des Galions
zu beiden Seiten mit dem Bug verbinden; a) Bctingsknie,
Stechknie des Betings, s. d. Art. Beting; ä) Galionsknie,
Stütze der Galions-Regclingen; s) Gillingsknie, s.d.Art.
Gilling; st) Heckknie an: Heckbalken und den Spiegelwran-
gen, liegen horizontal mit dem einen Arm am Heckbalken
oder an einer Wränge, mit dem andern über mehrere
Spanten hin; gyHinterstevenknie od. Reitknie, der liegende
Arm ist mit den Kielklötzen verbolzt, der stehende liegtam
Achtersteven innen an; ll) s. Kniehebel.
Anirdänkchrn- u., frz. 8A6uoui11oir, u.,engl.liL8806Ü,
s. d. Art. Beichtstuhl und Kirchcnftuhl.
Amrge!enk, Lnier>rrjse,st,srz.st8l8U6itzrru. ätztzouxoir,
engl. Üz--xr688, eine Maschine, mit welchcrman durch eine
geringe Kraft großen Druck auszuüben im Stande ist, so
genannt, weil ihre Wirksamkeit große Aehnlichkeit besitzt
mit der des Kniees. Sie besteht (Fig. 2344) aus zwei
Hebeln, welche in v mit einander durch ein Gelenk ver-
bunden sind. Der Endpunkt a des eiuen Hebels ist fest, der
andere dagegen durch ein Gelenk st mit einer beweglichen
Platte verbunden. Wirkt alsdann in 6 oder in irgend
einem andern Punkt des Hebels s. o, am besten jenseits «,
eine Kraft, so wird durch diese ein bedeutender Druck auf
die Widerlager 8 und st ausgeübt, welcher um so größer ist,
je länger die Operation fortgesetzt wird. Ein zwischen der
beweglichen und einer andern festen Platte befindlicher
Körper wird daher mit großer Gewalt zusammengepreßt.
Die Wirkungsweise des K.s gründet sich auf die einfachsten
mechanischen Prinzipien, auf die Theorie des Hebels und
das Parallelogramm der Kräfte.
Anirgeschsß, u., üntefiack, m., Lnrervarid, ist 6ruMM,
m. re., s. v. w. Stempelwand bei versenkter Balkenlage.
— 2. Hier und da s. v. w. Halbgeschoß.
MiehLdsl- in. (Mcch.), f. v. w. Winkelhebel (st d.).
Hierher gehören auch die Knie- oder Winkeleiseu, franz.
mouvsratzut ätz tiraKS, engl, slkorv, joiitt-levor, an
Klingelzügen u. dgl., um die Bewegung des Drahtes um
die Ecke sortzupflanzen.
Kuiehshr, st, rechnet man meist 70—90 eru.; im Kriegs-
bauwesen nennt man so, frz. stauttzur- st äs §tzuoui11tzi-6,
engl. sttziAÜt ot'solk, den Abstand des Geschützrohres vom
Boden, durchschnittlich 8ö om., mäßbestimmend für die
Höhe der anzubringenden Geschützbänke.
Amehstz, u., LnimmholMrser, Kwrrgkirftr, Latsche, Leg-
föhre, 5. (Bot., kiuu.8 ÄstuKÜus 8ex.), ein strauchartig
wachsender Nadelholzbaum der höheren Gebirgsregion,
dessen Holz zu Schnitzarbeiten verwendet wird.
MirZst m. (Berg- u. Hüttcnw.), Bergarten, worin
kleine Trümmer Kupfer enthalten sind und welche als Zu-
schlag beim Kupserschmelzen gebraucht werden.
Anirstsllft m,, s. v. w. Kniegeschoß (s. d.).
KmeMkr, st, frz. ätai st 8 pottzuos (Zimm.), s. v. w.
Steife mit Trumholz, Sattelsteise.
Lullst, 8., engl., Kneif, ra., Einklappmcsser.
Lulktz-KlH, 8., eng!., Messerfeile.
zusammengeballt erscheint; oftist diesem K. die Form eines
Kopfes gegeben. Vergl. d. Art. italienisch-gothische Bau-
weise, Fig. 2224 n und o.
Ambe!, m., 1. (Masch.) auch Neittt, Lödci, m., franz.
sturiu, ALrrot, in., olltzvitts st touruigutzt, trs8i11ou,
engl. ^oo1äinK-8tiob, rvoolätzr, toA^tzl, Stück Holz, in
das Seil eines Haspels oder Göpels oder sonst ein Seil
quer hineingesteckt, oder auch zwischen zwei parallele Seile
oder zwei Ketten quer hindurchgelegt, oder mittels beson-
deren Knotens (Luedclknoteii, Bremsknoten) darin befestigt,
um durch Drehung des K.s das Seil w. fester zu spannen.
— 2. (Schloss.) frz. olsk äs ellalus, engl. B oder stez- ot a ^
ollaiu, ein Stück Eisen in Gestalt eines B. Es dient zu
Schließung der Ketten rc. und wird zu diesem Behuf durch
den am Ende einer Kette befindlichen oder im Lauf der- >
selben von Zeit zu Zeit als etwas größeres Glied einge- !
fügten Kuebelring gesteckt.
Ambeldrückrr, m., einseitiger Thürgriff, ähnlich dem
Kreuzgriff, nur daß eben der eine Arm, der von der Schlag-
leiste abgekehrte und der Baudseitczugekehrte, aufdenman
drückt, länger ist; derartige Griffe drücken natürlich sehr
auf die betreffende Feder, hängen bei Abnutzung des ^
Schlosses leicht schlaff herab und verlangen daher eine be- >
sondere Contrefeder im Schloß.
Amcht, m., 1. auch Stehknecht, frz. ssrvants, st, valst
m. ätz xitzä, engl. 8u^>xort-sto6Ü (Tischl. u. Zimm.), In-
strument zur Unterstützung langer Breter, welche an dem
einen Ende in die Vorderzange der Hobelbank (s. d.) ge-
spannt sind. — 2. (Wasserb.) auch Rammknecht, s. After-
ramme. — 3. Hemmstütze.
Luve, s., engl., 1. s. v. w. oroob an einemUeberschlag-
sims (s. d.). — 2. Knie, Schiffsknie. — 3. Kniestück in
Rohrenleitungen.
Lvee-rsktvr'I 8., engl.(Zimm.), Lntesparren, am untern
Ende gekrümmter Sparren.
Lnstz-timdtzr', s., engl., Knieholz, Lass, d. h. von der
Natur gekrümmtes Holz.
Kneifen, trs. Z., beim Einsetzen von Verbandstücken,
die noch nicht ihre völlige Stellung haben, nachhclfen, ge-
schieht, indem man die Axt mit der Schneide zwischen beide
Hölzer setzt und den Stiel der Axt als Hebel braucht.
AnriUMtge, Lnciszaugc, ist f. d. Ars. Beißzange.
ÄMph, Lauoiws, Lanopos, Lhlnibi, Auuphi (ägypt.
Mythos), geheimnisvolles Symbol der fruchtgebenden
Natur. Wird fest umgürtet oder ganz verhüllt, auch wohl
mit einem Sperberkopf (Allwissenheit, durch das scharfe
Auge des Sperbers angedeutet) abgebildet; s. den ,Art.
ägyptischer Stil.
MrphschiüNZr, st (ägypt. Myth.), die Schlange, welche,
sich in den Schwanz beißend, einenKreis bildend, meinem
Kreis befindlich, oder eine Kugel umwindend, Symbol des
Kneph ist und, gleich diesem, einen Sperberkopf erhält.
Knetmühle, st, Maschine zum Durchknetcndes Thones
in Ziegeleien; s. d. Art. Kleinmühle u. Ziegelfabrikation.
KmrK, na. 1. frz. drisurtz,st, engl, drsak, drisurs, die
Brechung einer Dachfläche, einer Mauer re. nach einem
stumpfen Winkel. —2.frz. außls,na.,engl. sä^s (Schiffb.)
bei Schiffen, welche ein Vorderkastell besitzen, die Ecke,
welche da entsteht, wo die Vorspanten, Lnickspüntcn, in die
lothrechte Richtung übergehen.
Ämckmulf, ru. (Schiffb.), frz. ooutrtz-voüttz, engl.ux>-
xsr tzouuttzr, «tzoouä oouuttzr, kleine Gilling (s.d.) über
der größeren.
AnickZKNtt, m., Einfriedigung von Buschwerk.
Anie, u., auch Knieholz genannt, gebogenes Holzstück,
welches zu Befestigung zweier meinem Winkel zusammen-
stoßender Hölzer dient. — 2. frz. eouäs, m.. engl. llusL,
au^ltz, sldorv (Wasserb.), der Ort, wo zwei' Hölzer oder
Holzröhren in einem Winkel zusammenstoßen, oft durch
ein gebogenes Röhrenstück, Lnicrohre, vermittelt. —
3. Ebenso von eisernen Röhren. — 4. (Schiffb.) auch
Frange genannt, frz. tzourds, engl. Kuss, ital. draoeiuolo,
span, tzurva, knie- oder armförmiges Stück Krummholz.
Man unterscheidet besonders: a) Deckknie oder Balken-
knie (s. d.); d) Backenknie, auch Schloiknie genannt, die
Schließknie des Galions, welche dicAusleger des Galions
zu beiden Seiten mit dem Bug verbinden; a) Bctingsknie,
Stechknie des Betings, s. d. Art. Beting; ä) Galionsknie,
Stütze der Galions-Regclingen; s) Gillingsknie, s.d.Art.
Gilling; st) Heckknie an: Heckbalken und den Spiegelwran-
gen, liegen horizontal mit dem einen Arm am Heckbalken
oder an einer Wränge, mit dem andern über mehrere
Spanten hin; gyHinterstevenknie od. Reitknie, der liegende
Arm ist mit den Kielklötzen verbolzt, der stehende liegtam
Achtersteven innen an; ll) s. Kniehebel.
Anirdänkchrn- u., frz. 8A6uoui11oir, u.,engl.liL8806Ü,
s. d. Art. Beichtstuhl und Kirchcnftuhl.
Amrge!enk, Lnier>rrjse,st,srz.st8l8U6itzrru. ätztzouxoir,
engl. Üz--xr688, eine Maschine, mit welchcrman durch eine
geringe Kraft großen Druck auszuüben im Stande ist, so
genannt, weil ihre Wirksamkeit große Aehnlichkeit besitzt
mit der des Kniees. Sie besteht (Fig. 2344) aus zwei
Hebeln, welche in v mit einander durch ein Gelenk ver-
bunden sind. Der Endpunkt a des eiuen Hebels ist fest, der
andere dagegen durch ein Gelenk st mit einer beweglichen
Platte verbunden. Wirkt alsdann in 6 oder in irgend
einem andern Punkt des Hebels s. o, am besten jenseits «,
eine Kraft, so wird durch diese ein bedeutender Druck auf
die Widerlager 8 und st ausgeübt, welcher um so größer ist,
je länger die Operation fortgesetzt wird. Ein zwischen der
beweglichen und einer andern festen Platte befindlicher
Körper wird daher mit großer Gewalt zusammengepreßt.
Die Wirkungsweise des K.s gründet sich auf die einfachsten
mechanischen Prinzipien, auf die Theorie des Hebels und
das Parallelogramm der Kräfte.
Anirgeschsß, u., üntefiack, m., Lnrervarid, ist 6ruMM,
m. re., s. v. w. Stempelwand bei versenkter Balkenlage.
— 2. Hier und da s. v. w. Halbgeschoß.
MiehLdsl- in. (Mcch.), f. v. w. Winkelhebel (st d.).
Hierher gehören auch die Knie- oder Winkeleiseu, franz.
mouvsratzut ätz tiraKS, engl, slkorv, joiitt-levor, an
Klingelzügen u. dgl., um die Bewegung des Drahtes um
die Ecke sortzupflanzen.
Kuiehshr, st, rechnet man meist 70—90 eru.; im Kriegs-
bauwesen nennt man so, frz. stauttzur- st äs §tzuoui11tzi-6,
engl. sttziAÜt ot'solk, den Abstand des Geschützrohres vom
Boden, durchschnittlich 8ö om., mäßbestimmend für die
Höhe der anzubringenden Geschützbänke.
Amehstz, u., LnimmholMrser, Kwrrgkirftr, Latsche, Leg-
föhre, 5. (Bot., kiuu.8 ÄstuKÜus 8ex.), ein strauchartig
wachsender Nadelholzbaum der höheren Gebirgsregion,
dessen Holz zu Schnitzarbeiten verwendet wird.
MirZst m. (Berg- u. Hüttcnw.), Bergarten, worin
kleine Trümmer Kupfer enthalten sind und welche als Zu-
schlag beim Kupserschmelzen gebraucht werden.
Anirstsllft m,, s. v. w. Kniegeschoß (s. d.).
KmeMkr, st, frz. ätai st 8 pottzuos (Zimm.), s. v. w.
Steife mit Trumholz, Sattelsteise.
Lullst, 8., engl., Kneif, ra., Einklappmcsser.
Lulktz-KlH, 8., eng!., Messerfeile.