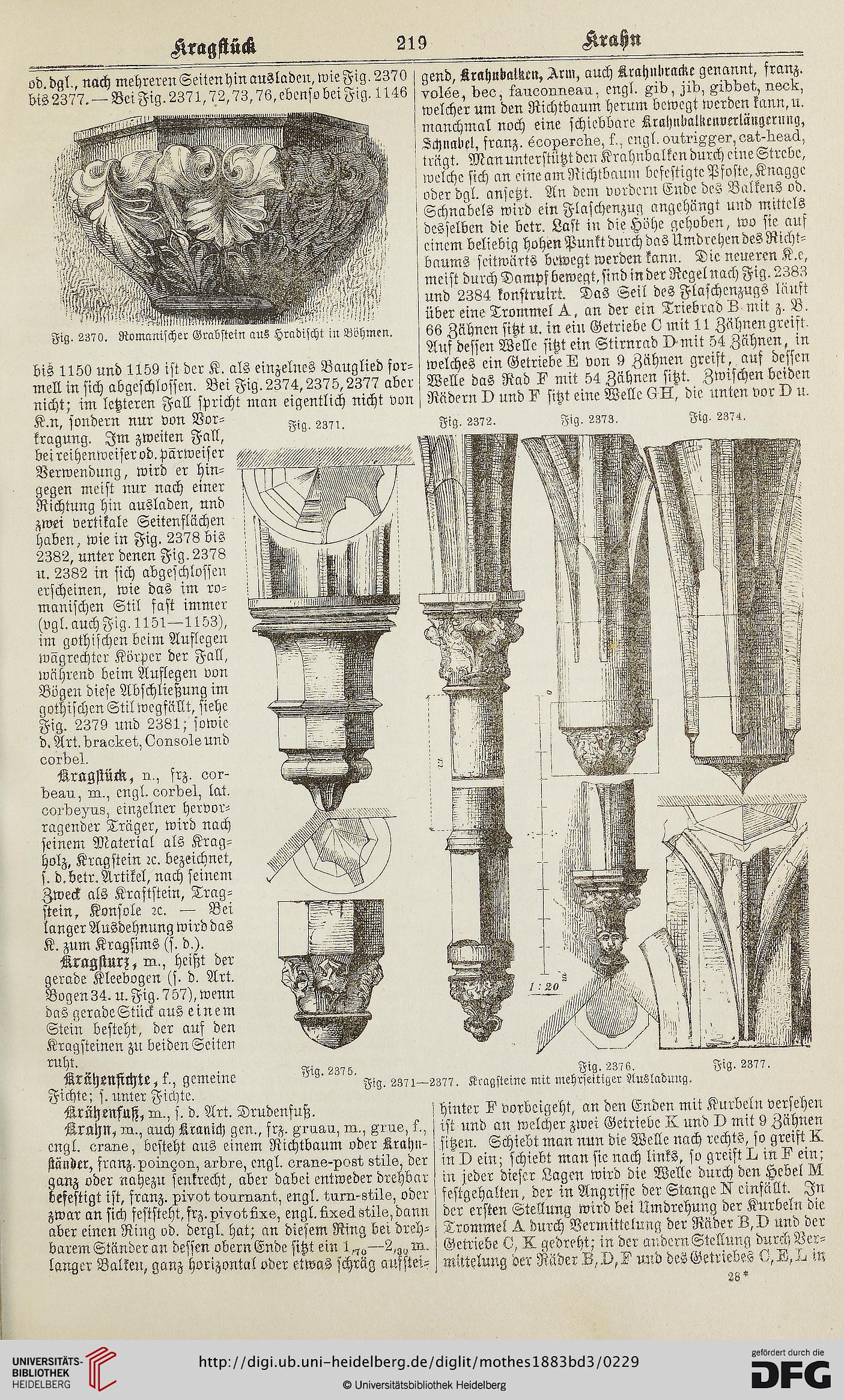Kragstück 219 Kraßn
od.dgl,, nach mehreren Seitenhin ausladen, wie Fig. 2370
bis 2377. — Bei Fig. 2371,72,73,76, ebenso bei Fig. 1146
Fig. 2371.
Fig. 2370. Romanischer Grabstein aus Hradijcht in Böhmen.
bis 1150 und 1159 ist der K. als einzelnes Bauglied for-
mell in sich abgeschlossen. Bei Fig. 2374,2375,2377 aber
nicht; im letzteren Fall spricht man eigentlich nicht von
K.n, sondern nur von Vor-
kragung. Im zweiten Fall,
beireihenweiser od.pärweiser
Verwendung, wird er hin-
gegen meist nur nach einer
Richtung hin ausladen, und
zwei vertikale Seitenflächen
haben, wie in Fig. 2378 bis
2382, unter denen Fig. 2378
u. 2382 in sich abgeschlossen
erscheinen, wie das im ro-
manischen Stil fast immer
(vgl. auchFig. 1151—1153),
im gothischen beim Auflegen
wägrechtcr Körper der Fall,
während beim Auslegen von
Bogen diese Abschließung im
gothischen Stil wegsällt, siehe
Fig. 2379 und 2381; sowie
d. Art. bravüvk, Eonsolv und
vorbei.
KragMck, u., frz. vor-
beau, m., engl, vorbei, lat.
vorbezms, einzelner hervor-
ragender Träger, wird nach
seinem Material als Krag-
holz, Kragstein re. bezeichnet,
s. d.betr. Artikel, nach seinem
Zweck als Kraststein, Trag-
stein, Konsole rc. — Bei
langer Ausdehnung wird das
K. zum Kragsims ('s. d.).
Kragstur;, m., heißt der
gerade Kleebogen (s. d. Art.
Bogen34. u.Fig.757),wenn
das gerade Stück aus einem
Stein besteht, der auf den
Kragsteinen zu beiden Seiten
ruht.
Krähenfichte, ü, gemeine
Fichte; s. unter Fichte.
Krähensufi, m., s. d. Art. Drudenfuß.
Krahn, ra., auch Kranich gen., frz. ^ruau, na., gn uv, ll,
engl, erans, besteht aus einem Richtbaum oder Lrahii-
jtäiider, franz. poiutzou, arbos, engl, ei-arm-post, 8kiis, der
ganz oder nahezu senkrecht, aber dabei entweder drehbar
befestigt ist, franz. xivok kournank, engl, lurn-stils, oder
zwar an sich feststeht, frz. pivotLxv, engl, llxsckstilv, dann
aber einen Ring od. dergl. hat; an diesem Ring bet dreh-
barem Ständer an dessen obern Ende sitzt ein 1,^—2.g,,m.
langer Balken, ganz horizontal oder etwas schräg aufstei-
gend, Lrahndalimi, Arm, auch Lrahiilwacke genannt, franz.
volvs, bsv, lbnvonnsaa, engl, ^ib, sib, ^ibdsk, nvvb,
welcher um den Richtbaum herum bewegt werden kann,u.
manchmal noch eine schiebbare Lrahniialllcnverlängcrung,
Zchnabel, franz. vooxvrvbs, ü, engl. oukniA^sr,vLk-b6aä,
trägt. Man unterstützt den Krahnbalken durch eine Strebe,
. ivelchc sich an eine am Richtbaum befestigte Pfoste, Knagge
oder dgl. ansctzt. An dem »ordern Ende des Balkens od.
^ Schnabels wird ein Flaschenzug eingehängt und mittels
desselben die bctr. Last in die Höhe gehoben, wo sie auf
einem beliebig hohen Punkt durch das Umdrehen des Richt-
baums seitwärts bewegt werden kann. Die neueren K.e,
meist durch Dampf bewegt, sind in der Regel nach Fig. 2383
und 2384 konstruirt. Das Seil des Flaschenzugs läuft
über eine Trommel A, an der ein Triebrad 8 mit z. B.
66 Zähnen sitzt u. in ein Getriebe 0 mit 11 Zähnen greift.
Auf dessen Welle sitzt ein Stirnrad O-mit 54 Zähnen, in
welches ein Getriebe 8 von 9 Zähnen greift, aus dessen
Welle das Rad 8 mit 54 Zähnen sitzt. Zwischen beiden
Rädern I) und 8 sitzt eine Welle 6II, die unten vor I) u.
Fig. 2372.
Fig. 2373.
Fig. 2374.
Fig. 2375.
Fig. 237 6.
Fig. 2371—2377. Kragsteine mit mehrseitiger Ausladung.
Fig. 2377.
hinter 8 vorbeigeht, an dm Enden mit Kurbeln versehen
ist und an welcher zwei Getriebe L und I) mit 9 Zähnen
sitzen. Schiebt man nun die Welle nach rechts, so greift L
in I) ein; schiebt man sic nach links, so greift 8 in 8 ein;
in jeder dieser Lagen wird die Welle durch den Hebel M
festgehalten, der in Angriffe der Stange X cinfällt. In
der ersten Stellung wird bei Umdrehung der Kurbeln die
Trommel T durch Vermittelung der Räder ö,D und der
Getriebe 0, L gedreht; in der andern Stellung durch Ver-
mittelung der Räder und des Getriebes shD.T, m
od.dgl,, nach mehreren Seitenhin ausladen, wie Fig. 2370
bis 2377. — Bei Fig. 2371,72,73,76, ebenso bei Fig. 1146
Fig. 2371.
Fig. 2370. Romanischer Grabstein aus Hradijcht in Böhmen.
bis 1150 und 1159 ist der K. als einzelnes Bauglied for-
mell in sich abgeschlossen. Bei Fig. 2374,2375,2377 aber
nicht; im letzteren Fall spricht man eigentlich nicht von
K.n, sondern nur von Vor-
kragung. Im zweiten Fall,
beireihenweiser od.pärweiser
Verwendung, wird er hin-
gegen meist nur nach einer
Richtung hin ausladen, und
zwei vertikale Seitenflächen
haben, wie in Fig. 2378 bis
2382, unter denen Fig. 2378
u. 2382 in sich abgeschlossen
erscheinen, wie das im ro-
manischen Stil fast immer
(vgl. auchFig. 1151—1153),
im gothischen beim Auflegen
wägrechtcr Körper der Fall,
während beim Auslegen von
Bogen diese Abschließung im
gothischen Stil wegsällt, siehe
Fig. 2379 und 2381; sowie
d. Art. bravüvk, Eonsolv und
vorbei.
KragMck, u., frz. vor-
beau, m., engl, vorbei, lat.
vorbezms, einzelner hervor-
ragender Träger, wird nach
seinem Material als Krag-
holz, Kragstein re. bezeichnet,
s. d.betr. Artikel, nach seinem
Zweck als Kraststein, Trag-
stein, Konsole rc. — Bei
langer Ausdehnung wird das
K. zum Kragsims ('s. d.).
Kragstur;, m., heißt der
gerade Kleebogen (s. d. Art.
Bogen34. u.Fig.757),wenn
das gerade Stück aus einem
Stein besteht, der auf den
Kragsteinen zu beiden Seiten
ruht.
Krähenfichte, ü, gemeine
Fichte; s. unter Fichte.
Krähensufi, m., s. d. Art. Drudenfuß.
Krahn, ra., auch Kranich gen., frz. ^ruau, na., gn uv, ll,
engl, erans, besteht aus einem Richtbaum oder Lrahii-
jtäiider, franz. poiutzou, arbos, engl, ei-arm-post, 8kiis, der
ganz oder nahezu senkrecht, aber dabei entweder drehbar
befestigt ist, franz. xivok kournank, engl, lurn-stils, oder
zwar an sich feststeht, frz. pivotLxv, engl, llxsckstilv, dann
aber einen Ring od. dergl. hat; an diesem Ring bet dreh-
barem Ständer an dessen obern Ende sitzt ein 1,^—2.g,,m.
langer Balken, ganz horizontal oder etwas schräg aufstei-
gend, Lrahndalimi, Arm, auch Lrahiilwacke genannt, franz.
volvs, bsv, lbnvonnsaa, engl, ^ib, sib, ^ibdsk, nvvb,
welcher um den Richtbaum herum bewegt werden kann,u.
manchmal noch eine schiebbare Lrahniialllcnverlängcrung,
Zchnabel, franz. vooxvrvbs, ü, engl. oukniA^sr,vLk-b6aä,
trägt. Man unterstützt den Krahnbalken durch eine Strebe,
. ivelchc sich an eine am Richtbaum befestigte Pfoste, Knagge
oder dgl. ansctzt. An dem »ordern Ende des Balkens od.
^ Schnabels wird ein Flaschenzug eingehängt und mittels
desselben die bctr. Last in die Höhe gehoben, wo sie auf
einem beliebig hohen Punkt durch das Umdrehen des Richt-
baums seitwärts bewegt werden kann. Die neueren K.e,
meist durch Dampf bewegt, sind in der Regel nach Fig. 2383
und 2384 konstruirt. Das Seil des Flaschenzugs läuft
über eine Trommel A, an der ein Triebrad 8 mit z. B.
66 Zähnen sitzt u. in ein Getriebe 0 mit 11 Zähnen greift.
Auf dessen Welle sitzt ein Stirnrad O-mit 54 Zähnen, in
welches ein Getriebe 8 von 9 Zähnen greift, aus dessen
Welle das Rad 8 mit 54 Zähnen sitzt. Zwischen beiden
Rädern I) und 8 sitzt eine Welle 6II, die unten vor I) u.
Fig. 2372.
Fig. 2373.
Fig. 2374.
Fig. 2375.
Fig. 237 6.
Fig. 2371—2377. Kragsteine mit mehrseitiger Ausladung.
Fig. 2377.
hinter 8 vorbeigeht, an dm Enden mit Kurbeln versehen
ist und an welcher zwei Getriebe L und I) mit 9 Zähnen
sitzen. Schiebt man nun die Welle nach rechts, so greift L
in I) ein; schiebt man sic nach links, so greift 8 in 8 ein;
in jeder dieser Lagen wird die Welle durch den Hebel M
festgehalten, der in Angriffe der Stange X cinfällt. In
der ersten Stellung wird bei Umdrehung der Kurbeln die
Trommel T durch Vermittelung der Räder ö,D und der
Getriebe 0, L gedreht; in der andern Stellung durch Ver-
mittelung der Räder und des Getriebes shD.T, m