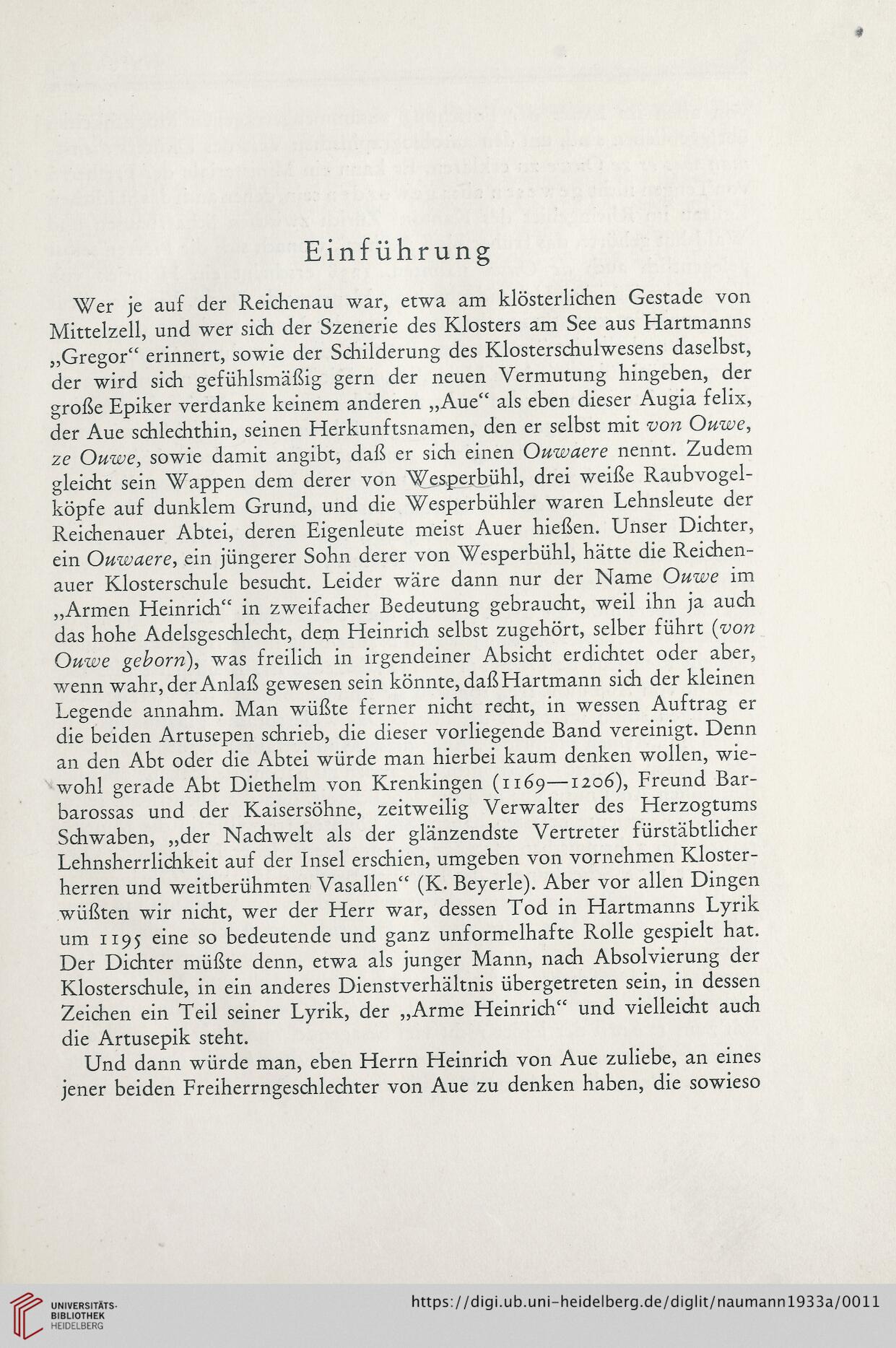Einführung
Wer je auf der Reichenau war, etwa am klösterlichen Gestade von
Mittelzell, und wer sich der Szenerie des Klosters am See aus Hartmanns
,,Gregor“ erinnert, sowie der Schilderung des Klosterschulwesens daselbst,
der wird sich gefühlsmäßig gern der neuen Vermutung hingeben, der
große Epiker verdanke keinem anderen „Aue“ als eben dieser Augia felix,
der Aue schlechthin, seinen Herkunftsnamen, den er selbst mit von Ouwe,
ze Ouwe, sowie damit angibt, daß er sich einen Ouwaere nennt. Zudem
gleicht sein Wappen dem derer von ^esperbühl, drei weiße Raubvogel-
köpfe auf dunklem Grund, und die Wesperbühler waren Lehnsleute der
Reichenauer Abtei, deren Eigenleute meist Auer hießen. Unser Dichter,
ein Ouwaere, ein jüngerer Sohn derer von Wesperbühl, hätte die Reichen-
auer Klosterschule besucht. Leider wäre dann nur der Name Ouwe im
„Armen Heinrich“ in zweifacher Bedeutung gebraucht, weil ihn ja auch
das hohe Adelsgeschlecht, dem Heinrich selbst zugehört, selber führt (von
Ouwe geborn), was freilich in irgendeiner Absicht erdichtet oder aber,
wenn wahr, der Anlaß gewesen sein könnte, daß Hartmann sich der kleinen
Legende annahm. Man wüßte ferner nicht recht, in wessen Auftrag er
die beiden Artusepen schrieb, die dieser vorliegende Band vereinigt. Denn
an den Abt oder die Abtei würde man hierbei kaum denken wollen, wie-
wohl gerade Abt Diethelm von Krenkingen (1169—1206), Freund Bar-
barossas und der Kaisersöhne, zeitweilig Verwalter des Herzogtums
Schwaben, „der Nachwelt als der glänzendste Vertreter fürstäbtlicher
Lehnsherrlichkeit auf der Insel erschien, umgeben von vornehmen Kloster-
herren und weitberühmten Vasallen“ (K. Beyerle). Aber vor allen Dingen
wüßten wir nicht, wer der Herr war, dessen Tod in Hartmanns Lyrik
um 1195 eine so bedeutende und ganz unformelhafte Rolle gespielt hat.
Der Dichter müßte denn, etwa als junger Mann, nach Absolvierung der
Klosterschule, in ein anderes Dienstverhältnis übergetreten sein, in dessen
Zeichen ein Teil seiner Lyrik, der „Arme Heinrich“ und vielleicht auch
die Artusepik steht.
Und dann würde man, eben Herrn Heinrich von Aue zuliebe, an eines
jener beiden Freiherrngeschlechter von Aue zu denken haben, die sowieso
Wer je auf der Reichenau war, etwa am klösterlichen Gestade von
Mittelzell, und wer sich der Szenerie des Klosters am See aus Hartmanns
,,Gregor“ erinnert, sowie der Schilderung des Klosterschulwesens daselbst,
der wird sich gefühlsmäßig gern der neuen Vermutung hingeben, der
große Epiker verdanke keinem anderen „Aue“ als eben dieser Augia felix,
der Aue schlechthin, seinen Herkunftsnamen, den er selbst mit von Ouwe,
ze Ouwe, sowie damit angibt, daß er sich einen Ouwaere nennt. Zudem
gleicht sein Wappen dem derer von ^esperbühl, drei weiße Raubvogel-
köpfe auf dunklem Grund, und die Wesperbühler waren Lehnsleute der
Reichenauer Abtei, deren Eigenleute meist Auer hießen. Unser Dichter,
ein Ouwaere, ein jüngerer Sohn derer von Wesperbühl, hätte die Reichen-
auer Klosterschule besucht. Leider wäre dann nur der Name Ouwe im
„Armen Heinrich“ in zweifacher Bedeutung gebraucht, weil ihn ja auch
das hohe Adelsgeschlecht, dem Heinrich selbst zugehört, selber führt (von
Ouwe geborn), was freilich in irgendeiner Absicht erdichtet oder aber,
wenn wahr, der Anlaß gewesen sein könnte, daß Hartmann sich der kleinen
Legende annahm. Man wüßte ferner nicht recht, in wessen Auftrag er
die beiden Artusepen schrieb, die dieser vorliegende Band vereinigt. Denn
an den Abt oder die Abtei würde man hierbei kaum denken wollen, wie-
wohl gerade Abt Diethelm von Krenkingen (1169—1206), Freund Bar-
barossas und der Kaisersöhne, zeitweilig Verwalter des Herzogtums
Schwaben, „der Nachwelt als der glänzendste Vertreter fürstäbtlicher
Lehnsherrlichkeit auf der Insel erschien, umgeben von vornehmen Kloster-
herren und weitberühmten Vasallen“ (K. Beyerle). Aber vor allen Dingen
wüßten wir nicht, wer der Herr war, dessen Tod in Hartmanns Lyrik
um 1195 eine so bedeutende und ganz unformelhafte Rolle gespielt hat.
Der Dichter müßte denn, etwa als junger Mann, nach Absolvierung der
Klosterschule, in ein anderes Dienstverhältnis übergetreten sein, in dessen
Zeichen ein Teil seiner Lyrik, der „Arme Heinrich“ und vielleicht auch
die Artusepik steht.
Und dann würde man, eben Herrn Heinrich von Aue zuliebe, an eines
jener beiden Freiherrngeschlechter von Aue zu denken haben, die sowieso