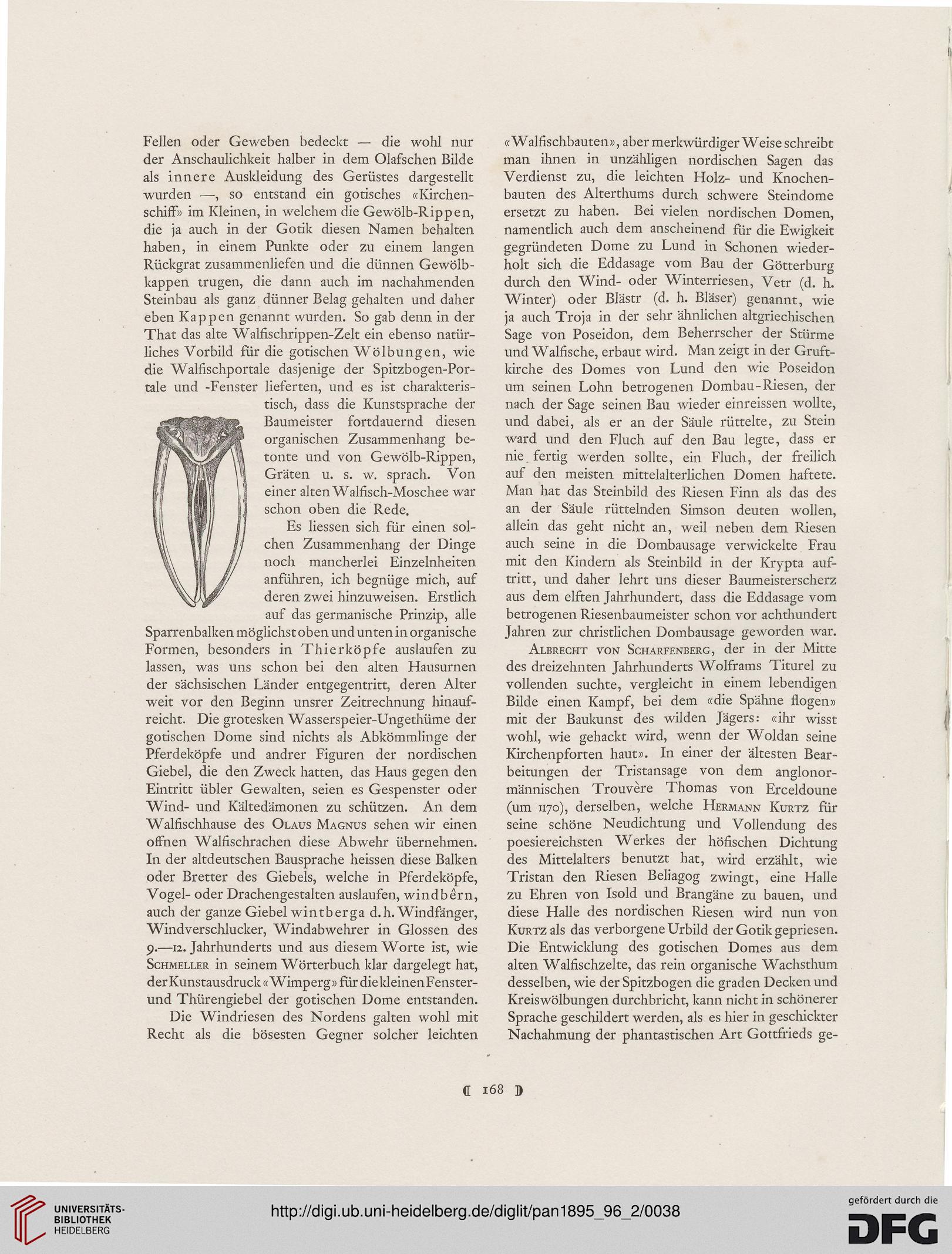Fellen oder Geweben bedeckt — die wohl nur
der Anschaulichkeit halber in dem Olafschen Bilde
als innere Auskleidung des Gerüstes dargestellt
wurden —, so entstand ein gotisches «Kirchen-
schiff» im Kleinen, in welchem die Gewölb-Rippen,
die ja auch in der Gotik diesen Namen behalten
haben, in einem Punkte oder zu einem langen
Rückgrat zusammenliefen und die dünnen Gewölb-
kappen trugen, die dann auch im nachahmenden
Steinbau als ganz dünner Belag gehalten und daher
eben Kappen genannt wurden. So gab denn in der
That das alte Walfischrippen-Zelt ein ebenso natür-
liches Vorbild für die gotischen Wölbungen, wie
die Walfischportale dasjenige der Spitzbogen-Por-
tale und -Fenster lieferten, und es ist charakteris-
tisch, dass die Kunstsprache der
Baumeister fortdauernd diesen
organischen Zusammenhang be-
tonte und von Gewölb-Rippen,
Gräten u. s. w. sprach. Von
einer alten Walfisch-Moschee war
schon oben die Rede.
Es Hessen sich für einen sol-
chen Zusammenhang der Dinge
noch mancherlei Einzelnheiten
anführen, ich begnüge mich, auf
deren zwei hinzuweisen. Erstlich
auf das germanische Prinzip, alle
Sparrenbalken möglichst oben und unten in organische
Formen, besonders in Thierköpfe auslaufen zu
lassen, was uns schon bei den alten Hausurnen
der sächsischen Länder entgegentritt, deren Alter
weit vor den Beginn unsrer Zeitrechnung hinauf-
reicht. Die grotesken Wasserspeier-Ungethüme der
gotischen Dome sind nichts als Abkömmlinge der
Pferdeköpfe und andrer Figuren der nordischen
Giebel, die den Zweck hatten, das Haus gegen den
Eintritt übler Gewalten, seien es Gespenster oder
Wind- und Kältedämonen zu schützen. An dem
Walfischhause des Olaus Magnus sehen wir einen
offnen Walfischrachen diese Abwehr übernehmen.
In der altdeutschen Bausprache heissen diese Balken
oder Bretter des Giebels, welche in Pferdeköpfe,
Vogel- oder Drachengestalten auslaufen, windbern,
auch der ganze Giebel wintberga d.h. Windfänger,
Windverschlucker, Windabwehrer in Glossen des
9.—12. Jahrhunderts und aus diesem Worte ist, wie
Schmeller in seinem Wörterbuch klar dargelegt hat,
der Kunstausdruck «Wimperg» für die kleinenFenster-
und Thürengiebel der gotischen Dome entstanden.
Die Windriesen des Nordens galten wohl mit
Recht als die bösesten Gegner solcher leichten
«Walfischbauten», aber merkwürdigerweise schreibt
man ihnen in unzähligen nordischen Sagen das
Verdienst zu, die leichten Holz- und Knochen-
bauten des Alterthums durch schwere Steindome
ersetzt zu haben. Bei vielen nordischen Domen,
namentlich auch dem anscheinend für die Ewigkeit
gegründeten Dome zu Lund in Schonen wieder-
holt sich die Eddasage vom Bau der Götterburg
durch den Wind- oder Winterriesen, Vetr (d. h.
Winter) oder Blästr (d. h. Bläser) genannt, wie
ja auch Troja in der sehr ähnlichen altgriechischen
Sage von Poseidon, dem Beherrscher der Stürme
und Walfische, erbaut wird. Man zeigt in der Gruft-
kirche des Domes von Lund den wie Poseidon
um seinen Lohn betrogenen Dombau-Riesen, der
nach der Sage seinen Bau wieder einreissen wollte,
und dabei, als er an der Säule rüttelte, zu Stein
ward und den Fluch auf den Bau legte, dass er
nie fertig werden sollte, ein Fluch, der freilich
auf den meisten mittelalterlichen Domen haftete.
Man hat das Steinbild des Riesen Finn als das des
an der Säule rüttelnden Simson deuten wollen,
allein das geht nicht an, weil neben dem Riesen
auch seine in die Dombausage verwickelte Frau
mit den Kindern als Steinbild in der Krypta auf-
tritt, und daher lehrt uns dieser Baumeisterscherz
aus dem elften Jahrhundert, dass die Eddasage vom
betrogenen Riesenbaumeister schon vor achthundert
Jahren zur christlichen Dombausage geworden war.
Albrecht von Scharfenberg, der in der Mitte
des dreizehnten Jahrhunderts Wolframs Titurel zu
vollenden suchte, vergleicht in einem lebendigen
Bilde einen Kampf, bei dem «die Spänne flogen»
mit der Baukunst des wilden Jägers: «ihr wisst
wohl, wie gehackt wird, wenn der Woldan seine
Kirchenpforten haut». In einer der ältesten Bear-
beitungen der Tristansage von dem anglonor-
männischen Trouvere Thomas von Erceldoune
(um 1170), derselben, welche Hermann Kurtz für
seine schöne Neudichtung und Vollendung des
poesiereichsten Werkes der höfischen Dichtung
des Mittelalters benutzt hat, wird erzählt, wie
Tristan den Riesen Beliagog zwingt, eine Halle
zu Ehren von Isold und Brangäne zu bauen, und
diese Halle des nordischen Riesen wird nun von
Kurtz als das verborgene Urbild der Gotik gepriesen.
Die Entwicklung des gotischen Domes aus dem
alten Walfischzelte, das rein organische Wachsthum
desselben, wie der Spitzbogen die graden Decken und
Kreiswölbungen durchbricht, kann nicht in schönerer
Sprache geschildert werden, als es hier in geschickter
Nachahmung der phantastischen Art Gottfrieds ge-
il 168 »
der Anschaulichkeit halber in dem Olafschen Bilde
als innere Auskleidung des Gerüstes dargestellt
wurden —, so entstand ein gotisches «Kirchen-
schiff» im Kleinen, in welchem die Gewölb-Rippen,
die ja auch in der Gotik diesen Namen behalten
haben, in einem Punkte oder zu einem langen
Rückgrat zusammenliefen und die dünnen Gewölb-
kappen trugen, die dann auch im nachahmenden
Steinbau als ganz dünner Belag gehalten und daher
eben Kappen genannt wurden. So gab denn in der
That das alte Walfischrippen-Zelt ein ebenso natür-
liches Vorbild für die gotischen Wölbungen, wie
die Walfischportale dasjenige der Spitzbogen-Por-
tale und -Fenster lieferten, und es ist charakteris-
tisch, dass die Kunstsprache der
Baumeister fortdauernd diesen
organischen Zusammenhang be-
tonte und von Gewölb-Rippen,
Gräten u. s. w. sprach. Von
einer alten Walfisch-Moschee war
schon oben die Rede.
Es Hessen sich für einen sol-
chen Zusammenhang der Dinge
noch mancherlei Einzelnheiten
anführen, ich begnüge mich, auf
deren zwei hinzuweisen. Erstlich
auf das germanische Prinzip, alle
Sparrenbalken möglichst oben und unten in organische
Formen, besonders in Thierköpfe auslaufen zu
lassen, was uns schon bei den alten Hausurnen
der sächsischen Länder entgegentritt, deren Alter
weit vor den Beginn unsrer Zeitrechnung hinauf-
reicht. Die grotesken Wasserspeier-Ungethüme der
gotischen Dome sind nichts als Abkömmlinge der
Pferdeköpfe und andrer Figuren der nordischen
Giebel, die den Zweck hatten, das Haus gegen den
Eintritt übler Gewalten, seien es Gespenster oder
Wind- und Kältedämonen zu schützen. An dem
Walfischhause des Olaus Magnus sehen wir einen
offnen Walfischrachen diese Abwehr übernehmen.
In der altdeutschen Bausprache heissen diese Balken
oder Bretter des Giebels, welche in Pferdeköpfe,
Vogel- oder Drachengestalten auslaufen, windbern,
auch der ganze Giebel wintberga d.h. Windfänger,
Windverschlucker, Windabwehrer in Glossen des
9.—12. Jahrhunderts und aus diesem Worte ist, wie
Schmeller in seinem Wörterbuch klar dargelegt hat,
der Kunstausdruck «Wimperg» für die kleinenFenster-
und Thürengiebel der gotischen Dome entstanden.
Die Windriesen des Nordens galten wohl mit
Recht als die bösesten Gegner solcher leichten
«Walfischbauten», aber merkwürdigerweise schreibt
man ihnen in unzähligen nordischen Sagen das
Verdienst zu, die leichten Holz- und Knochen-
bauten des Alterthums durch schwere Steindome
ersetzt zu haben. Bei vielen nordischen Domen,
namentlich auch dem anscheinend für die Ewigkeit
gegründeten Dome zu Lund in Schonen wieder-
holt sich die Eddasage vom Bau der Götterburg
durch den Wind- oder Winterriesen, Vetr (d. h.
Winter) oder Blästr (d. h. Bläser) genannt, wie
ja auch Troja in der sehr ähnlichen altgriechischen
Sage von Poseidon, dem Beherrscher der Stürme
und Walfische, erbaut wird. Man zeigt in der Gruft-
kirche des Domes von Lund den wie Poseidon
um seinen Lohn betrogenen Dombau-Riesen, der
nach der Sage seinen Bau wieder einreissen wollte,
und dabei, als er an der Säule rüttelte, zu Stein
ward und den Fluch auf den Bau legte, dass er
nie fertig werden sollte, ein Fluch, der freilich
auf den meisten mittelalterlichen Domen haftete.
Man hat das Steinbild des Riesen Finn als das des
an der Säule rüttelnden Simson deuten wollen,
allein das geht nicht an, weil neben dem Riesen
auch seine in die Dombausage verwickelte Frau
mit den Kindern als Steinbild in der Krypta auf-
tritt, und daher lehrt uns dieser Baumeisterscherz
aus dem elften Jahrhundert, dass die Eddasage vom
betrogenen Riesenbaumeister schon vor achthundert
Jahren zur christlichen Dombausage geworden war.
Albrecht von Scharfenberg, der in der Mitte
des dreizehnten Jahrhunderts Wolframs Titurel zu
vollenden suchte, vergleicht in einem lebendigen
Bilde einen Kampf, bei dem «die Spänne flogen»
mit der Baukunst des wilden Jägers: «ihr wisst
wohl, wie gehackt wird, wenn der Woldan seine
Kirchenpforten haut». In einer der ältesten Bear-
beitungen der Tristansage von dem anglonor-
männischen Trouvere Thomas von Erceldoune
(um 1170), derselben, welche Hermann Kurtz für
seine schöne Neudichtung und Vollendung des
poesiereichsten Werkes der höfischen Dichtung
des Mittelalters benutzt hat, wird erzählt, wie
Tristan den Riesen Beliagog zwingt, eine Halle
zu Ehren von Isold und Brangäne zu bauen, und
diese Halle des nordischen Riesen wird nun von
Kurtz als das verborgene Urbild der Gotik gepriesen.
Die Entwicklung des gotischen Domes aus dem
alten Walfischzelte, das rein organische Wachsthum
desselben, wie der Spitzbogen die graden Decken und
Kreiswölbungen durchbricht, kann nicht in schönerer
Sprache geschildert werden, als es hier in geschickter
Nachahmung der phantastischen Art Gottfrieds ge-
il 168 »