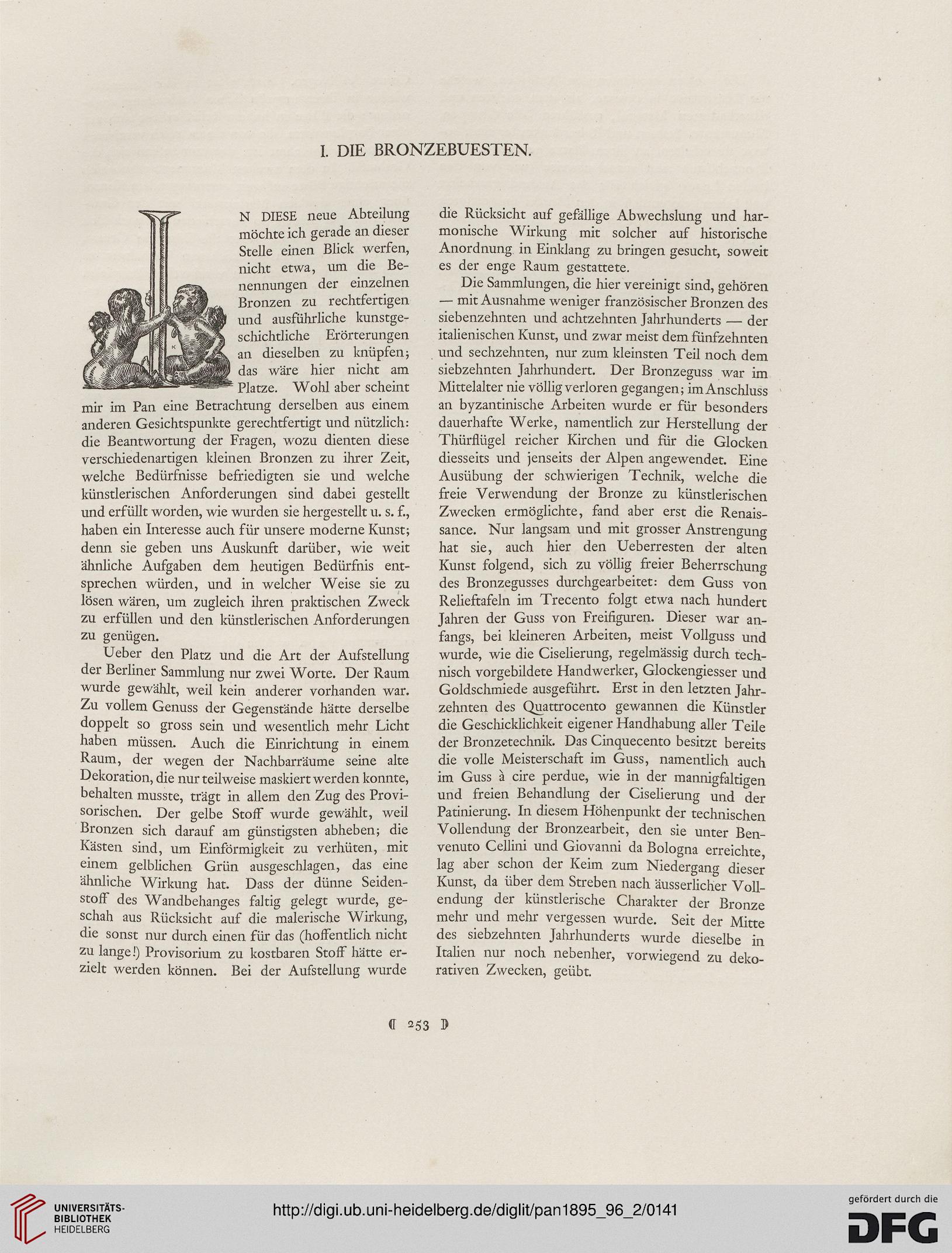I. DIE BRONZEBUESTEN.
N DIESE neue Abteilung
möchte ich gerade an dieser
Stelle einen Blick werfen,
nicht etwa, um die Be-
nennungen der einzelnen
Bronzen zu rechtfertigen
und ausführliche kunstge-
schichtliche Erörterungen
an dieselben zu knüpfen;
das wäre hier nicht am
^^^^^^^^^^^^ Platze. Wohl aber scheint
mir im Pan eine Betrachtung derselben aus einem
anderen Gesichtspunkte gerechtfertigt und nützlich:
die Beantwortung der Fragen, wozu dienten diese
verschiedenartigen kleinen Bronzen zu ihrer Zeit,
welche Bedürfnisse befriedigten sie und welche
künstlerischen Anforderungen sind dabei gestellt
und erfüllt worden, wie wurden sie hergestellt u. s. f.,
haben ein Interesse auch für unsere moderne Kunst;
denn sie geben uns Auskunft darüber, wie weit
ähnliche Aufgaben dem heutigen Bedürfnis ent-
sprechen würden, und in welcher Weise sie zu
lösen wären, um zugleich ihren praktischen Zweck
zu erfüllen und den künstlerischen Anforderungen
zu genügen.
Ueber den Platz und die Art der Aufstellung
der Berliner Sammlung nur zwei Worte. Der Raum
wurde gewählt, weil kein anderer vorhanden war.
Zu vollem Genuss der Gegenstände hätte derselbe
doppelt so gross sein und wesentlich mehr Licht
haben müssen. Auch die Einrichtung in einem
Raum, der wegen der Nachbarräume seine alte
Dekoration, die nur teilweise maskiert werden konnte,
behalten musste, trägt in allem den Zug des Provi-
sorischen. Der gelbe Stoff wurde gewählt, weil
Bronzen sich darauf am günstigsten abheben; die
Kästen sind, um Einförmigkeit zu verhüten, mit
einem gelblichen Grün ausgeschlagen, das eine
ähnliche Wirkung hat. Dass der dünne Seiden-
stoff des Wandbehanges faltig gelegt wurde, ge-
schah aus Rücksicht auf die malerische Wirkung,
die sonst nur durch einen für das (hoffentlich nicht
zu lange!) Provisorium zu kostbaren Stoff hätte er-
zielt werden können. Bei der Aufstellung wurde
die Rücksicht auf gefällige Abwechslung und har-
monische Wirkung mit solcher auf historische
Anordnung in Einklang zu bringen gesucht, soweit
es der enge Raum gestattete.
Die Sammlungen, die hier vereinigt sind, gehören
— mit Ausnahme weniger französischer Bronzen des
siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts — der
italienischen Kunst, und zwar meist dem fünfzehnten
und sechzehnten, nur zum kleinsten Teil noch dem
siebzehnten Jahrhundert. Der Bronzeguss war im
Mittelalter nie völlig verloren gegangen; im Anschluss
an byzantinische Arbeiten wurde er für besonders
dauerhafte Werke, namentlich zur Herstellung der
Thürflügel reicher Kirchen und für die Glocken
diesseits und jenseits der Alpen angewendet. Eine
Ausübung der schwierigen Technik, welche die
freie Verwendung der Bronze zu künstlerischen
Zwecken ermöglichte, fand aber erst die Renais-
sance. Nur langsam und mit grosser Anstrengung
hat sie, auch hier den Ueberresten der alten
Kunst folgend, sich zu völlig freier Beherrschung
des Bronzegusses durchgearbeitet: dem Guss von
Relieftafeln im Trecento folgt etwa nach hundert
Jahren der Guss von Freifiguren. Dieser war an-
fangs, bei kleineren Arbeiten, meist Vollguss und
wurde, wie die Ciselierung, regelmässig durch tech-
nisch vorgebildete Handwerker, Glockengiesser und
Goldschmiede ausgeführt. Erst in den letzten Jahr-
zehnten des Quattrocento gewannen die Künstler
die Geschicklichkeit eigener Handhabung aller Teile
der Bronzetechnik. Das Cinquecento besitzt bereits
die volle Meisterschaft im Guss, namentlich auch
im Guss ä cire perdue, wie in der mannigfaltigen
und freien Behandlung der Ciselierung und der
Patinierung. In diesem Höhenpunkt der technischen
Vollendung der Bronzearbeit, den sie unter Ben-
venuto Cellini und Giovanni da Bologna erreichte
lag aber schon der Keim zum Niedergang dieser
Kunst, da über dem Streben nach äusserlicher Voll-
endung der künstlerische Charakter der Bronze
mehr und mehr vergessen wurde. Seit der Mitte
des siebzehnten Jahrhunderts wurde dieselbe in
Italien nur noch nebenher, vorwiegend zu deko-
rativen Zwecken, geübt.
ff 253 »
N DIESE neue Abteilung
möchte ich gerade an dieser
Stelle einen Blick werfen,
nicht etwa, um die Be-
nennungen der einzelnen
Bronzen zu rechtfertigen
und ausführliche kunstge-
schichtliche Erörterungen
an dieselben zu knüpfen;
das wäre hier nicht am
^^^^^^^^^^^^ Platze. Wohl aber scheint
mir im Pan eine Betrachtung derselben aus einem
anderen Gesichtspunkte gerechtfertigt und nützlich:
die Beantwortung der Fragen, wozu dienten diese
verschiedenartigen kleinen Bronzen zu ihrer Zeit,
welche Bedürfnisse befriedigten sie und welche
künstlerischen Anforderungen sind dabei gestellt
und erfüllt worden, wie wurden sie hergestellt u. s. f.,
haben ein Interesse auch für unsere moderne Kunst;
denn sie geben uns Auskunft darüber, wie weit
ähnliche Aufgaben dem heutigen Bedürfnis ent-
sprechen würden, und in welcher Weise sie zu
lösen wären, um zugleich ihren praktischen Zweck
zu erfüllen und den künstlerischen Anforderungen
zu genügen.
Ueber den Platz und die Art der Aufstellung
der Berliner Sammlung nur zwei Worte. Der Raum
wurde gewählt, weil kein anderer vorhanden war.
Zu vollem Genuss der Gegenstände hätte derselbe
doppelt so gross sein und wesentlich mehr Licht
haben müssen. Auch die Einrichtung in einem
Raum, der wegen der Nachbarräume seine alte
Dekoration, die nur teilweise maskiert werden konnte,
behalten musste, trägt in allem den Zug des Provi-
sorischen. Der gelbe Stoff wurde gewählt, weil
Bronzen sich darauf am günstigsten abheben; die
Kästen sind, um Einförmigkeit zu verhüten, mit
einem gelblichen Grün ausgeschlagen, das eine
ähnliche Wirkung hat. Dass der dünne Seiden-
stoff des Wandbehanges faltig gelegt wurde, ge-
schah aus Rücksicht auf die malerische Wirkung,
die sonst nur durch einen für das (hoffentlich nicht
zu lange!) Provisorium zu kostbaren Stoff hätte er-
zielt werden können. Bei der Aufstellung wurde
die Rücksicht auf gefällige Abwechslung und har-
monische Wirkung mit solcher auf historische
Anordnung in Einklang zu bringen gesucht, soweit
es der enge Raum gestattete.
Die Sammlungen, die hier vereinigt sind, gehören
— mit Ausnahme weniger französischer Bronzen des
siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts — der
italienischen Kunst, und zwar meist dem fünfzehnten
und sechzehnten, nur zum kleinsten Teil noch dem
siebzehnten Jahrhundert. Der Bronzeguss war im
Mittelalter nie völlig verloren gegangen; im Anschluss
an byzantinische Arbeiten wurde er für besonders
dauerhafte Werke, namentlich zur Herstellung der
Thürflügel reicher Kirchen und für die Glocken
diesseits und jenseits der Alpen angewendet. Eine
Ausübung der schwierigen Technik, welche die
freie Verwendung der Bronze zu künstlerischen
Zwecken ermöglichte, fand aber erst die Renais-
sance. Nur langsam und mit grosser Anstrengung
hat sie, auch hier den Ueberresten der alten
Kunst folgend, sich zu völlig freier Beherrschung
des Bronzegusses durchgearbeitet: dem Guss von
Relieftafeln im Trecento folgt etwa nach hundert
Jahren der Guss von Freifiguren. Dieser war an-
fangs, bei kleineren Arbeiten, meist Vollguss und
wurde, wie die Ciselierung, regelmässig durch tech-
nisch vorgebildete Handwerker, Glockengiesser und
Goldschmiede ausgeführt. Erst in den letzten Jahr-
zehnten des Quattrocento gewannen die Künstler
die Geschicklichkeit eigener Handhabung aller Teile
der Bronzetechnik. Das Cinquecento besitzt bereits
die volle Meisterschaft im Guss, namentlich auch
im Guss ä cire perdue, wie in der mannigfaltigen
und freien Behandlung der Ciselierung und der
Patinierung. In diesem Höhenpunkt der technischen
Vollendung der Bronzearbeit, den sie unter Ben-
venuto Cellini und Giovanni da Bologna erreichte
lag aber schon der Keim zum Niedergang dieser
Kunst, da über dem Streben nach äusserlicher Voll-
endung der künstlerische Charakter der Bronze
mehr und mehr vergessen wurde. Seit der Mitte
des siebzehnten Jahrhunderts wurde dieselbe in
Italien nur noch nebenher, vorwiegend zu deko-
rativen Zwecken, geübt.
ff 253 »